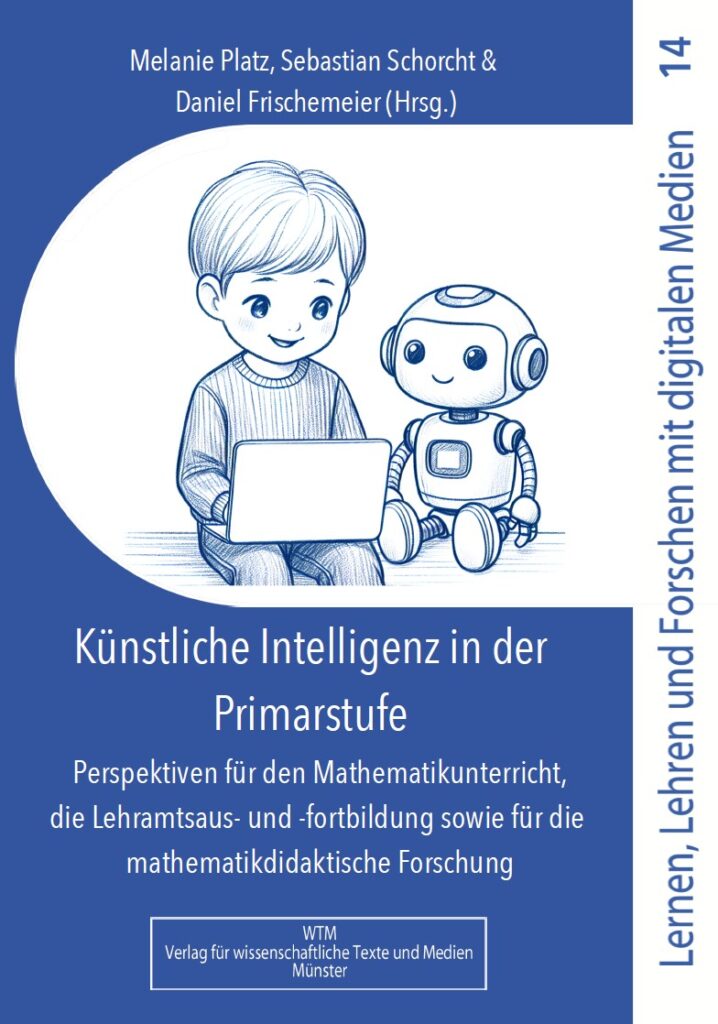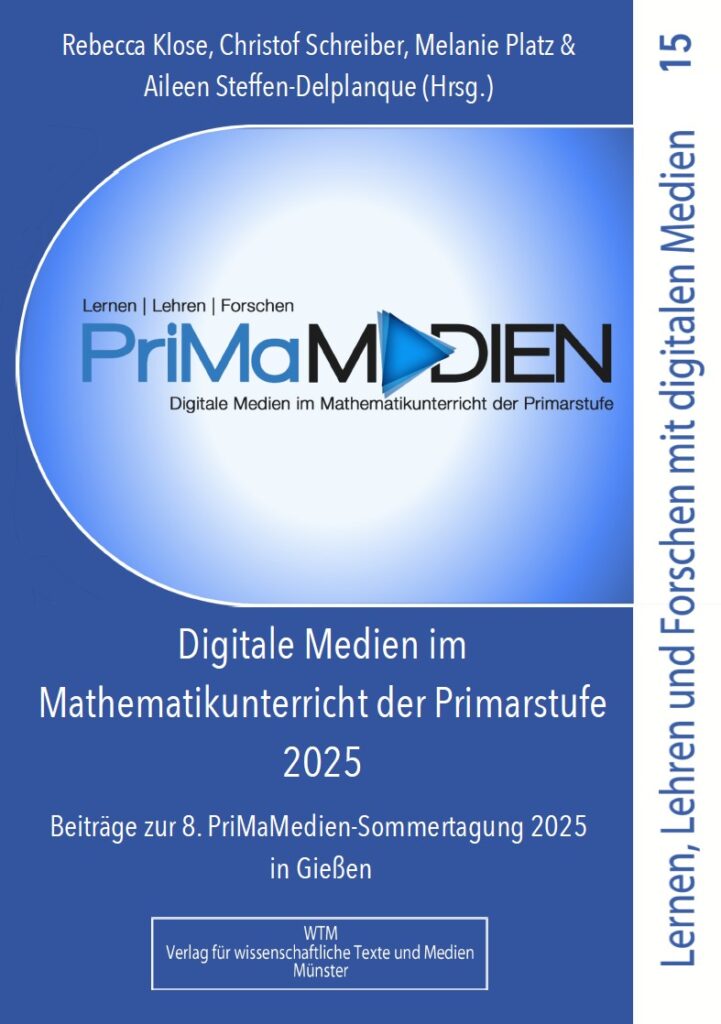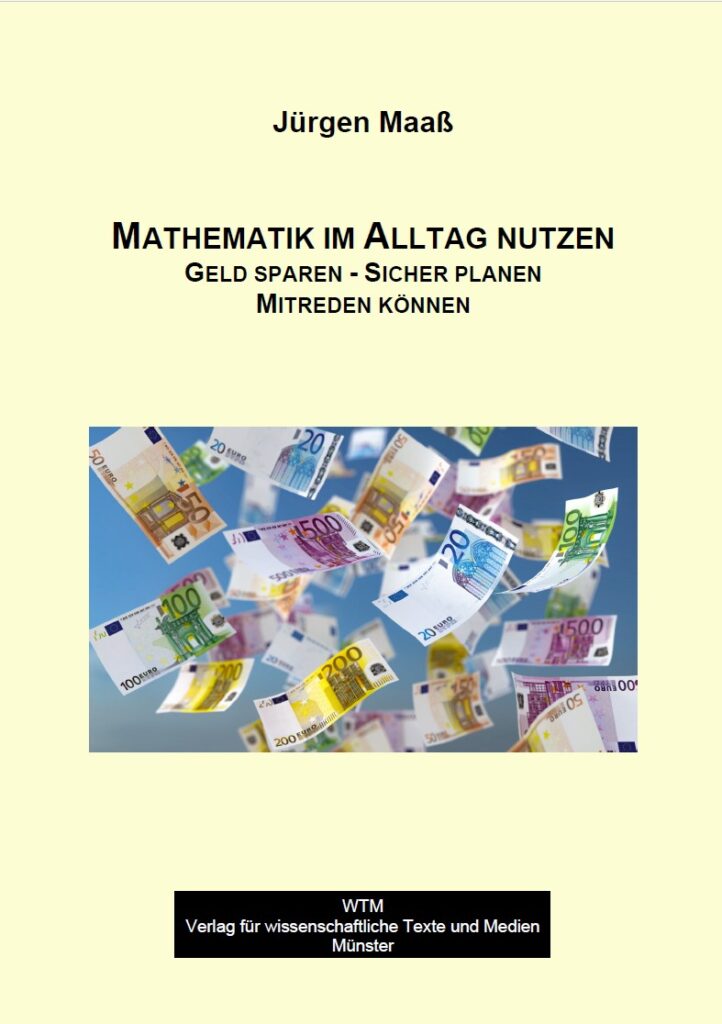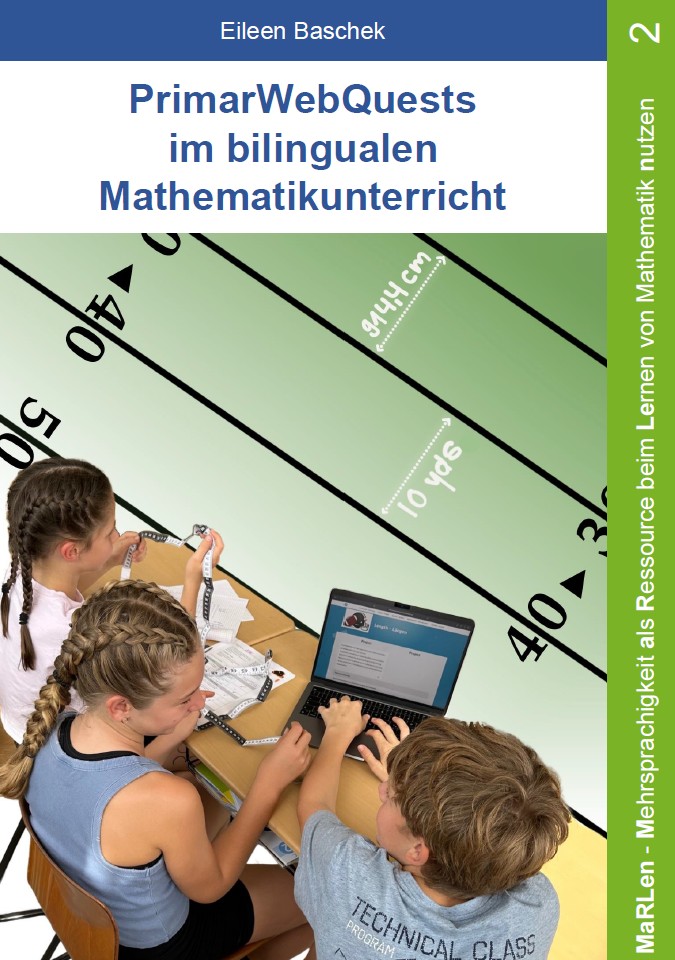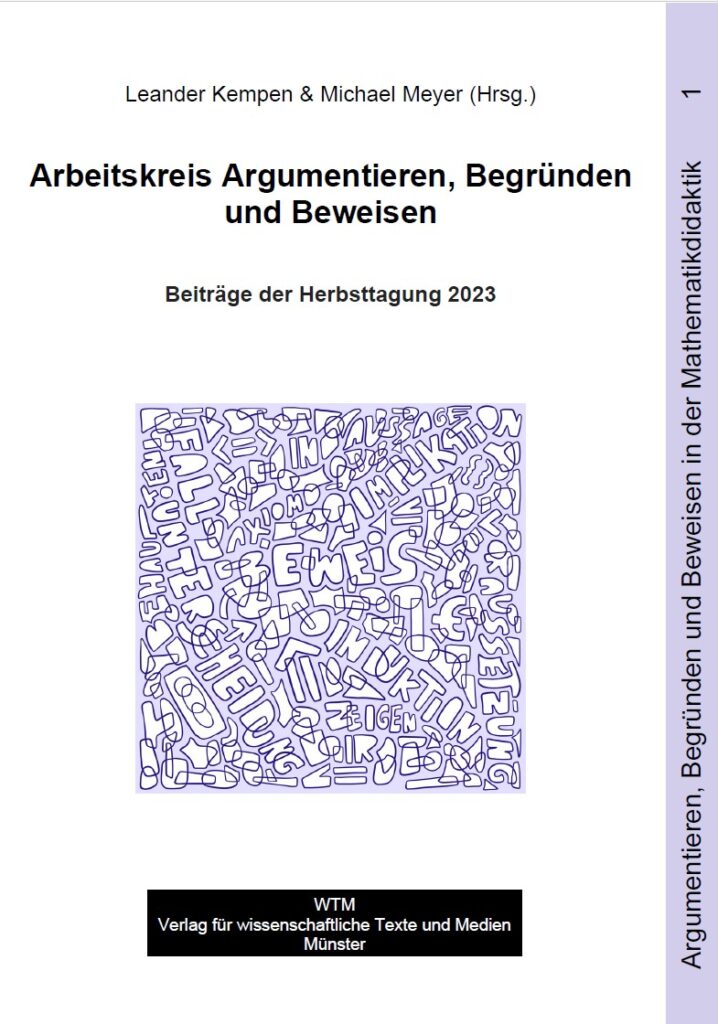Tagungsband zur Vernetzungstagung 2024 in Siegen
Tagungsband zur Vernetzungstagung 2024 in Siegen
Vol. 5 of the series Reihe Mathematiklernen mit digitalen Medien
Münster: WTM-Verlag 2025
Ca. 150 Seiten, s/w, DIN A5
978-3-95987-345-1 Print 23,90 €
978-3-95987-346-8 E-Book Open Access
Hier können Sie das gedruckte Buch kaufen.
Hier können sie das E-Book gratis herunterladen
https://doi.org/10.37626/GA9783959873468.0
The E-Book is Open Access under Creative Commons licence

Documentation of Review-Process
- What – What is being reviewed? All papers in the book
- Who – Who conducts the peer review? 2 external peer reviewers
- How – What is the level of anonymity? All identities known
- When – At what stage is the peer review being conducted? Pre-publication
- Peer review is overseen by: member of the editorial board of the edited book
Abstract
Die Digitalisierung prägt inzwischen alle Ebenen mathematischer Bildung. Auf der dritten Vernetzungstagung „Mathematikunterricht mit digitalen Medien und Werkzeugen in Schule und Forschung“, die im Mai 2024 an der Universität Siegen stattfand, wurden aktuelle Entwicklungen erneut gemeinsam von Wissenschaft und Praxis diskutiert.
Der vorliegende Tagungsband versammelt zwölf begutachtete Beiträge, die ein breites Spektrum an Perspektiven abbilden – von Grundschule bis Hochschule, von konzeptuellen Rahmenmodellen bis zu konkreten Unterrichtsszenarien. Ein Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf dem Einsatz Künstlicher Intelligenz: Beispiele reichen von ChatGPT in der Lehrkräftebildung über adaptive Assistenzsysteme bis hin zu KI-unterstützten Escape-Games. Daneben werden bewährte digitale Werkzeuge, interaktive Lernumgebungen und theoretische Fundierungen untersucht. Der Band richtet sich an Lehrkräfte, Ausbildende, Forschende und Studierende, die Potenziale und Herausforderungen der Digitalisierung im Mathematikunterricht reflektiert erschließen möchten.
BEITRÄGE
=====================================================
Kevin Hörnberger: Ein Vorschlag für eine Typologie von Lehrkräften zum Einsatz digitaler Medien im Mathematikunterricht im Projekt DigiMath4Edu
Abstract
Im Rahmen des Forschungsprojekts DigiMath4Edu widmet sich das vorliegende Forschungsvorhaben der Untersuchung des Themas „archetypische Auffassungen von Lehrkräften zu digitalen Medien im Mathematikunterricht“. Ziel ist es, tiefere Einblicke in die unterschiedlichen Sichtweisen und Herangehensweisen von Lehrkräften im Umgang mit digitalen Medien zu gewinnen. Die Relevanz dieses Forschungsfeldes hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen – nicht zuletzt durch die bildungspolitischen Entwicklungen im Zuge der fortschreiten-den Digitalisierung (vgl. Eickelmann & Gerick, 2020). Die Corona-Pandemie wirkte hierbei als Beschleuniger: Sie hat Schwächen im digitalen Bildungsbereich offengelegt und zugleich die Notwendigkeit unterstrichen, digitale Kompetenzen bei Lehrkräften systematisch zu fördern (vgl. Huber & Helm, 2020).
Die vorliegende Untersuchung greift hierfür auf die Methode der Typenbildung zurück – ein bewährtes Verfahren aus der qualitativen Sozialforschung, das vor allem in der Soziologie und Psychologie zur systematischen Strukturierung komplexer sozialer Phänomene entwickelt wurde (vgl. Kelle & Kluge, 2010; Kuckartz, 2016). Diese Methodik ermöglicht es, charakteristische Muster im Umgang mit digitalen Medien zu identifizieren, um daraus sowohl theoretische Erkenntnisse zu gewinnen als auch praxisorientierte Ansätze für die Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften zu entwickeln.
Erste Seite: 1
Letzte Seite: 12
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959873468.0.01
=====================================================
Rudolf Hrach: Die Platonischen Körper und mit ihnen verwandte Modelle
Abstract
Der folgende Beitrag stellt die Beschreibung eines Workshops zur Nutzung von Modellen zu den fünf platonischen Körpern und daraus erzeugbaren weiteren Körpern auf der Vernetzungstagung 2024 dar. Die Modelle wurden mithilfe eines 3D-Druckers und weiteren Hilfsmitteln erstellt und bieten eine gute Grundlage für eine handlungsorientierte Einführung der Körper im Mathematikunterricht.
Erste Seite: 13
Letzte Seite: 18
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959873468.0.02
=====================================================
Rebecca Klose, Christof Schreiber & Saskia Thomas: ChatGPT & Co. in der Lehrkräftebildung
Abstract
Am Institut für Didaktik der Mathematik an der Justus-Liebig-Universität in Gießen wird seit dem Wintersemester 2023/24 schulKI zur Vertiefung mathematischer Inhalte genutzt. Im Beitrag werden nach einer kurzen Verortung die Zielsetzung und Gestaltung des Wahlpflichtangebotes erläutert, Themen daraus präsentiert und Aspekte aus der Gruppendiskussion aufgegriffen. So soll eine Möglichkeit der Verwendung von KI im Studium von angehenden Grundschullehrkräften aufgezeigt werden.
Erste Seite: 19
Letzte Seite: 28
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959873468.0.03
=====================================================
Matthias Knippers: Erklärvideonutzung beim universitären Mathematiklernen
Abstract
Lernen für fachmathematische Veranstaltungen an der Universität kann auf verschiedene Arten stattfinden. Eine Möglichkeit ist es, mithilfe mathematischer Erklärvideos Inhalte vor- oder nachzubereiten. Im Rahmen einer (fachmathematischen) Masterveranstaltung für angehende Primarlehrkräfte wurde im Wintersemester 2023/24 an der Universität Bielefeld mit einem Mixed-Methods-Ansatz exploriert, von welchen Faktoren die Videonutzung der Studierenden abhängt. Über Tagebucheinträge und Folgeinterviews wurden die Nutzungsdaten und -gründe der Studierenden erhoben. Im Beitrag wird diskutiert, inwiefern mathematikspezifische Gründe bei der Videoauswahl durch Lernende angegeben werden.
Erste Seite: 29
Letzte Seite: 46
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959873468.0.04
=====================================================
Nina Köhne: Wie agiert digitales Handlungsmaterial? Zum Umgang von Erstklässler*innen mit der App Rechenfeld aus interaktionsanalytischer Perspektive
Abstract
Digitales Handlungsmaterial unterscheidet sich wesentlich von analogem. In der Folge verläuft auch die Interaktion und das Lernen damit anders. In diesem Beitrag werden erste Ergebnisse einer Studie dargestellt, in der untersucht wird, welche Muster sich in der Interaktion zwischen Erstklässler*innen und der App Rechenfeld zeigen. Auf Grundlage des Objekt-integrierenden Ansatzes nach Fetzer konnte ein bis dato nicht beschriebenes Interaktionsmuster rekonstruiert werden, in dem digitales Handlungsmaterial eine neue und fachdidaktisch relevante Rolle einnimmt.
Erste Seite: 47
Letzte Seite: 62
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959873468.0.05
=====================================================
Marie Eckhardt & Felicitas Pielsticker: Förderung mathematischer Denktypen durch KI? – Eine Fallstudie zum Einsatz von LLMs am Beispiel von ChatGPT
Abstract
Dieser Beitrag beschreibt in einer qualitativen Fallstudie den Einsatz von LLMs (Large Language Models) als eine mögliche Anwendung zur Förderung zweier Denktypen. Wir untersuchen, inwiefern der eingesetzte Chatbot, ChatGPT, zur Aktivierung eines prädikativen und eines funktionalen Denktyps verwendet wer-den kann. Dazu werden Custom-GPTs erstellt, für einen Diagnose- und Förder-prozess mit Lernenden aus einer achten Klasse (13-14 Jahre) nutzbar gemacht und Chatprotokolle sowie Interviews analysiert.
Erste Seite: 63
Letzte Seite: 82
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959873468.0.06
=====================================================
Melanie Platz: Design Science Research zur Entwicklung eines Seminars zu Suchmaschinen und KI im Mathematikunterricht der Primarstufe
Abstract
Suchmaschinen sind eine wichtige Komponente für die Teilhabe am (nicht nur digitalen) Leben. Jedoch führt die Intransparenz der Algorithmen populärer Plattformen zu einer zunehmenden Unmündigkeit im Nutzungsverhalten. Dieser Effekt wird durch KI-Chatbots verstärkt. Der Entwicklungsstand eines Seminars, das Primarstufenlehramtsstudierende auf den Einbezug der Themen Internetsuche und KI in ihren zukünftigen Mathematikunterricht vorbereitet, wird vorgestellt.
Erste Seite: 83
Letzte Seite: 98
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959873468.0.07
=====================================================
Lisa Rühl & Daniel Thurm: Adaptive Unterstützung bei problemhaltigen Aufgaben durch LLM-basierte Assistenten im Kontext von digitalen Escape Games
Abstract
Digitale Escape Games im Mathematikunterricht bieten das Potenzial, mathematische Kompetenzen wie Problemlösen und Kommunizieren zu fördern. Oft stoßen Schüler:innen jedoch bei problemhaltigen Aufgaben auf Hindernisse, die sie nicht ohne Hilfe überwinden können. Dieser Beitrag skizziert ein Design-Based Research Vorhaben zur Entwicklung von LLM-basierten Assistenten zur Unterstützung in solchen Situationen. Im Beitrag werden theoriebasierte Designprinzipien und erste Ergebnisse aus einer Pilotierung vorgestellt.
Erste Seite: 99
Letzte Seite: 114
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959873468.0.08
=====================================================
Simon Wagener: Entwicklung eines AG-Konzepts zur Förderung von Problem-Posing beim Erstellen digitaler mathematischer Exit-Games
Abstract
Problem-Posing ist ein Forschungsfeld, das mittlerweile mehr Prominenz erfährt, jedoch im schulischen Alltag kaum untersucht wurde. Um dies zu ändern, wurde ein AG-Konzept für Schülerinnen und Schüler der Klassen 8/9 entwickelt, in dem sie Exit-Games erstellen. Die dabei entstehenden Problem-Posing-Aktivitäten werden videografiert und analysiert. Ziel ist es, Einblicke in die Problem-Posing-Prozesse der Lernenden zu bekommen und deren Relevanz für den Unterricht zu erforschen.
Erste Seite: 115
Letzte Seite: 126
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959873468.0.09
=====================================================
Hans-Georg Weigand: Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Und wie ist das mit ChatGPT beim Lehren und Lernen von Mathematik im digitalen Zeitalter?
Abstract
Was wissen wir (heute) über den Einsatz digitaler Medien um Mathematikunterricht? Welche zukünftigen Entwicklungen lassen sich daraus ableiten? Und welche Möglichkeiten werden sich durch digitale Technologien, Medien oder Werkzeuge wie Augmented Reality, Virtuelle Realität und ChatGPT ergeben? In dem Beitrag sollen einige dieser Entwicklungen – gemäß dem Tagungsthema – vor allem unter dem Gesichtspunkt der Vernetzung diskutiert werden.
Erste Seite: 127
Letzte Seite: 142
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959873468.0.10