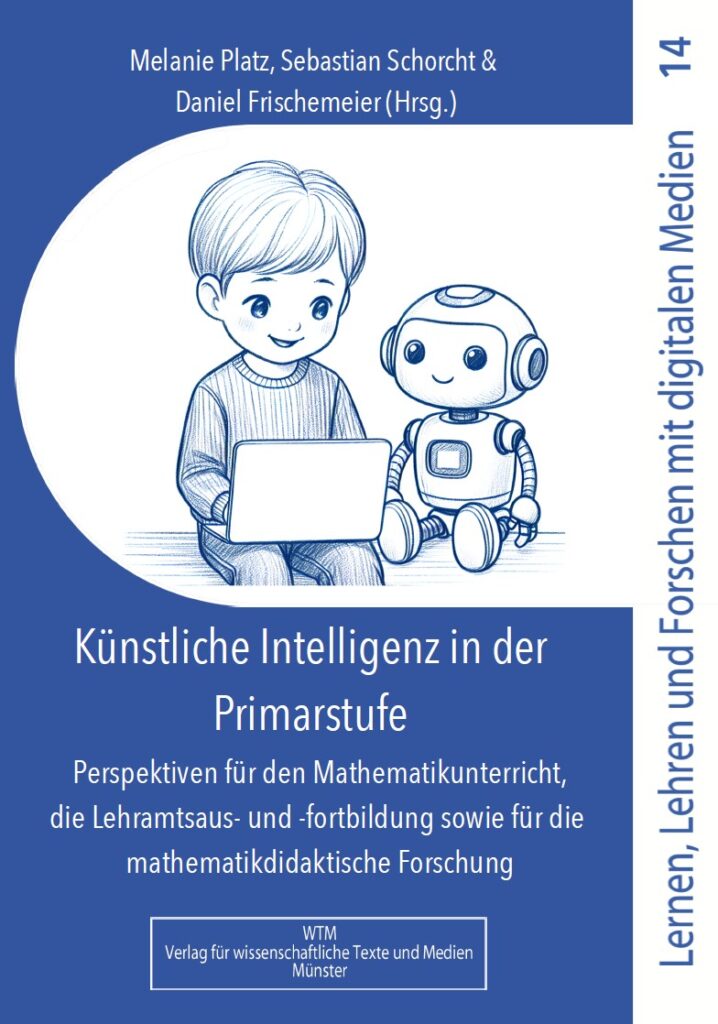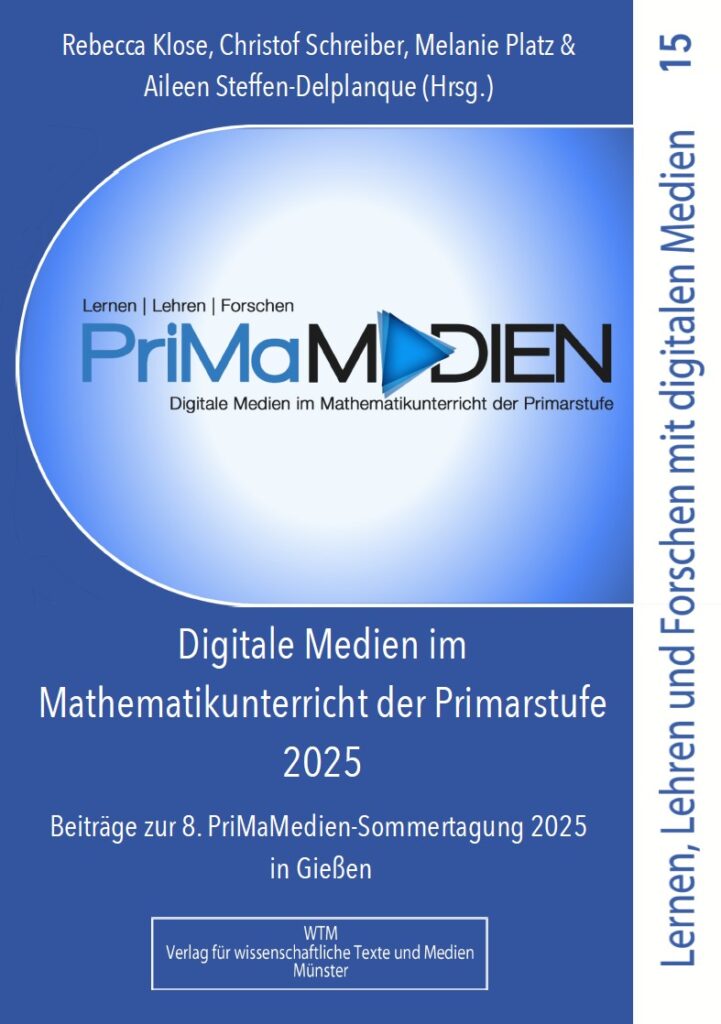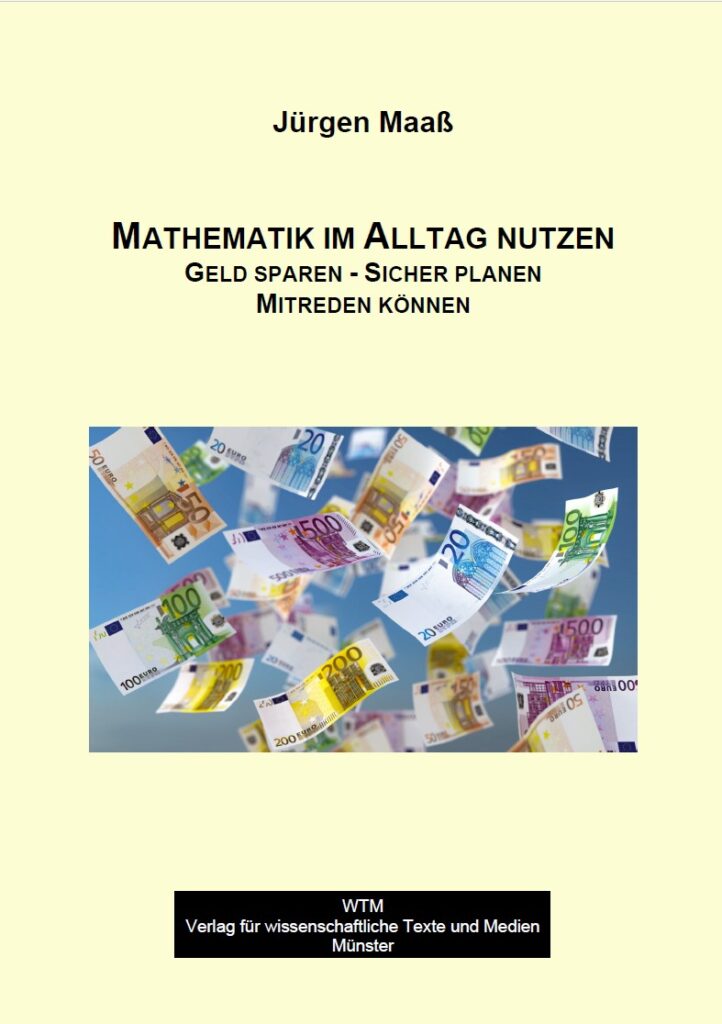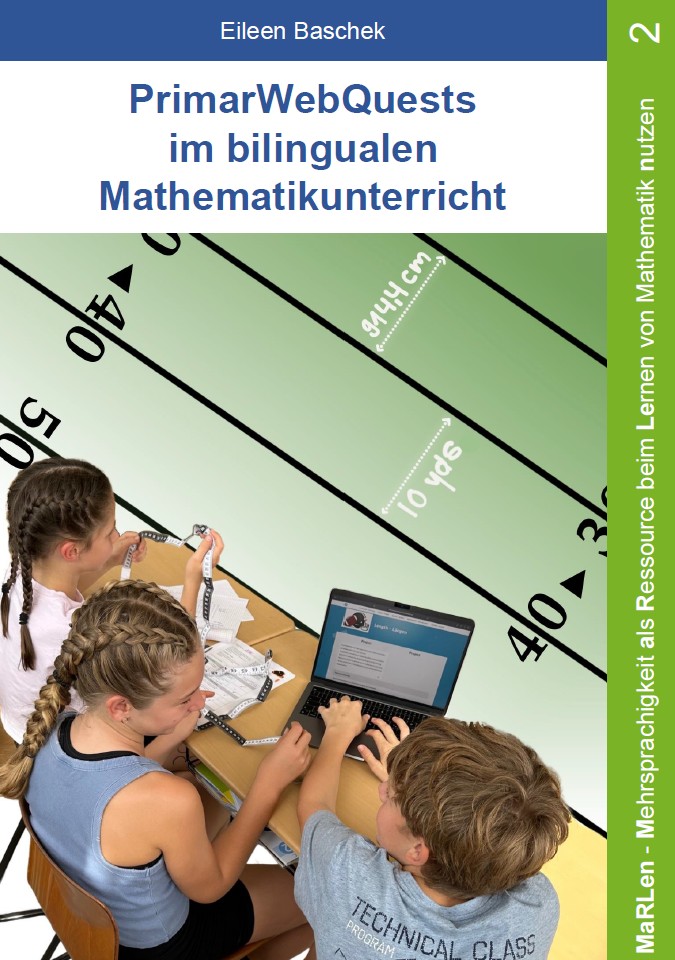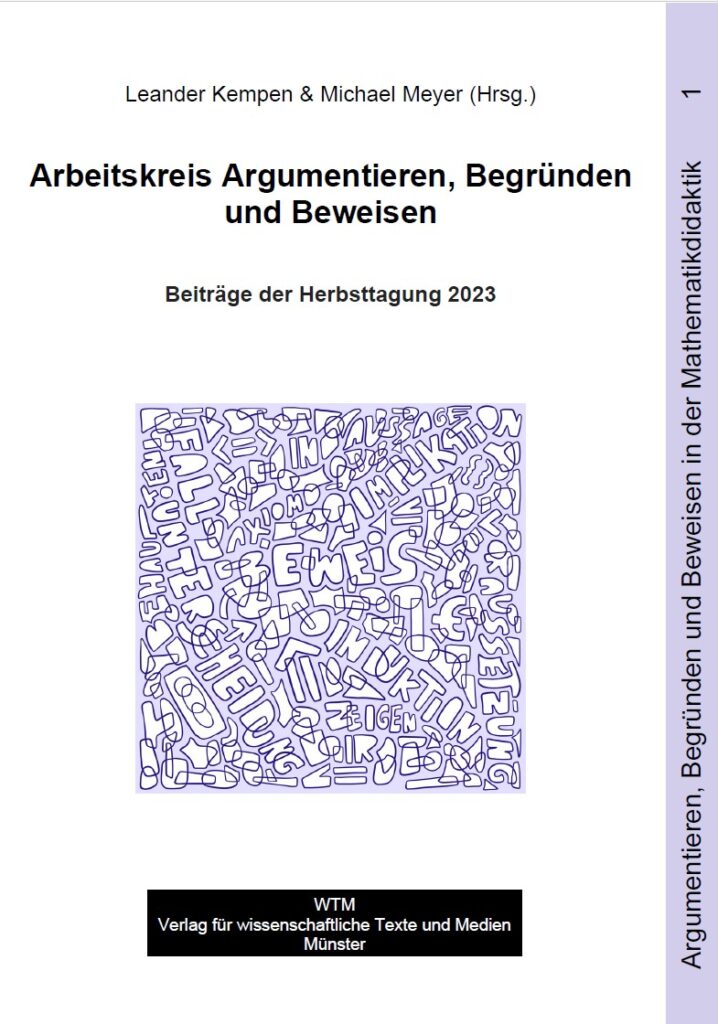Tagungsband zur Vernetzungstagung 2023 in Siegen
Tagungsband zur Vernetzungstagung 2023 in Siegen
Vol. 4 of the series Reihe Mathematiklernen mit digitalen Medien
Münster: WTM-Verlag 2024
Ca. 410 S., s/w, DIN A5
978-3-95987-293-5 – Print 49,90 €
978-3-95987-294-2 – E-Book Open Access
https://doi.org/10.37626/GA9783959872942.0
The printed book can be ordered HERE
The E-Book is Open Access under Creative Commons licence and can be downloaded HERE

Documentation of Review-Process
- What – What is being reviewed? All papers in the book
- Who – Who conducts the peer review? 2 external peer reviewers
- How – What is the level of anonymity? All identities known
- When – At what stage is the peer review being conducted? Pre-publication
- Peer review is overseen by: member of the editorial board of the edited book
Abstract
Die Digitalisierung im Mathematikunterricht bietet sowohl Potenziale als auch Herausforderungen für das Lehren und Lernen. Die Bandbreite der verwendeten digitalen Medien und Werkzeugen ist dabei in den letzten Jahren extrem gewachsen und geht von 3D-Druckern über Lego-Roboter bis hin zu Erklärvideos. Bei der zweiten Vernetzungstagung zum Thema „Mathematikunterricht mit digitalen Medien und Werkzeugen in Schule und Forschung“ kamen im Mai 2023 in Siegen viele Wissenschaftler:innen und Schulpraktiker:innen zusammen, um aktuelle Themen im Bereich der Digitalisierung zu diskutieren. Das Programm war durch Vorträge, Workshops, Posterpräsentationen und Diskussionsrunden strukturiert.
Der vorliegende Band stellt in 28 Beiträgen wesentliche Ergebnisse der Tagung vor. Dabei handelt es sich um eine Zusammenstellung aus unterrichtspraktischen Beiträgen, in welchen konkrete Lernumgebungen vorgestellt werden, und wissenschaftlichen Beiträgen, die empirische Studien aufzeigen und Metathemen in den Blick nehmen. Ebenso lässt sich eine große Vielfalt von unterschiedlichen Medienarten identifizieren, die in den Beiträgen betrachtet werden. In seiner Gesamtheit bildet der Tagungsband somit eine gute Basis für die weitere Entwicklung des Themas.
BEITRÄGE
=====================================================
Simon Barlovits & Matthias Ludwig: Mathematikunterricht im Freien: Zur Motivation von Lernenden bei der Bearbeitung von MathCityMap-Mathtrails
Abstract
Mathematikunterricht kann ins Freie verlagert werden: Bei sogenannten Mathtrails bearbeiten die Lernenden draußen – unterstützt durch die MathCityMap-App – mathematische Aufgaben zu real existierenden Objekten. Im Beitrag wird die Motivation von Lernenden bei einer Mathtrail-Bearbeitung untersucht. Es zeigt sich, dass die Motivation von der Bearbeitungsdauer einer Aufgabe, dem Bearbeitungserfolg sowie der Motivation im Mathematikunterricht abhängt.
Erste Seite: 1
Letzte Seite: 16
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872942.0.01
=====================================================
Sofia Bielinski, Niklas Peters & Susanne Prediger: Digital gestützte Lernpfade hin zum verständigen Umgang mit Gewichten – Design der divomath-Unterrichtsbausteine
Abstract
Lernen komplexer Inhalte vollzieht sich in mehreren Lernstufen, die in einem Lernpfad angeordnet und aufeinander bezogen werden. In divomath werden digitale Werkzeuge daher systematisch eingebunden in ein umfassendes Unterrichtskonzept mit Aufgabenserien entlang eines Lernpfads. Der Beitrag zeigt am Thema Gewichte, wie Lernpfade über Bausteine hinweg mit zentralen Prinzipien Verstehensorientierung und Kommunikationsförderung ausgestaltet werden können.
Erste Seite: 17
Letzte Seite: 31
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872942.0.02
=====================================================
Marco Böhm & Ralf Holzmann: Werkzeugkompetenzen von Lehramtsstudierenden im Bereich elementarer Funktionen – Konzeption eines Tests zu den Bedien- und Auswahlkompetenzen bezüglich GeoGebra und Tabellenkalkulation
Abstract
Digitale Technologien bieten für die Unterrichtsgestaltung vielfältige Möglichkeiten, aber gleichsam auch Herausforderungen für Mathematiklehrkräfte. Der vorliegende Beitrag beschreibt die Testentwicklung zur Messung der Werkzeugkompetenz von Lehramtsstudierenden, bezogen auf Tabellenkalkulation und GeoGebra im Bereich elementarer Funktionen. Darüber hinaus werden Ergebnisse des Testeinsatzes über fünf Semester von zwei Interventionsgruppen vorgestellt.
Erste Seite: 33
Letzte Seite: 48
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872942.0.03
=====================================================
Frederik Dilling, Kathrin Holten, Kevin Hörnberger, Rebecca Schneider & Ingo Witzke: Entwicklung einer Fortbildungsstruktur zum Einsatz digitaler Medien im Mathematikunterricht – ein Werkstattbericht
Abstract: Der vorliegende Werkstattbericht stellt die Fortbildungsstruktur im Projekt DigiMath4Edu zum Einsatz digitaler Medien im Mathematikunterricht dar. Diese basiert auf zwei Säulen: Die erste Säule beinhaltet verschiedene Formate an Fortbildungsveranstaltungen von einer Fortbildungsreihe, über zentrale Fortbildungstage bis hin zu Miniworkshops an Schulen. In der zweiten Säule findet eine von Lehrer:innen durchgeführte und von Student:innen begleitete Erprobung der Medien im Unterricht statt.
Erste Seite: 49
Letzte Seite: 60
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872942.0.04
=====================================================
Frederik Dilling & Marc Hermann: Digitale Medien in aktuellen Mathematikschulbüchern – Erste Ergebnisse einer Untersuchung in den Jahrgangsstufen 5-9
Abstract
Schulbücher gelten häufig als eine Art Leitmedium im Unterricht, welche die behandelten Themen und genutzten Herangehensweisen maßgeblich mitbestimmen. Aus diesem Grund ist auch zu vermuten, dass die Möglichkeiten zur Nutzung digitaler Medien im Mathematikunterricht ebenfalls durch die verwendeten Schulbücher beeinflusst werden. In der in diesem Artikel dargestellten Untersuchung werden daher die Verweise auf digitale Medien in Mathematikschulbüchern der Jahrgansstufen 5-9 betrachtet. Erste Ergebnisse zeigen insgesamt wenige Verweise auf digitale Medien und deutliche Unterschiede in den Verweisen zwischen verschiedenen Medien und in den verschiedenen Jahrgangsstufen.
Erste Seite: 61
Letzte Seite: 72
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872942.0.05
=====================================================
Hans-Jürgen Elschenbroich: Kegelschnitte erkunden – genetisch, ganzheitlich, dynamisch, anschaulich
Abstract
Kegelschnitte sind ein enorm reichhaltiges Thema, aber dennoch weitgehend aus dem Kanon der Schulmathematik verschwunden. Hier wird mit dem digitalen Werkzeug GeoGebra 3D ein ganzheitlicher und genetischer Weg vorgeschlagen, zum einen die vielfältigen Aspekte zu verbinden und zum anderen mit Hilfe der Prinzipien systematische Variation und dynamische Visualisierung zumindest in Ansätzen spiralig unterrichtbar zu machen.
Erste Seite: 73
Letzte Seite: 83
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872942.0.06
=====================================================
Corinna Hankeln, Ulf Kroehne, Sebastian Groß, Lea Voss & Susanne Prediger: User-Experience-Design und Instruktionen für Lernende und Lehrkräfte in digitalen formativen Assessments
Abstract
Immer wenn Lernende digitale Tests bearbeiten, muss sichergestellt werden, dass die eigentlichen Diagnosen nicht von Bedienproblemen verdeckt werden. Auch müssen Lehrkräfte digitale Assessments durchführen und auswerten können. Der Beitrag beleuchtet unter Einbezug theoretischer Ansätze zum Cognitive Load als auch Prinzipien des UX Designs, ein Konzept, wie im Online-Check (Mathe sicher können) bei Lernenden und Lehrkräften die Bedienprobleme reduziert werden.
Erste Seite: 85
Letzte Seite: 101
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872942.0.07
=====================================================
Kevin Hörnberger & Julian Plack: Mit LEGO-Robotern durch die Schulzeit – Ein Einblick in die Verbindung von Mathematik und Informatik, mit möglichen Beispielen für den Alltagsunterricht
Abstract
Lehrer:innen sind immer auf der Suche nach alltagsrelevanten Beispielen für den Mathematikunterricht. Dieser Beitrag soll einen Einblick in die Möglichkeiten geben, die man durch den Einsatz von LEGO-Robotern für einen empirisch-orientierten Mathematikunterricht (Pielsticker, 2020) erhält. Die Einsatzmöglichkeiten erstrecken sich von der Grundschule bis zum Abitur und zeigen fächerübergreifende Elemente hinsichtlich Mathematik und Informatik auf.
Erste Seite: 103
Letzte Seite: 112
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872942.0.08
=====================================================
Kevin Hörnberger, Jasmin Müller, Tatjana Visarius, Insa Germer & Rebekka Post: Auffassungen von Lernenden und Lehrenden in NRW zu CAS-Apps als Alternative zu klassischen Handhelds am Beispiel der Apps CASeasy+
Abstract
Das Ende des grafikfähigen Taschenrechners (GTR) als notwendiges Hilfsmittel für die Abiturklausuren in Nordrhein-Westfalen zum Abiturjahrgang 2026 stellt viele Schulen vor die Herausforderung, ein neues Werkzeug für den alltäglichen Gebrauch im Mathematikunterricht der Sekundarstufe II auszuwählen. Dabei stellen, neben dem wissenschaftlichen Taschenrechner (WTR) und modularen Mathematiksystemen (MMS), insbesondere Computeralgebrasysteme (CAS) in Form von Apps eine Alternative zum GTR dar. Im Rahmen einer explorativen Studie innerhalb des Südwestfalen Regionale 2025 Projekts DigiMath4Edu der Mathematikdidaktik der Universität Siegen wurden 252 Schüler:innen aus der Sekundarstufe II und 15 Lehrkräfte von fünf Schulen aus den Kreisen Olpe und Siegen-Wittgenstein in einem Mixed-Method-Design zu ihren Auffassungen zu CAS-Apps beforscht. In diesem Beitrag möchten wir einen Einblick in die ersten Forschungsergebnisse geben und Aussagen von Studierenden aus einem Besser Studieren!-Projekt zu dem perspektivischen Taschenrechnereinsatz vorstellen.
Erste Seite: 113
Letzte Seite: 127
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872942.0.09
=====================================================
Melanie Huth, Jasmin Pollok & Christof Schreiber: Unterrichtsintegrierte Förderangebote der Digitalen Drehtür Hessen im Fach Mathematik
Abstract
Eine unterrichtsintegrierte Förderung für mathematisch interessierte Lernende ist für Lehrkräfte oft herausfordernd im Schulalltag. Die Digitale Drehtür Hessen stellt dafür digitale Lernprogramme für Primar- und Sekundarstufe (Jg. 3 bis 10) bereit. Angelehnt an Renzulli et al. (1981) bearbeiten Lernende projektorientiert mathematische Themen parallel zum Unterricht und kehren dann in den Klassenverband zurück. Im Beitrag wird das Konzept im Fach Mathematik vorgestellt.
Erste Seite: 129
Letzte Seite: 144
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872942.0.10
=====================================================
Marcel Klinger: Algorithmisches Denken im Mathematikunterricht fördern: Ein Praxisbeitrag aus der Lehramtsausbildung Mathematik
Abstract
Die Lehrveranstaltung „Algorithmische Mathematik“ an der Universität Duisburg-Essen hat das Ziel, Studierende dazu zu befähigen, den eigenen Mathematikunterricht algorithmisch-gehaltvoll zu gestalten. Hierzu werden mathematische Algorithmen verschiedener mathematischer Teildisziplinen thematisiert und mithilfe einer blockbasierten Programmiersprache auch praktisch erschlossen. Der vorliegende Beitrag beschreibt die Konzeption des Lehrformats und hält die bei mehrmaliger Durchführung gewonnenen praktischen Erfahrungen fest.
Erste Seite: 145
Letzte Seite: 156
https://doi.org/10.37626/GA9783959872942.0.11
=====================================================
Matthias Knippers: Auswahl und Nutzung von Erklärvideos im Mathematikunterricht – eine Annäherung aus verschiedenen Perspektiven der Praxis und der Theorie
Abstract
In der aktuellen (deutschen) empirische Unterrichtsforschung zeigt sich ein breites Bild an Einsatzmöglichkeiten von Erklärvideos. Unklar bleibt: Welche Kriterien für eine sinnvolle Erklärvideonutzung gibt es? Was muss jemand tun, um ein mathematisches Erklärvideo passend zu den eigenen Bedürfnissen auszuwählen? Fokussiert wird in diesem Beitrag auf die Nutzung von Erklärvideos durch Lernende selbst im Zeitraum einer Klassenarbeit. Unter Beachtung von Häufigkeit und Selbstbestimmtheit der Nutzung sollen Nutzungsmuster exploriert werden.
Erste Seite: 157
Letzte Seite: 173
https://doi.org/10.37626/GA9783959872942.0.12
=====================================================
Jenny Knöppel, Felicitas Pielsticker: „Ich hab wieder gezählt“ – Eine Fallstudie zur Untersuchung der Zähl- und Bündelungsstrategien einer Grundschülerin mit Rechenschwierigkeiten
Abstract
In diesem Beitrag werden die Zähl- und Bündelungsstrategien einer Schülerin mit Rechenschwierigkeiten bei der Anzahlerfassung einer Punktemenge untersucht. Es stellt sich heraus, dass sie auch bei kleinen Mengen die Anzahl häufig zählend ermittelt. Da die Schülerin im Rahmen der „Diagnose-Sprechstunde“ über einen längeren Zeitraum begleitet wird, besteht die Möglichkeit, Entwicklungen in diesem Bereich (u. a. auch mit Hilfe der Eye-Tracking-Technologie) zu beschreiben.
Erste Seite: 175
Letzte Seite: 191
https://doi.org/10.37626/GA9783959872942.0.13
=====================================================
Jacqueline Köster, Felicitas Pielsticker & Jonalyn Margaux Smith: Problemlösungsprozesse in homogenen und heterogenen Gruppen unter Nutzung eines CAD-Programms – Eine Fallstudie im außerschulischen MINT-Projekt „MINT ins Land“
Abstract
CAD-Software hat in unserem (Mathematik-)Unterricht an einigen Stellen bereits Einzug gehalten. Dabei unterscheidet sich die Nutzung von digitalen Werkzeugen wie einem CAD-Programm für unterschiedliche Bediener*innen. In dieser Fallstudie wird daher untersucht, wie sich hinsichtlich einer Nutzung und der Bedeutung für den individuellen mathematischen Wissensaufbau Unterschiede zwischen den Geschlechtern ergeben können.
Erste Seite: 193
Letzte Seite: 208
https://doi.org/10.37626/GA9783959872942.0.14
=====================================================
Sabine Kowalk, Ute Sproesser & Kerstin Frey: Förderung des Funktionalen Denkens durch digital-gestützte Lernumgebungen und Embodiment
Abstract
Digitale Technologien für den Mathematikunterricht entwickeln sich schnell und verändern das Lehren und Lernen von Mathematik. Beim Umgang mit Funktionen können digitale Werkzeuge den Erwerb konzeptuellen Wissens begünstigen und in Kombination mit Embodiment die Interaktionsmöglichkeiten beim „Begreifen“ mathematischer Konzepte unterstützen. Vor diesem Hintergrund wurden im Projekt „LernelF“ digital gestützte Lernumgebungen unter Einbezug des Embodiments zur Förderung Funktionalen Denkens entwickelt. Im Beitrag wird die digital-gestützte Lernumgebung „Graphen gehen digital“ im Kontext von Embodiment vorgestellt. Die dazugehörige Forschung wird als Ausblick skizziert.
Erste Seite: 209
Letzte Seite: 220
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872942.0.15
=====================================================
Sabine Kowalk & Ute Sproesser: Förderung digitaler Lehrkompetenz im Projekt 4 digit.L
Abstract
Die Digitalisierung erweitert zweifelsohne die Möglichkeiten guten Mathematik-unterricht digital-gestützt umzusetzen. Um diese Möglichkeiten in der Schule zu nutzen, braucht es jedoch engagierte Lehrkräfte, die im Rahmen von Aus- und Weiterbildung fachdidaktische Potenziale digitaler Werkzeuge diskutieren und dabei ihre professionellen Wissensbestände um technologiebezogene Aspekte erweitern, mit dem Ziel, digitale Werkzeuge gewinnbringend in den Unterreicht zu integrieren. Im Beitrag werden Potenziale digitaler Werkzeuge am Beispiel dynamischer Visualisierungen mathematischer Zusammenhänge beleuchtet, sowie Möglichkeiten berufsbegleitender Fortbildungsmaßnahmen zur Entfaltung professioneller Kompetenzen von Lehrkräften zum Einsatz digitaler Werkzeuge im Mathematikunterricht (digitale Lehrkompetenz) in den Blick genommen. Darauf aufbauend wird das Fortbildungsprojekt „4 digit.L“ zur Förderung digitaler Lehrkompetenz vorgestellt.
Erste Seite: 221
Letzte Seite: 234
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872942.0.16
=====================================================
Tim Läufer, Simone Jablonski & Matthias Ludwig: Erstelle deinen Messeturm! – Modellierungsprozesse von Schüler*innen mit 3D-Druck-Technologie
Abstract
Einzigartige Bauten finden sich in jeder Stadt und können als Grundlage für realitätsbezogene Mathematikaufgaben dienen. In diesem Beitrag stellen wir vor, wie wir mithilfe von 3D-Druck-Technologie den Frankfurter Messeturm als Ausgangspunkt für einen mathematischen Modellierprozess innerhalb eines Begabtenförderungsprogramms nutzen. Weiterhin zeigen wir die Produkte der Schüler*innen und analysieren deren Modellierungsschritte im Detail. Durch qualitative Analyse der schriftlichen Dokumentationen kann eine Fokussierung auf die Modellierungsschritte „Vereinfachen und Strukturieren“ sowie „Mathematisieren“ beschrieben werden. Dies bestätigt sich auch in der Analyse eines eingesetzten Fragebogens zur Wahrnehmung der Lerneinheit durch die Schüler*innen.
Erste Seite: 235
Letzte Seite: 250
https://doi.org/10.37626/GA9783959872942.0.17
=====================================================
Tim Läufer & Matthias Ludwig: Es zählt der Prozess: Planen, Modellieren, 3D-Drucken und TPACK
Abstract
3D-Druck wird in der Bildung vielversprechend eingesetzt und auch in der Bildungsforschung häufig thematisiert, es fehlt aber (Weiter-)Bildung für Lehrkräfte. Gerade Manipulatives bieten für Lehrkräfte viele reichhaltige Möglichkeiten, die mit dem 3D-Drucker realisiert werden können. Wir stellen in diesem Beitrag unsere Forschungsidee und Methode zur Untersuchung des 3D-Modellierungs- und Druckprozesses zur Erstellung von Manipulatives vor.
Erste Seite: 251
Letzte Seite: 258
https://doi.org/10.37626/GA9783959872942.0.18
=====================================================
Katja Lenz & Tim Lutz: Enaktive Materialhandlungen digital verarbeiten – ein innovativer Ansatz zur Entwicklung des Stellenwertverständnisses
Abstract
Zur Entwicklung eines tragfähigen Stellenwertverständnisses ist es grundlegend Bündelungs- und Entbündelungsprozesse zu verstehen sowie unterschiedliche mathematische Darstellungen zu vernetzen. Für ersteres scheinen enaktive Materialhandlungen unabdingbar, während digitale Anwendungen für letzteres besondere Potenziale bieten. Im vorgestellten Projekt wird eine App entwickelt und evaluiert, die enaktive Materialhandlungen digital verarbeitet und anreichert, um die Potenziale physischer und digitaler Arbeitsmittel zu vereinen.
Erste Seite: 259
Letzte Seite: 271
https://doi.org/10.37626/GA9783959872942.0.19
=====================================================
Corinne Leu, Thomas Schmalfeldt & Andreas Schulz: Förderung konzeptuellen Wissens zu Stellenwertsystemen durch ein intelligentes Tutorsystem in der Lehrpersonenausbildung mehrerer Schulstufen
Abstract
Die hier vorgestellte tutorielle Online-Selbstlernumgebung für angehende Mathematiklehrpersonen fördert konzeptionelles Wissen zu Stellenwertsystemen, indem sie schulstufentypische Lerngelegenheiten mit dazugehörigen Veranschaulichungen thematisiert. Der Beitrag erläutert, wie durch drei Kernprinzipien, (1) Darstellungsvernetzungen mittels (2) der Nutzung ikonischer Tools sowie (3) Transfer und Reflexion, fachliches und fachdidaktisches Wissen verknüpft werden.
Erste Seite: 273
Letzte Seite: 287
https://doi.org/10.37626/GA9783959872942.0.20
=====================================================
Hoang Nguyen: Erlernen der Ableitung über dynamische Visualisierungen per se besser als über statische? – Ergebnisse aus einer Pilotierungsstudie
Abstract
Im Rahmen dieser Studie wurden die Zugänge zur Ableitung über ausschließlich dynamische oder statische Visualisierungen im Zwei-Gruppen Prä-Post-Design mit 110 Lernenden (Klasse 10 bzw. 11) verglichen. Es zeigte sich, dass beide Gruppen im Durchschnitt ihre Leistung verbesserten, jedoch kein signifikanter Interaktionseffekt zwischen der Visualisierungsart und den Messzeitpunkten besteht; auch waren Grundvorstellungen zur Ableitung ähnlich stark ausgeprägt.
Erste Seite: 289
Letzte Seite: 305
https://doi.org/10.37626/GA9783959872942.0.21
=====================================================
Melanie Platz, Christina Bierbrauer, Laura Monz & Moein Alinaghian: Die AR-App „Rechen-StAR“ zur Unterstützung des Zahlverständnisses in der Primarstufe
Abstract
In diesem Beitrag wird die Augmented Reality App „Rechen-StAR“ vorgestellt, die den kardinalen mit dem ordinalen Zahlaspekt verknüpft: Die App überführt die flächige Darstellung einer (An-)Zahl im realen Zwanzigerfeld in eine linear angeordnete Darstellung im virtuellen Zahlenstrahl. So sollen Kinder beim Schritt vom konkreten Handeln zum Operieren in der Vorstellung unterstützt werden. Der Entwicklungsprozess der App sowie technische Hintergründe werden beleuchtet und didaktisch reflektiert.
Erste Seite: 307
Letzte Seite: 318
https://doi.org/10.37626/GA9783959872942.0.22
=====================================================
Anne Rahn: Ein Modell zum Operationsverständnis
Abstract
Ein wesentliches Ziel der Grundschuldidaktik ist die Ausbildung eines konzeptuellen Verständnisses der vier Grundrechenarten. Digitale Medien bieten hierbei neue Möglichkeiten, den individuellen Lernprozess zu unterstützen. Ein theoretisches Modell, das verschiedene Wissensbereiche eines konzeptuellen Operationsverständnisses in Beziehung setzt und gleichzeitig die Möglichkeit bietet, Teilelemente zu fokussieren, kann einen strukturierten Ansatz bieten, um solche digitale Lernumgebungen fachdidaktisch fokussiert zu entwickeln.
Erste Seite: 319
Letzte Seite: 327
https://doi.org/10.37626/GA9783959872942.0.23
=====================================================
Philipp Rüeger, Jessica Kruschwitz & Thomas Schmalfeldt: Individuelle Unterstützung von Primarschulkindern beim Lösen von Zahlenmaueraufgaben mithilfe eines intelligenten Tutors
Abstract
Im vorliegenden Entwicklungsprojekt bearbeiteten Schüler*innen der 2. Primarklasse im Rahmen eines leitfadengestützten Interviews Zahlenmaueraufgaben in einem intelligenten Tutorsystem und wurden gebeten, Rückmeldungen zum Tutor zu geben. Es wurde untersucht, ob die Nutzendenoberfläche, die Rückmeldungen, Hilfestellungen und Symbole umfasste, von den Schüler*innen in der intendierten Weise interpretiert und bedient werden konnte.
Erste Seite: 329
Letzte Seite: 341
https://doi.org/10.37626/GA9783959872942.0.24
=====================================================
Rebecca Schneider, Frederik Dilling, Kathrin Holten & Kevin Hörnberger: Gelingensfaktoren digitaler Transformation im Mathematikunterricht – erste Ergebnisse einer explorativen Studie aus dem Projekt DigiMath4Edu
Abstract
Im Modellprojekt DigiMath4Edu wird die Implementierung digitaler Medien und Werkzeuge in den Mathematikunterricht in Zusammenarbeit mit 15 Schulen aller Schulformen über drei Jahre organisatorisch und wissenschaftlich begleitet. Dabei wird der Frage nachgegangen, welche Faktoren sich beschreiben lassen, die die Einbindung digitaler Medien und Werkzeuge in den Mathematikunterricht fördern können und so zum Gelingen einer Implementierung in den regulären Mathematikunterricht beitragen. In diesem Beitrag werden erste Ergebnisse der explorativen Studie vorgestellt und diskutiert.
Erste Seite: 343
Letzte Seite: 357
https://doi.org/10.37626/GA9783959872942.0.25
=====================================================
Dirk Weber, David Jolitz & Marvin Bader: Einsatz KI-basierter Taschenrechner in der Grundschule – Grundlegende Einordnung und empirische Eindrücke
Abstract
Künstliche Intelligenz (kurz: KI oder AI) erfährt eine beachtliche mediale Aufmerksamkeit, wohingegen sie im Kontext der Grundschule bisher noch wenig rezipiert wird. Der Beitrag widmet sich der grundlegenden Einordnung KI-basierter Taschenrechner im Arithmetikunterricht und diskutiert ausgehend von Eindrücken einer explorativen Studie Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen solcher KI-basierter Werkzeuge im Mathematikunterricht der Primarstufe.
Erste Seite: 359
Letzte Seite: 373
https://doi.org/10.37626/GA9783959872942.0.26
=====================================================
Sina Wetzel & Matthias Ludwig: Möglichst kurz, aber dennoch didaktisch wertvoll – Können mathematische Erklärvideos dem Spannungsfeld beider Ansprüche gerecht werden?
Abstract
In den letzten Jahren sind viele Kriterienkataloge zur Gestaltung „guter“ (mathematischer) Erklärvideos entwickelt worden. Die Fülle an Anforderungen steht jedoch oft im Widerspruch zum Wunsch nach einer möglichst kurzen Videolänge. In diesem Beitrag wird dieses Spannungsfeld aus theoretischer Perspektive und auf Basis exemplarischer empirischer Ergebnisse analysiert, zwei Lösungs-ansätze (Auf- und Unterteilung eines Inhalts) diskutiert und Forschungslücken aufgezeigt.
Erste Seite: 375
Letzte Seite: 391
https://doi.org/10.37626/GA9783959872942.0.27
=====================================================
Mira Wulff & Aiso Heinze: Vorbereitung auf die digitale Arbeitswelt im regulären Mathematikunterricht? Der 3D-Druck als authentischer Lernkontext aus Sicht von Unternehmen
Abstract
Der 3D-Druck gewinnt in der Arbeitswelt zunehmend an Relevanz. Für einen erfolgreichen Übergang in Berufe, die diese Technologie nutzen, sind Informationen über die von Unternehmensseite erwarteten Kenntnisse relevant. In einer Interviewstudie mit 15 Repräsentant:innen verschiedener Branchen wurden Erwartungen zu 3D-Druck-bezogenen Kenntnissen sowie Einbindungsmöglichkeiten in den regulären Fachunterricht herausgearbeitet.
Erste Seite: 393
Letzte Seite: 407
https://doi.org/10.37626/GA9783959872942.0.28