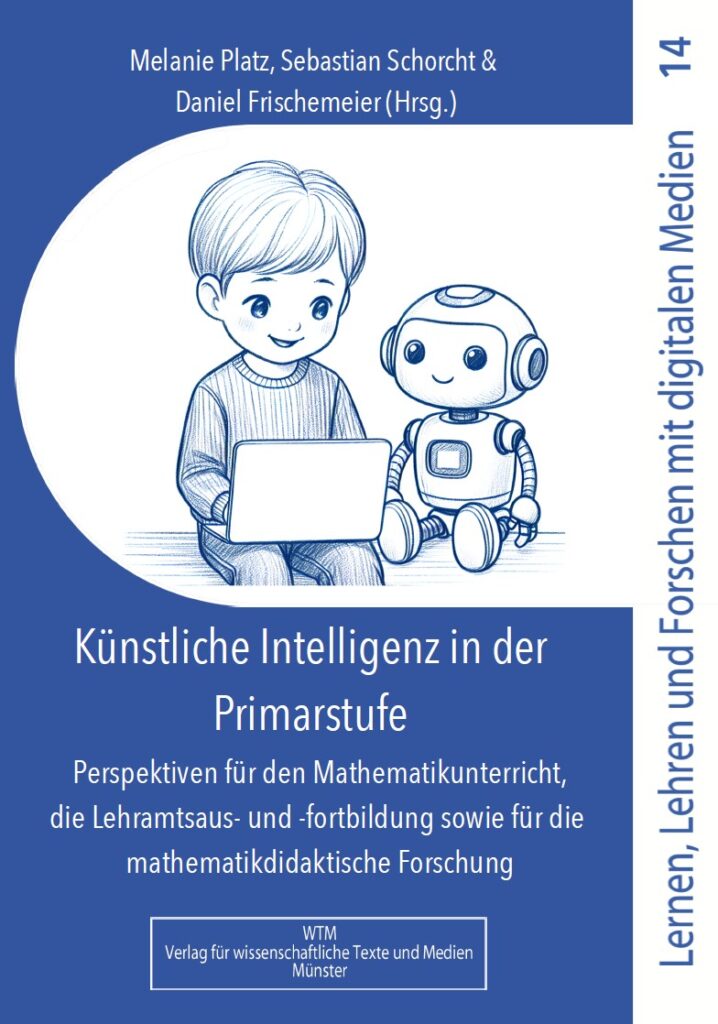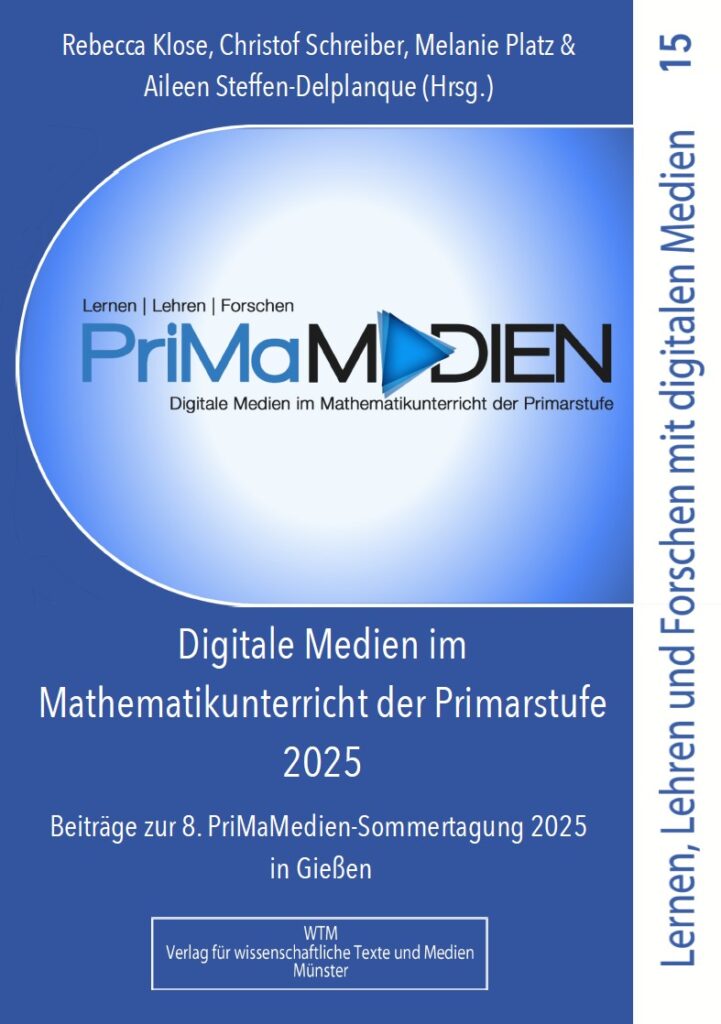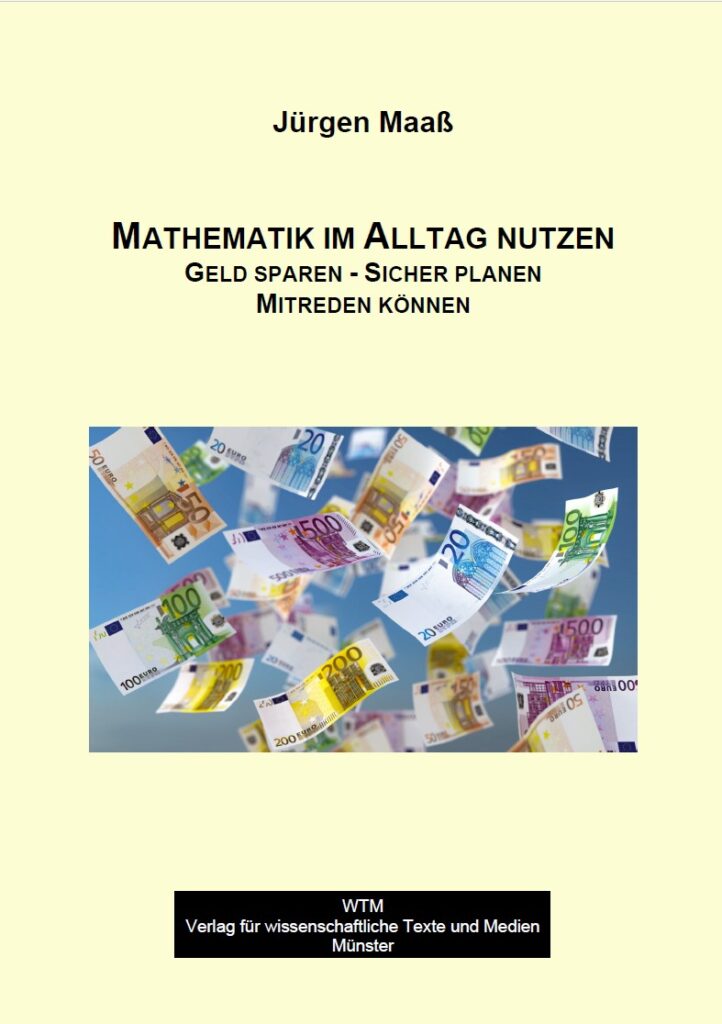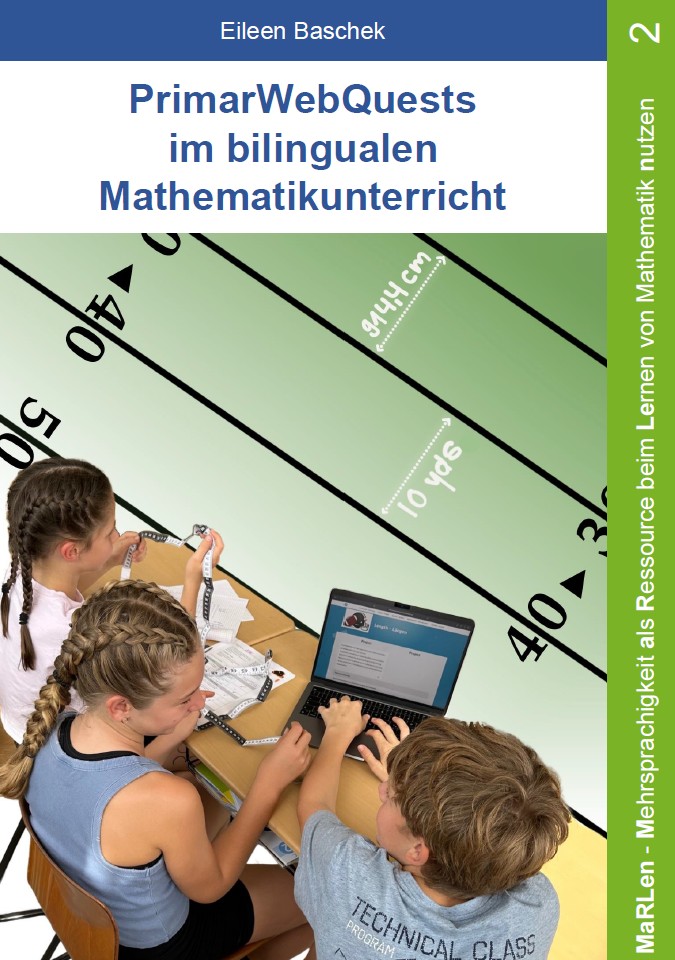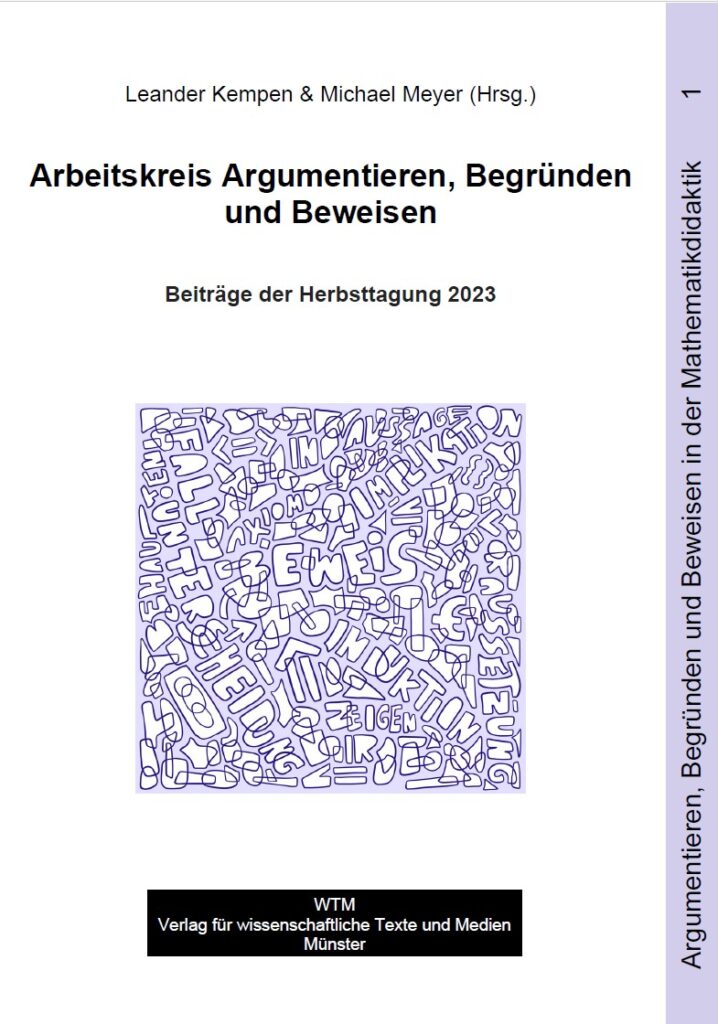Band 3 der Reihe Mathematiklehren und -lernen in Ungarn
Band 3 der Reihe Mathematiklehren und -lernen in Ungarn
Münster 2021, ca. 420 S.
Print: ISBN 978-3-95987-199-0, 49,90 €
Ebook: ISBN 978-3-95987-200-3, 45,90 €
https://doi.org/10.37626/GA9783959872003.0
Für Bestellungen bei edition-buchshop hier klicken
Vorschau
Zur Vorschau klicken sie auf das Bild.
Abstract
Mathematik ist in Ungarn traditionell von hoher kultureller und wissenschaftlicher Bedeutung. Intention der Buchreihe „Mathematiklehren und -lernen in Ungarn“ ist es, die beispielgebende Rolle des Landes und den inspirativen Austausch über Grenzen hinweg zum Ausdruck zu bringen.
Der vorliegende Band enthält – ganz in diesem Sinne – Artikel aus mehreren Ländern. Alle Beiträge beschäftigen sich mit dem geometrischen Denken in der Schulmathematik. Geometrisches Denken ist mit verschiedenen kognitiven Aktivitäten und mentalen Repräsentationen verbunden. Dazu gehören das räumliche Denken und Visualisieren, das Verwenden von Darstellungen (die von handgefertigten Skizzen über Abbildungen mittels dynamischer Geometriesoftware bis zu Anfertigungen von Körpern im 3-D-Druckverfahren reichen), das Bilden von geometrischen Begriffen, das Lösen geometrischer Probleme und das geometrische Argumentieren, Begründen und Beweisen.
Die Beiträge im Buch sind auf das geometrische Denken in der ganzen Breite bezogen und verknüpfen Unterrichts- und Forschungsperspektive. Sie widmen sich dabei einerseits der Gestaltung von Lehr-Lern-Arrangements zur Entwicklung des geometrischen Denkens und andererseits der Erprobung von Forschungskonzepten zur Untersuchung des geometrischen Denkens.
Die Artikel bieten in ihrer Vielfalt ideenreiche Anregungen sowohl für den Mathematikunterricht als auch für die Lehramtsausbildung in Mathematik. Und sie geben der Mathematikdidaktik wichtige Impulse für Forschung und Lehre.
BEITRÄGE
Verfasser*innen: Nele ABELS & Christine KNIPPING
Titel des Beitrags: Reflexion von Skizzen als metakognitive Aktivität beim geometrischen Argumentieren und Beweisen – eine Untersuchung mit Studierenden des Grundschullehramtes
Erste Seite: 11
Letzte Seite: 30
Abstract
Geometrisches Denken ist eng mit Veranschaulichungen und Zeichnungen verbunden. Kaum ein Beweis in der Geometrie lässt sich ohne Zeichnungen verstehen und nachvollziehen. Dennoch ist das Verhältnis von geometrischen Beweisen und geometrischen Darstellungen ambivalent, da Zeichnungen auch in die Irre führen und täuschen können. Wie herausfordernd der Umgang mit Zeichnungen in geometrischen Beweisen für Lehramtsstudierende sein kann und welche Bedeutung dabei metakognitive Aktivitäten haben, wird in diesem Beitrag anhand von empirischen Fallbeispielen dargestellt. Aus diesen Einsichten lassen sich nicht nur Konsequenzen für die Lehramtsausbildung, sondern auch für den Schulunterricht ableiten.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872003.0.01
Verfasser*innen: Csaba CSAPODI
Titel des Beitrags: Geometric proofs in Hungarian teaching practice in grades 9-12
Erste Seite: 31
Letzte Seite: 44
Abstract
The teaching of mathematics has many objectives, among which the teaching of argumentation and proofs plays a prominent role. Unfortunately, in recent years this goal has been overshadowed in the practice in Hungary. In this paper, I am trying to explore the causes of this phenomenon, and I am also presenting the process by which the teaching of proofs in secondary school may regain its former weight and importance. I present the phenomena examined primarily through geometric argumentation and proofs. The main subjects of my examination are curricula, textbooks and final exam requirements, as they work together on the practice in the classroom.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872003.0.02
Verfasser*innen: Ervin DEÁK
Titel des Beitrags: Rund um die von Aristoteles übermittelte Idee eines synthetisch-geometrischen Begriffs der Streckenverhältnisgleichheit
Erste Seite: 45
Letzte Seite: 70
Abstract
Der geschichtliche und gedankliche Ausgangspunkt unserer Überlegungen ist die erschütternde Erkenntnis der griechischen Mathematik (im 6. Jahrhundert v. Chr., im Kreis der Pythagoräer), dass es inkommensurable Streckenpaare gibt. Es musste schockierend wirken, dass dadurch eine hochwichtige, vermeintlich allgemein gültige Grundlage der Mathematik in Frage gestellt wurde, nämlich der „einfache“ Streckenverhältnisgleich¬heits-Begriff und die darauf fußende Proportionenlehre. Wir untersuchen in diesem Kontext eine von Aristoteles übermittelte Alternative zum Grundbegriff und die damit verbundenen wichtigen Algorithmen und Strukturen.
Dieser Beitrag soll zur Erweiterung des mathematischen Hintergrundwissens von Mathematik¬lehrkräften dienen.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872003.0.03
Verfasser*innen: Katalin FRIED, Judit TÖRÖK & Éva VÁSÁRHELYI
Titel des Beitrags: Schnittstellen im Unterricht der Geometrie und anderer Gebiete der Mathematik
Erste Seite: 71
Letzte Seite: 92
Abstract
In vielen Ländern wird Geometrie immer noch als separates Kapitel der Mathematik mit einem separaten Schulbuch unterrichtet. Das Hauptmerkmal des Geometrieunterrichts in Ungarn ist jedoch, dass Geometrie in die Mathematik integriert ist. Wir veranschaulichen anhand einiger Beispiele, wie angehende Lehrerinnen und Lehrer auf diese Aufgabe vorbereitet werden können, und diskutieren den theoretischen Hintergrund dieser Beispiele.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872003.0.04
Verfasser*innen: Karl Josef FUCHS & Ján GUNČAGA
Titel des Beitrags: Der Beitrag des Computers zur Begriffsbildung in der Geometrie
Erste Seite: 93
Letzte Seite: 104
Abstract
Der Artikel greift auf die Rahmenkonzepte des Prinzips Operativer Begriffsbildung (POB) sowie des Threshold Concepts (TC = Schwellenkonzepte) bei der Bildung von Begriffen aus der Geometrie zurück. Die beiden Rahmenkonzepte werden zudem durch den Beitrag des Computers zur Bildung von Begriffen in der Geometrie ergänzt. Prototypische Beispiele unterschiedlicher Komplexität illustrieren den praktischen Computereinsatz.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872003.0.05
Verfasser*innen: Stefan GÖTZ
Titel des Beitrags: Die uvw-Sprache in der Analytischen Geometrie
Erste Seite: 105
Letzte Seite: 118
Abstract
Beim Kapitel „Analytische Geometrie“ in der Sekundarstufe II werden oft abstrakte Problemstellungen ohne weiterführenden Kontext in den Blick genommen. Auf diese Weise kann die eigentliche Kraft der algebraischen Beschreibung von geometrischen Situationen den Schülerinnen und Schülern kaum vermittelt werden. Im Beitrag werden (zum Teil wohlbekannte) Fragestellungen aus der ebenen Dreiecksgeometrie präsentiert, die die Schülerinnen und Schüler zum (auch eigenständigen) Begründen mit Mitteln der Analytischen Geometrie anregen sollen. Eine standardisierte Lage eines allgemeinen Dreiecks im Koordinatensystem erweist sich dabei als fruchtbarer Ausgangspunkt für den Einsatz von Standardmethoden (!) der Analytischen Geometrie im Mathematikunterricht.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872003.0.06
Verfasser*innen: Zsuzsanna JÁNVÁRI
Titel des Beitrags: Die Welt der Polyominos in den oberen Klassen der Grundschule – vom Spiel bis zur Forschung
Erste Seite: 119
Letzte Seite: 132
Abstract
In diesem Artikel möchte ich eine erweiterte Anwendung von Polyominos vorstellen. Kompetenzentwicklung, Talentförderung und Neugestaltung haben in Ungarn eine lange Tradition. Eines der bekanntesten Beispiele für all dies ist die Einführung von Pentominos und ihre Verwendung, um ebene geometrische und zugehörige kombinatorische Probleme und Aufgaben zu lösen. Der Grund für die Erweiterung des Anwendungsbereichs besteht darin, 10-, 12- und 14-jährige Kinder in den oberen Grundschulklassen auf eine typische Aufgabe in der verbindlichen zentralen Aufnahmeprüfung vorzubereiten. Die Unterrichtseinheit, die in einer Unterrichtsstunde durchgeführt werden kann, bietet auf spielerische Weise die Möglichkeit, räumliches Sehen und Denken zu entwickeln.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872003.0.07
Verfasser*innen: Tünde KÁNTOR
Titel des Beitrags: Mosaike, um das Geometrielernen bunter zu machen
Erste Seite: 133
Letzte Seite: 152
Abstract
In diesem Artikel werde ich einige Ergebnisse meiner jahrzehntelangen empirischen Forschung zum Lehren und Lernen von Geometrie vorstellen. Unser Hauptziel war es, einen Lehrstoff zu erstellen, der zum Problemlösen und zu heuristischen Strategien sowie zum Nationalen Kerncurriculum passt. Wir wollten optimale Gelegenheiten für die Motivation bieten (Möbiusband, Papierfalten, geometrischer Nachweis algebraischer Identitäten, Beweis des Satzes von Pythagoras, Konstruktion von Körpern aus ihrem Netz). Um unser Ziel zu erreichen, verwendeten wir Arbeitsblätter sowie ebene und räumliche Geometriemodelle. Wir haben Fragestellungen der ebenen und räumlichen Geometrie mit historischen Aspekten der Mathematik verbunden (Varignon-Theorem, Viviani-Theorem mit IKT-Werkzeugen, figurierte Zahlen).
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872003.0.08
Verfasser*innen: János KATONA
Titel des Beitrags: Entwicklung des räumlichen Vorstellungsvermögens an technischen Universitäten
Erste Seite: 153
Letzte Seite: 160
Abstract
Die meisten technischen Dokumentationen sind auch heute noch zweidimensional. Daher ist die Entwicklung des räumlichen Vorstellungsvermögens von Ingenieurstudierenden von größter Bedeutung. In diesem Artikel betrachten wir die Ausbildung an den technischen Universitäten aus dieser Perspektive.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872003.0.09
Verfasser*innen: Eszter KÓNYA
Titel des Beitrags: How can the concept of perimeter and area be developed in 7th grade?
Erste Seite: 161
Letzte Seite: 172
Abstract
Learning and teaching measurement have a central role in school geometry. In this study, we are focusing on two physical quantities: perimeter (length) and area. We compare the results of two surveys. The first was written at the beginning of the 7th school year, in September, while completed the second one in December of the same year, two weeks after the geometric measurement topic. On the one hand, we were curious about the students‘ previous knowledge before receiving the new learning material related to the topic under study. On the other hand, we wanted to know how to change students‘ understanding after focusing on the concepts studied for a few weeks. The characteristics of the concept formation process were also of interest to us.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872003.0.10
Verfasser*innen: István LÉNÁRT
Titel des Beitrags: Vergleichende Geometrie in der öffentlichen Bildung: Ebene, Kugel, Halbkugel
Erste Seite: 173
Letzte Seite: 202
Abstract
Der Artikel beschäftigt sich mit vergleichender Geometrie als Lehr- und Lernmethode. Er beschreibt zunächst ein Curriculum, das auf einem Vergleich der Grundkonzepte der planaren Geometrie und der sphärischen Geometrie und der damit verbundenen Erfahrungen basiert, hauptsächlich für einen fakultativen Kurs, der für zukünftige Kinder¬gärt¬nerinnen, Grund¬schullehrerinnen und -lehrer ausgeschrieben ist. Der Vergleich zwischen Ebene und Kugel wird dann erweitert um das Studium einer dritten Geometrie, der hyperbolischen Geometrie auf der Grundlage des halbkugelförmigen Modells von Poincaré. In den Schlussfolgerungen fasse ich die mit der Methode bereits erzielten und noch verfügbaren Ergebnisse zusammen.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872003.0.11
Verfasser*innen: Anne MÖLLER & Benjamin ROTT
Titel des Beitrags: Argumentieren und Begründen rund um die Mittelsenkrechte
Erste Seite: 203
Letzte Seite: 226
Abstract
Im Rahmen einer Gesamtanalyse einer Studie konnten vier Lernende identifiziert werden, die in Bezug auf ihre inhaltlichen Vorkenntnisse (Test1) und in einem Leistungstest direkt danach (Test2) besonders gute und vergleichbare Ergebnisse erzielten. Bei einem späteren Test (Test3) wurde bei einem der vier Lernenden ein enormer Leistungsabfall beobachtet, während die anderen drei wieder eine vergleichbare Leistung zeigten. In diesem Artikel werden die zusätzlichen Einzelinterviews, die nach Test2 für alle vier Lernenden durchgeführt worden waren, analysiert, um Ähnlichkeiten und Unterschiede als mögliche Erklärung ausfindig zu machen. Alle vier Lernenden erwähnten die erforderliche mathematische Argumentation für beide Aufgaben. Es wurden Unterschiede hinsichtlich der Herleitung der Argumentationen, der Dauer der Interviews und der (sprachlichen) Verwendung des Ortslinienkonzepts der Mittelsenkrechte festgestellt.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872003.0.12
Verfasser*innen: Matthias MÜLLER & Nicole POLJANSKIJ
Titel des Beitrags: Gibt es mehr als einen Pólya-Stöpsel? Verschiedene Zugänge zu einer geometrischen Problemstellung
Erste Seite: 227
Letzte Seite: 242
Abstract
Eine über zweihundert Jahre alte geometrische Problemstellung hat verschiedene MathematikerInnen und MathematikdidaktikerInnen immer wieder beschäftigt. Auch George Pólya formulierte die Problemstellung mittels dreier Bedingungen: Gesucht ist ein Körper, dessen Projektion auf den Boden einem Kreis, dessen Projektion auf die Vorderwand einem Quadrat und dessen Projektion auf die Seitenwand einem gleichschenkligen Dreieck entspricht. Es ist vergleichsweise unbekannt, dass es mehrere konvexe Körper gibt, die diesen Bedingungen genügen (auch Pólya-Stöpsel genannt). Möchte man die Körper entsprechend ihrer Volumina ordnen, so lassen sich ein Körper mit dem maximalen und ein Körper mit dem minimalen Volumen ausmachen. Um die Berechnungen der Volumina nachvollziehen zu können, bietet es sich an, verschiedene Verfahren zur Herstellung von Modellen dieser Körper zu erproben und miteinander zu vergleichen. Neben der Motivation der Problemstellung und der Herleitung der Volumina werden in diesem Beitrag drei analoge und digitale Verfahren (u. a. 3D-Druck) beschrieben und verglichen.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872003.0.13
Verfasser*innen: Michael NEUBRAND
Titel des Beitrags: Geometrie und geometrisches Denken: Orientierungen für den Inhalt und die didaktische Gestaltung des Geometrieunterrichts
Erste Seite: 243
Letzte Seite: 272
Abstract
Dieser Beitrag betrachtet, eingeleitet und begleitet von einem Aufgaben-Entwurf für eine Leistungsuntersuchung, fundamentale Aspekte, um geometrisches Denken zu verstehen und zu gestalten. Der Inhalt (Was ist Geometrie?), die gedankliche Eröffnung (Welche Zugänge zum geometrischen Denken gibt es?), die mathematischen Tätigkeiten in der Geometrie (Wie betreibt man Geometrie?), aber auch das didaktische Potential (Welche Optionen bietet der Geometrieunterricht?) werden dabei diskutiert. Es sind epistemologische, geometrische, didaktische und allgemein-pädagogische Aspekte aufzunehmen, deren Interdependenz zu beachten und in eine systematische Ordnung zu bringen. Abschließend wird skizzenhaft auf die Problematik der Realisierung der Multiperspektivität der Geometrie im Curriculum und bei Leistungstests eingegangen.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872003.0.14
Verfasser*innen: Anna RÉKASI & Csaba SZABÓ
Titel des Beitrags: Modification of the geometry curriculum in relation to the curriculum reform in the light of the Van Hiele levels
Erste Seite: 273
Letzte Seite: 290
Abstract
In this paper the level of geometry education in mathematics education in Hungary is investigated. The relationship between the National Core Curriculum, the Framework Curriculum and the final exam is analyzed from the geometry point of view via the Van Hiele levels as a tool for comparison. It is observed that the geometry problems on the final exams do not follow the level prescribed by the National Core Curriculum. We compare these observations with the results of the Usiskin-test of first year preservice math teacher students.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872003.0.15
Verfasser*innen: Erika ROMÁN
Titel des Beitrags: Was ist die geometrische Botschaft eines Vektorausdrucks?
Erste Seite: 291
Letzte Seite: 302
Abstract
In diesem Artikel stellen wir eine ungarische Tradition vor, indem die synthetische Elementargeometrie mit der analytischen Vektorgeometrie kombiniert wird. Wir wollen diese Methode auf das transkarpatische Talentmanagement übertragen. Unser Fokus liegt darauf, wie sich synthetische und vektorielle (analytische) Geometrie bei dem Problemlösen gegenseitig helfen. Wir weisen darauf hin, wie viel einfacher es ist, ein komplexes Problem zu lösen, wenn wir mit beiden Vorgehensweisen vertraut sind und die Methoden parallel behandeln können.
Wir untersuchen je eine Reihe von synthetischen und analytischen Problemen. Durch parallele Behandlung und kontinuierlichen Vergleich der Stationen der beiden Wege entdecken wir, wie aus diesen ein einzelner Problemcluster organisiert werden kann. Die ausgewählten Aufgaben stammen aus dem Erbe von István Reiman und Katalin Horvay aus der zweibändigen Geometrie-Aufgabensammlung (Horvay et al. 2002). Die professionelle Qualität der Aufgabensammlung zeigt, dass István Reiman das ungarische Team über viele Jahre erfolgreich auf die Internationale Mathematikolympiade vorbereitet hat.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872003.0.16
Verfasser*innen: Johann SJUTS & Gabriella AMBRUS
Titel des Beitrags: Dynamisches und statisches geometrisches Denken
Erste Seite: 303
Letzte Seite: 322
Abstract
Geometrisches Denken bedeutet, sich Dinge und Sachverhalte des uns umgebenden Raumes zu erschließen und begrifflich zu ordnen. Eine besondere Stellung hat das geometrische Beweisen. Es ist mit verschiedenen kognitiven Aktivitäten und mentalen Repräsentationen verbunden. Dabei lassen sich Tendenzen und Präferenzen einerseits des funktional-logischen Zurechtlegens und andererseits des prädikativ-logischen Zurechtlegens ausmachen. Aufgabenbearbeitungen und Problemlösungen können die Verschiedenartigkeit von dynamischem und statischem geometrischen Denken verdeutlichen.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872003.0.17
Verfasser*innen: Anna STIRLING, Csaba SZABÓ, Júlia SZENDERÁK,
Csilla BERECZKY-ZÁMBÓ, Sára SZÖRÉNYI
Titel des Beitrags: Geometric representations of irrational algebraic numbers in Hungarian high school mathematics education
Erste Seite: 323
Letzte Seite: 340
Abstract
Irrational numbers are present in our everyday life but their exact values cannot be given in a form that students easily understand. Therefore in this paper we show geometrical constructions and calculations in which non-rational numbers naturally arise and gain meaning.
We look at numbers which are expressible with at maximum two roots and are present in the Hungarian curriculum. For each number we present how they appear in Hungarian textbooks, and show multiple problems and solutions in which they arise. These solutions differ in their level of mathematical complexity, from elementary geometry to higher algebra. Introducing these solutions to students, shows them, that the different areas of mathematics are interrelated.
This approach may inspire students to use their mathematical knowledge not only from the area in which the problem was presented.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872003.0.18
Verfasser*innen: Szilárd SVITEK
Titel des Beitrags: Wie Studenten eine offene Aufgabe aus der Geometrie lösen – eine Fallstudie
Erste Seite: 341
Letzte Seite: 356
Abstract
In der folgenden Fallstudie werden die Mittel und die Strategien untersucht, die Studenten der Universität verwenden, um eine bestimmte offene Geometrieaufgabe zu lösen. Ziel der Studie ist es, diese Mittel und Strategien auf ihre Nützlichkeit und ihre Vor- und Nachteile hin zu analysieren. An der Studie nahmen Mathematikstudenten des ersten Studienjahres an der J. Selye Universität (UJS) in Komárno und ein Student der Eötvös Loránd Universität (ELTE) in Budapest teil.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872003.0.19
Verfasser*innen: Lajos SZILASSI
Titel des Beitrags: „Kaninchen aus dem Hut“ – Gedanken zur mathematischen Kommunikation
Erste Seite: 357
Letzte Seite: 368
Abstract
Der Autor beschwert sich darüber, dass die mathematische Literatur (Studien, Artikel) fast ausschließlich Ergebnisse mitteilt und den Weg zur Erreichung der Ergebnisse nicht aufzeigt, obwohl dies als methodische Lehre für die Forschung dienen würde. Als Beispiel präsentiert er einen sachlichen, trockenen Beweis vom Typ „Kaninchen aus dem Hut“ für die Existenz eines nach ihm benannten Polyeders. Anschließend beschreibt er ausführlich die Umstände der Entdeckung des Polyeders und den Weg, den er bis zur Entdeckung des Polyeders zu gehen hatte.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872003.0.20
Verfasser*innen: Kinga SZŰCS
Titel des Beitrags: Neue Zugänge zu geometrischen Beweisen als Beitrag zum geometrischen Denken am Beispiel des Satzes von Varignon
Erste Seite: 369
Letzte Seite: 386
Abstract
Argumentieren und Beweisen stellen einen der fünf Aspekte geometrischen Denkens dar und sollten somit einen wesentlichen Bestandteil des Geometrieunterrichts bilden. Auch wenn dies etwa bis in die 1990er Jahre der Fall war, verschwanden Beweise seitdem aus dem gesamten Mathematikunterricht, so auch aus dem Geometrieunterricht – bis auf wenige Ausnahmen – vollkommen. In dem vorliegenden Beitrag werden neue Zugänge durch Falten zu einem altbekannten Satz beziehungsweise zu seinen Beweisen, nämlich zum Satz von Varignon sowie zu dessen Spezialfällen vorgestellt. Es wird zudem aufgezeigt, dass hierdurch weitere Aspekte des geometrischen Denkens wie die Begriffsbildung, das Problemlösen und die Verwendung von Darstellungen gefördert werden können.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872003.0.21
Verfasser*innen: Emese VARGYAS
Titel des Beitrags: Auf dem Weg vom Speziellen zum Allgemeinen
Erste Seite: 387
Letzte Seite: 404
Abstract
Die selbstständige Durchführung von Beweisaufgaben stellt Schüler und Schülerinnen vor große Herausforderungen. Auch wenn die Lehrperson den Beweis selbst vorführt, bleibt bei vielen Schülern, sogar bei denen, die dem Beweis problemlos folgen können, oft die Frage „Wie kommt man auf eine solche Idee?“ mit einem bitteren Beigeschmack zurück. „Betrachte Spezialfälle!“ kann eine Antwort darauf sein. Was diese allerdings bedeutet, ist auch nicht immer klar definiert. Der Aufsatz stellt anhand einer elementargeometrischen Aufgabe mögliche Stolpersteine auf dem Weg vom Speziellen zum Allgemeinen vor und bietet einige Lösungsansätze dazu an.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872003.0.22
Verfasser*innen: Hans WALSER
Titel des Beitrags: Geometrie mit dynamischer Geometrie Software
Erste Seite: 405
Letzte Seite: 418
Abstract
Die dynamische Geometrie Software (DGS) ist seit langem im Schulunterricht etabliert und im Lehrplan verankert.
Nach meinen Erfahrungen wird allerdings dynamische Geometrie Software im schulischen Bereich sehr oft nur als Zeicheninstrument gehandhabt. Damit wird das eigentliche Potential dieser Software nicht ausgenützt. Für geometrische Fragen wird nach wie vor mit Zirkel und Geodreieck gearbeitet. Dabei stellt sich die entwicklungspsychologische Frage, ob man die tradierten Methoden beherrschen müsse, um die aktuellen Methoden nutzbringend anwenden zu können.
Es gibt aber interessante Beispiele, welche zunächst spezifische technische Fragen um die Handhabung der dynamischen Geometrie Software aufwerfen. Diese Fragen tangieren auch das tradierte Bild der Geometrie. Es werden exemplarisch einige Fälle dazu vorgestellt (Inkreis, archimedische Spiralen, Zykloide). Dabei kommen wir zu Fragen der Arbeitsökonomie, der logischen Schlüssigkeit und der strukturellen Symmetrie.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872003.0.23