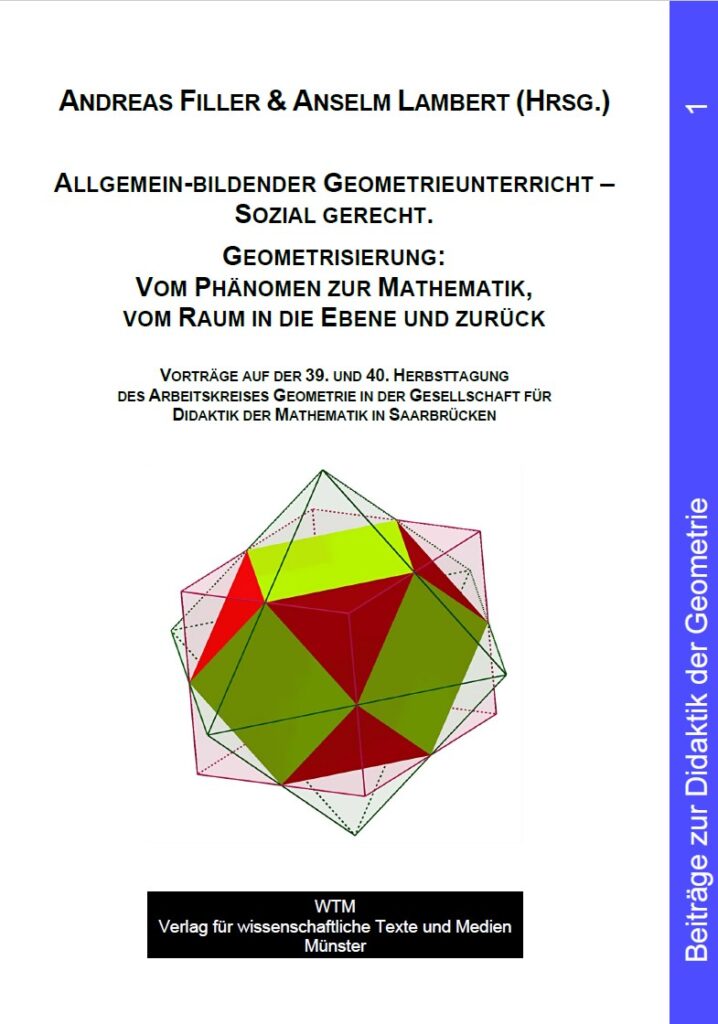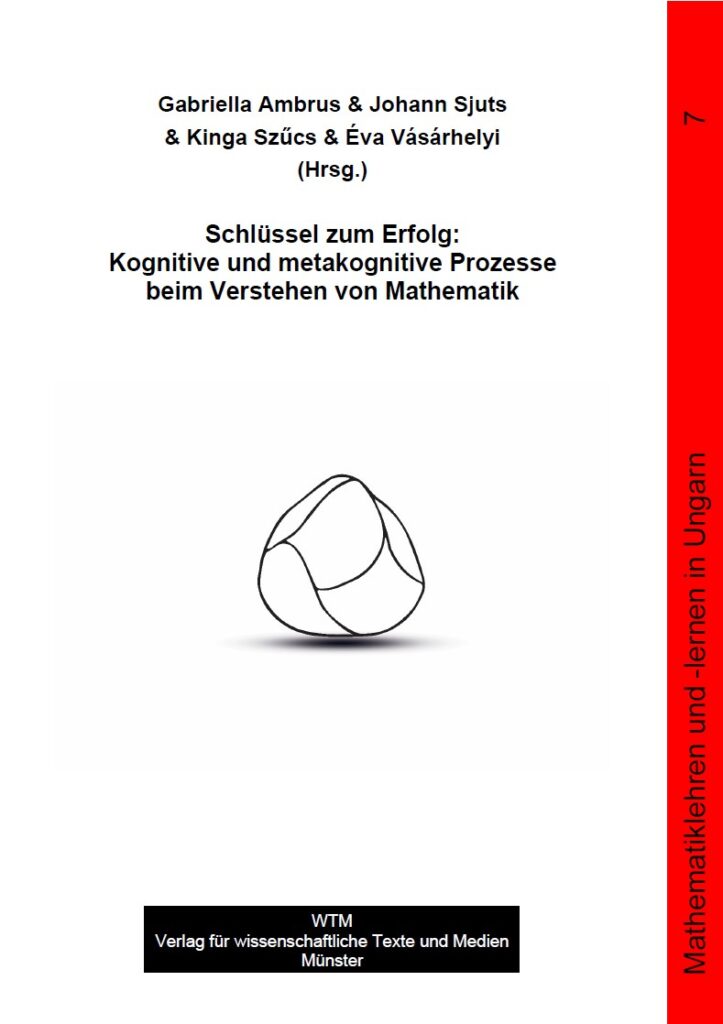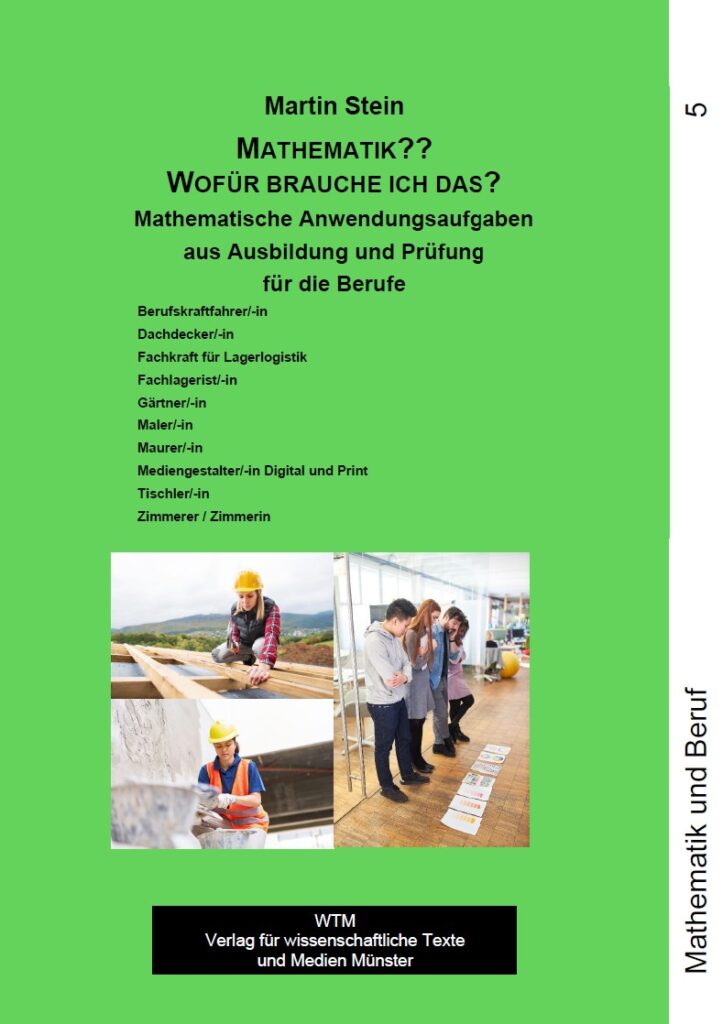Band 7 der Reihe Mathematiklehren und -lernen in Ungarn
Münster 2025, 340 S., davon 50 farbig, DIN A5
Print: ISBN 978-3-95987-349-9, 47,90 €
Ebook: ISBN 978-3-95987-350-5, 43,90 €
Zur Vorschau klicken sie bitte das Bild an.
Sie können das Buch –> HIER kaufen (sowohl das gedruckte Buch als auch das E-Book)
https://doi.org/10.37626/GA9783959873505.0
Abstract
Der vorliegende Band widmet sich der Komplexität des Verstehens von Mathematik. Die Beiträge verdeutlichen die zentrale Bedeutung von kognitiven und metakognitiven Prozessen, die für den Erfolg im Mathematikunterricht wesentlich sind. Kognition umfasst die mit Erwerb, Organisation und Gebrauch von Wissen verbundene individuelle geistige Aktivität, Metakognition steht für das Kennen, Steuern und Empfinden der eigenen kognitiven Prozesse.
Zur Sprache kommen kognitionswissenschaftliche Analysen des Lernens, Denkens und Verstehens. Im Fokus stehen dabei spezifische kognitive und metakognitive Aktivitäten. Insbesondere wird erläutert, wie Lernende ihre eigenen Denkvorgänge und ihre Lernstrategien planen, überwachen und anpassen. Dies ist essenziell, um mathematische Aufgaben und Probleme effektiv zu lösen und um das Verstehen von Mathematik nachhaltig zu vertiefen.
Selbstverständlich setzt sich das Buch auch mit der diesbezüglichen Professionalisierung von angehenden Lehrkräften auseinander.
Durchweg bieten die Beiträge unterrichtspraktische Hinweise für Lehrkräfte. Es werden unterrichtliche Vorgehensweisen dargelegt, die die Entwicklung kognitiver und metakognitiver Fähigkeiten der Lernenden fördern. Einen besonderen Stellenwert hat dazu die Nutzung von Reflexionsphasen, um Lernprozesse bewusst zu machen.
Mathematik ist in Ungarn traditionell von hoher kultureller und wissenschaftlicher Bedeutung. Auch an diesem Band der Buchreihe „Mathematiklehren und -lernen in Ungarn“ haben sich Autorinnen und Autoren aus verschiedenen Ländern beteiligt, um die beispielgebende Rolle des Landes und den inspirativen Austausch über Grenzen hinweg zum Ausdruck zu bringen.
Beiträge
E. Cohors-Fresenborg: Mechanismen von Metakognition und Diskursivität im Mathematikunterricht
Abstract
Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit Wirkmechanismen von Metakognition und Diskursivität beim Lehren und Lernen von Mathematik. Die kognitionstheoretisch ausgerichtete Mathematikdidaktik hat ein System spezifischer Kategorien entwickelt, mit denen sich metakognitive und diskursive Aktivitäten in videographierten und transkribierten Unterrichtsgesprächen erfassen und analysieren lassen.
Erste Seite: 11
Letzte Seite: 26
=====================================================
R. Blasius & K. Winkel: Strategieschlüssel als Werkzeug zur Förderung von Problemlösekompetenzen und Metakognition bei Kindern mit besonderen Schwierigkeiten beim Mathematiklernen
Abstract
Kritisches Denken und Problemlösen sowie Kreativität, Kommunikation und Kollaboration sind zentrale Kompetenzen des 21. Jahrhunderts, die alle Kinder erlernen sollten. Mathematische Problemlöseaufgaben sind besonders geeignet, um diese Kompetenzen früh im Mathematikunterricht zu entwickeln. Trotz zunehmender Evidenz dafür, dass insbesondere auch leistungsschwächere Kinder von einer Förderung der Problemlösekompetenzen profitieren, wird Problemlösen in der Grundschule häufig nur für leistungsstarke Kinder diskutiert. Mit leistungsschwächeren Kindern wird es kaum praktiziert. Dieser Beitrag zeigt an Fallbeispielen auf, wie Kinder mit besonderen Schwierigkeiten beim Mathematiklernen durchaus in der Lage sind, Probleme mathematisch zu lösen, wenn sie explizit zu metakognitiven Prozessen und zum Einsatz von Problemlösestrategien angeregt werden.
Erste Seite: 27
Letzte Seite: 50
=====================================================
E. Kok & E. Nowińska: Metakognition und Diskursivität beim Problemlösen im Mathematikunterricht: Aufgabenerweiterungen und Aufgabenbearbeitungen in einer exemplarischen Analyse
Abstract
Metakognitive und diskursive Aktivitäten gelten als aussichtsreich, Lern-, Verstehens- und Denkprozesse im Mathematikunterricht zu optimieren. Der vorliegende Beitrag zeigt auf, wie Metakognition und Diskursivität sich auch für Problemlösefähigkeiten zur Geltung bringen lassen. Im Mittelpunkt der Betrachtung stehen Transkriptanalysen. Zugrunde liegen dafür Unterrichtsszenen, in denen spezifische Aufgabenerweiterungen zum Einsatz gekommen sind, die die Lernenden zur Planung, Überwachung und Reflexion beim Problemlösen angeregt haben. Zugleich verdeutlicht die Analyse die synergetische Wechselwirkung von Forschung und Unterricht.
Erste Seite: 51
Letzte Seite: 72
=====================================================
A. Ambrus & K. Barczi-Veres: Metakognition im Mathematikunterricht aus der Sicht des Forschens, Lehrens und Lernens
Abstract
In diesem Artikel fassen wir kurz die theoretischen Positionen zur Metakognition beim Mathematiklehren und -lernen zusammen. Eine erfahrene Mathematiklehrerin, die eine Doktorarbeit über das Lehren mathematischen Problemlösens geschrieben hat, erläutert ihre Meinung auf der Grundlage ihrer Unterrichtserfahrungen und spricht dann mit einem Schüler über die Gewohnheiten und Erfahrungen des Schülers im Bereich des mathematischen Problemlösens.
Erste Seite: 75
Letzte Seite: 92
=====================================================
R. Bruder: Identifizieren und Realisieren als kognitive Elementarhandlungen zum Verstehen von Mathematik
Abstract
Die beiden elementaren Aneignungshandlungen Identifizieren und Realisieren werden unter kognitionspsychologischer Perspektive bzgl. ihrer Struktur beschrieben und in spezifischen Verwendungen zum verständigen Erlernen mathematischer Begriffe, Zusammenhänge und Verfahren sowie zur Diagnostik erläutert.
Erste Seite: 93
Letzte Seite: 110
=====================================================
K. Fried & É. Vásárhelyi: Two pillars of the traditions of Hungarian mathematics education
Abstract
One of the important methodological tools of the complex mathematics teaching experiment associated with Tamás Varga’s name was guided discovery, which is based on the basic learning theory idea that if students discover a mathematical property or relationship themselves, it will be more dynamically fixed. The key to discovery was a series of tasks built on elementarization. Their hypothesis was that the success and developmental effect of solving the task series can be increased by the context effect. This was supported by the teaching experiences in the experimental classes. In this paper, we present and analyze examples that illustrate the elementarization and the context effect. The first selected problem area is based on arithmetic and algebra; in the second, we use geometric problem-solving strategies; and in the third, we link different mathematical fields. By linking the different mathematical fields, a balance is formed based on secure knowledge of the known field while attempting to model the concepts of the other field.
Erste Seite: 111
Letzte Seite: 126
=====================================================
Z. Fülöp: The main cognitive aspects of the transition from arithmetic to algebra – patterns and errors
Abstract
Algebraic thinking can be interpreted as an approach to quantitative situations in a general relational aspect with letter symbolic representation, such as variables, unknowns and parameters. Certain conceptual and symbolic changes mark a difference between arithmetic and algebraic thinking in the individual, such as the different interpretation of letters and the notion of equality. To succeed in algebra, pupils have to break away from arithmetical conventions and to adopt an algebraic way of thinking, so this process involves a shift from procedural thinking to structural thinking. Several mathematics educators mentioned the existence of a cognitive gap between arithmetic and algebra. This principally means the pupils’ inability to operate spontaneously with or on the unknown, and to describe the relationship between unknown quantities in a letter symbolic representation. In this way, certain types of errors can be identified, such as reversal error, concatenation and closure. Our main aim is to analyse the results of our own empirical research on this topic, conducted among Grade 7 pupils. Our study investigates the main patterns and errors in pupils’ thinking processes in the solution of word problems whose algebraic model is an equation where the unknown quantity occurs on both sides of the equation.
Erste Seite: 127
Letzte Seite: 148
=====================================================
Z. Jánvári: Bewertung und kognitiv-metakognitive Dimensionen von Aufgaben zur deskriptiven Statistik in schulischen Aufnahmeprüfungen
Abstract
In Ungarn wurde die deskriptive Statistik erst vor relativ kurzer Zeit, nämlich in den 1960er Jahren, in den Lehrplan der Grundschule aufgenommen. Die Relevanz des Gebiets und seine Rolle im Mathematikunterricht werden nach wie vor diskutiert. Im vorliegenden Artikel untersuche ich die kognitiven und metakognitiven Fähigkeiten, die mit dem Gebiet verbunden sind (insbesondere mit den Inhalten der deskriptiven Statistik in den schulischen Aufnahmeprüfungen), sowohl theoretisch als auch anhand der Ergebnisse der zentralen schriftlichen Aufnahmeprüfungen der Jahre 2023 und 2024. Die Ergebnisse sollen die Aufmerksamkeit darauf lenken, wie man den Fortschritt und die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler (in diesem Artikel vor allem beim Lösen von statistischen Aufgaben) durch das Verständnis ihrer metakognitiven Prozesse unterstützen kann.
Erste Seite: 149
Letzte Seite: 166
=====================================================
M. Kiss: Ein Rückblick auf die Problemlösung durch „mündliche Klassenarbeiten“
Abstract
In diesem Artikel wird über ein Forschungsprojekt berichtet, in dem die metakognitiven Aktivitäten einer Gruppe von 29 Schülern der Klassen 11-12 in der Kontrollphase des mathematischen Problemlösens durch sogenannte „mündliche Klassenarbeiten“ untersucht wurden. Während des Online-Unterrichts in dieser Klasse bestand die Rechenschaftspflicht der Schüler darin, eine fotografische Darstellung der Probleme, die sie zu Hause innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens gelöst hatten, auf eine Plattform hochzuladen und außerdem eine Audioaufnahme zu erstellen und anzuhängen, in der die Schüler kurz erklärten, wie sie jedes Problem gelöst hatten. Die mündliche Klassenarbeit scheint eine wertvolle Möglichkeit zu sein, um die Monitoring- und Kontrollaktivitäten der Schüler zu stimulieren und zu überwachen, da die mündlichen Erklärungen nach der schriftlichen Lösung der Aufgabe die Schüler dazu brachten, den Problemlösungsprozess zu überdenken, was Möglichkeiten zur Kontrolle und Reflexion bot. Die mündlichen Erklärungen wurden im Lichte der schriftlichen Lösungen analysiert, um zusätzliche Informationen über den Denkprozess der Schüler im Vergleich zu den schriftlichen Lösungen zu erhalten.
Erste Seite: 167
Letzte Seite: 186
=====================================================
M. Müller & A.Imhof: Vorschlag zum methodischen Design einer Untersuchung zur Arbeit mit digitalen Mathematikwerkzeugen mittels der Methode des lauten Denkens
Abstract
Verschiedene Forschungsmethoden können unterschiedliche Erkenntnisse hervorbringen. In diesem Sinne gibt es verschiedene methodische Ansätze, das Wissen von Lernenden qualitativ zu erfassen. Je nach Zugang können die Ergebnisse unter Umständen divergieren. Generell stellt sich dabei die Frage nach der Validität von Messungen, und bei einer erneuten Versuchsdurchführung kommt zudem die Frage nach der Reliabilität hinzu. Speziell Studien, die die Methode des lauten Denkens anwenden, sind im fachdidaktischen Kontext interessant. Aus methodischer Sicht ist es lohnend, das Recall- und das Recognition-Paradigma heranzuziehen, um eine Reliabilitäts- und Validitätsverbesserung anzustreben. Ziel des vorliegenden Beitrags ist es daher, ein Untersuchungsdesign am Beispiel einer mathematikdidaktischen Studie zu Prozessen der Werkzeuganeignung im Rahmen einer digitalen Lernumgebung theoretisch herzuleiten, beispielhaft vorzustellen und zu begründen.
Erste Seite: 187
Letzte Seite: 206
=====================================================
N. Noster & H.-S. Siller: Kognitive Herausforderungen beim Umformen von Gleichungen
Im Zentrum dieses Beitrages stehen Herausforderungen beim Umformen von Gleichungen. Hierzu werden zunächst Äquivalenzumformungen in Form von Waage- und Elementarumformungsregeln thematisiert. Anschließend werden verschiedene kognitive Herausforderungen herausgestellt, die in vergangenen Studien identifiziert wurden. Dabei handelt es sich um die Darstellung der Variablen, die Anzahl und Häufigkeit der auftretenden Variablen und die damit verbundene Notwendigkeit, mit Variablen bei Term- sowie Äquivalenzumformungen zu operieren. Darüber hinaus werden heuristische Strategien sowie Metawissen als Elemente, die Umformungsprozesse steuern, thematisiert.
Erste Seite: 207
Letzte Seite: 218
=====================================================
J. Postupa & G. Ambrus: Kognitive Aktivierung durch grafische Darstellungen – ein Vergleich deutscher und ungarischer Schulbücher aus zwei Epochen
Abstract
Das Erlernen, Verstehen und Betreiben von Mathematik kann durch geeignete grafische Darstellungen erheblich unterstützt werden. In Lehrbüchern werden grafische Darstellungen beispielsweise eingesetzt, um Textinhalte zu verdeutlichen, mathematische Zusammenhänge zu veranschaulichen oder Beispiele für Aufgabenbearbeitungen bereitzustellen. Nicht zuletzt sind grafische Darstellungen auch geeignet, Lernende zu einer intensiven Auseinandersetzung mit mathematischen Inhalten anzuregen. Die Entwicklung von Merkmalen für solch kognitiv aktivierende Lehrbuchdarstellungen sowie deren Auftreten in deutschen und ungarischen Mathematikschulbüchern im Rahmen des Bruchrechnens stehen im Mittelpunkt dieses Beitrags.
Erste Seite: 219
Letzte Seite: 236
=====================================================
S. Schnepel & A. K. Dahlhues: Warum soll ich Strukturen nutzen, wenn ich zählen kann? – Erklärung der Vorgehensweisen von Kindern bei der Anzahlerfassung am Zwanzigerfeld
Abstract
Die Fähigkeit, strukturiert dargestellte Anzahlen schnell zu erfassen, ist ein wichtiger Schritt beim Erwerb nicht-zählender Rechenstrategien. Während ein Großteil der Schüler:innen im ersten Schuljahr lernt, Anzahlen am Zwanzigerfeld anhand der Struktur schnell zu erfassen, haben manche Lernende Schwierigkeiten, die Strukturen zur Anzahlerfassung zu nutzen. In diesem Beitrag wird zuerst an Beispielen illustriert, wie Lernende vorgehen, die Schwierigkeiten bei der strukturierten Anzahlerfassung haben. Häufig bestimmen sie am Zwanzigerfeld dargestellte Anzahlen zunächst zählend, beschreiben aber auf Rückfrage der Lehrkraft eine Struktur. Anschließend werden für diese Vorgehensweisen Erklärungsansätze in der New Theory of Disuse von Bjork & Bjork (1992) gesucht und Implikationen für den Mathematikunterricht abgeleitet.
Erste Seite: 237
Letzte Seite: 250
=====================================================
E. Vargyas: Brücken bauen: Vom Speziellen zum Allgemeinen
Abstract
Das Lösen von Beweis- und Konstruktionsaufgaben in der Elementargeometrie stellt für viele Schülerinnen und Schüler eine große Herausforderung dar. Der häufig empfohlene Ansatz, zunächst einen Spezialfall zu analysieren, um daraus eine Lösung für das allgemeine Problem abzuleiten, erweist sich jedoch in vielen Fällen als ineffektiv. Die Hindernisse, die einer erfolgreichen Verallgemeinerung entgegenstehen, sind vielfältig. Sie umfassen unter anderem die Trivialität des betrachteten Spezialfalls, Schwierigkeiten bei der Identifikation von Zusammenhängen zwischen spezifischen und allgemeinen Fällen sowie mögliche Sackgassen, die durch die Lösung des Spezialfalls entstehen können. Im Rahmen dieses Aufsatzes werden ausgewählte Beispiele vorgestellt, die verschiedene methodische Ansätze zur Überwindung dieser Problematik aufzeigen.
Erste Seite: 251
Letzte Seite: 264
=====================================================
K. Vorhölter: Metakognitive Strategien beim mathematischen Modellieren
Abstract
Das Bearbeiten von Modellierungsproblemen stellt eine komplexe Tätigkeit dar, zu deren erfolgreichen Durchführung die Anwendung metakognitiver Strategien hilfreich ist. Im Beitrag wird dargestellt, was metakognitive Modellierungsstrategien sind und wie bzw. wann sie im Modellierungsprozess zum Tragen kommen. Darüber hinaus werden die Wechselwirkungen des Betreibens von Metakognition und des Erwerbs von Modellierungskompetenzen dargestellt, wie auch die Intentionen, die Schülerinnen und Schüler mit dem Einsatz metakognitiver Modellierungsstrategien verfolgen.
Erste Seite: 265
Letzte Seite: 278
=====================================================
K. J. Fuchs: Persönlichkeitsmerkmale als Bausteine mathematischen Denkens
Abstract
Der Beitrag diskutiert kognitionspsychologische und handlungsbezogene Persönlichkeitsmerkmale sowie ein selbstbezogenes Merkmal mit einem starken Fokus auf Kognition und Metakognition im Kontext von Mathematik. Dabei werden zunächst die kognitionspsychologischen Modelle der Intelligenz bzw. Kreativität vorgestellt. Einen Akzent legt der Beitrag auf die Künstliche Intelligenz einschließlich deren historische Genese. Besprochen werden im Merkmal Umgang mit Mathematik die Bedeutung kognitiver sowie metakognitiver Strategien. Die handlungsbezogenen Merkmale Persistenz und Interesse werden auf ihren Beitrag zu mathematischem Denken untersucht. Zuvor gilt die Aufmerksamkeit dem Fähigkeitsselbstkonzept im Bereich Mathematik in Bezug auf Lern- und Leistungsmotivation der Schülerinnen und Schüler.
Erste Seite: 281
Letzte Seite: 290
=====================================================
Z. Kondé, E. Kutas, L. Magyari & D. Somogyi: Die Beziehung zwischen kognitiven, nicht-kognitiven und metakognitiven Faktoren bei elementaren mentalen Arithmetikaufgaben
Abstract
Basis des vorliegenden Beitrags ist eine Studie über die Beziehung zwischen ausgewählten kognitiven, nicht-kognitiven und metakognitiven Faktoren auf persönlicher Ebene im Zusammenhang mit elementararithmetischen Rechenoperationen. Die Hauptfrage besteht darin, ob die Anstrengungsbereitschaft, die sich in der Wahl des Schwierigkeitsgrades einer Arithmetik-Aufgabe widerspiegelt, mit dem metakognitiven Wissen über das Rechnen und mit den Überzeugungen über die Charakteristika der eigenen Fähigkeiten bzw. der eigenen Intelligenz (die als variabel oder gegeben betrachtet werden) zusammenhängt.
Erste Seite: 291
Letzte Seite: 310
=====================================================
J. Sjuts: Intellektuelle Ästhetik mathematischer Gedankengänge schon in der Schule
Abstract
Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich einleitend mit der Schönheit, Eleganz und Faszination von Mathematik und dann in der Hauptsache mit der Ästhetik von gedanklicher Prägnanz in der Schulmathematik. Einfallsreiche und aufschlussreiche Beispiele kognitiver und metakognitiver Prozesse zeigen auf, dass Kinder und Jugendliche beim Lösen mathematischer Aufgaben durch ihr eigenes Denken Momente von ästhetisch-expressiver Selbstwirksamkeit erleben können. Wird die Hürde einer zunächst als schwierig empfundenen Aufgabenstellung überwunden, entwickelt man nach einigem Nachdenken eine dann einfach erscheinende Lösung, stellt sich ein beglückendes Erfolgserlebnis ein. Und so erzeugt der Gegensatz von Komplexität und Einfachheit bei einem zunächst schwer zugänglichen Problem mit dann überschaubarer Lösung eine ästhetisch wirksame Spannung.
Erste Seite: 311
Letzte Seite: 326
=====================================================
Á. Buzogány: The Process of Acquiring the Set Concept in Primary School Teacher Training
Abstract
This article presents a pilot study with primary school teacher students acquiring the basic concepts of set theory and using them in their own work which help their cognitive development.
Erste Seite: 329
Letzte Seite: 338