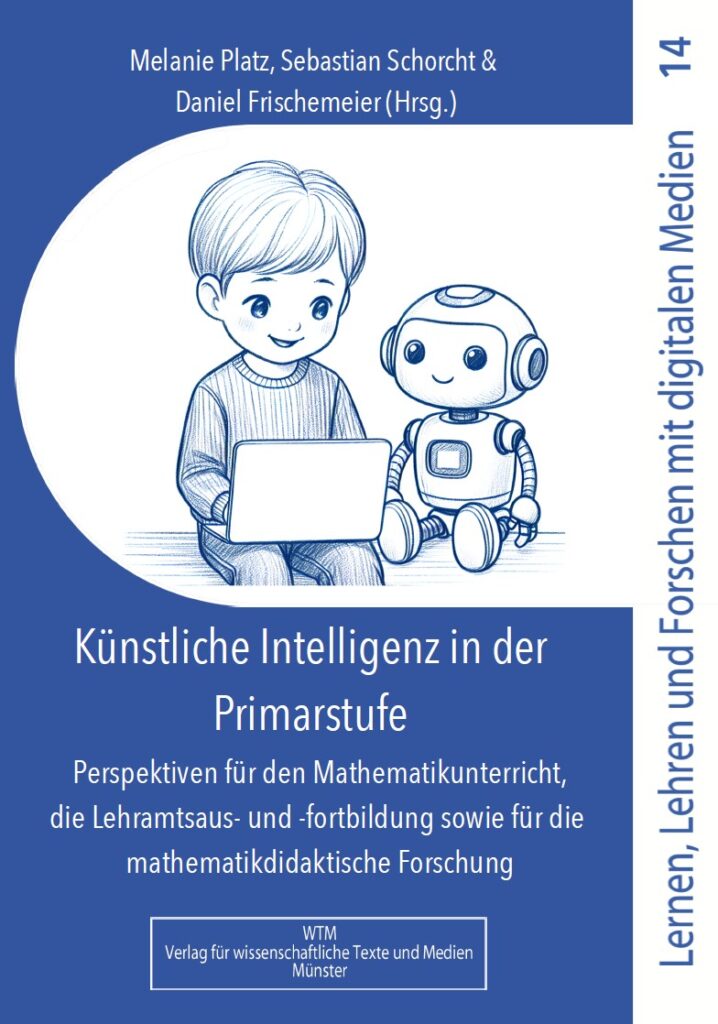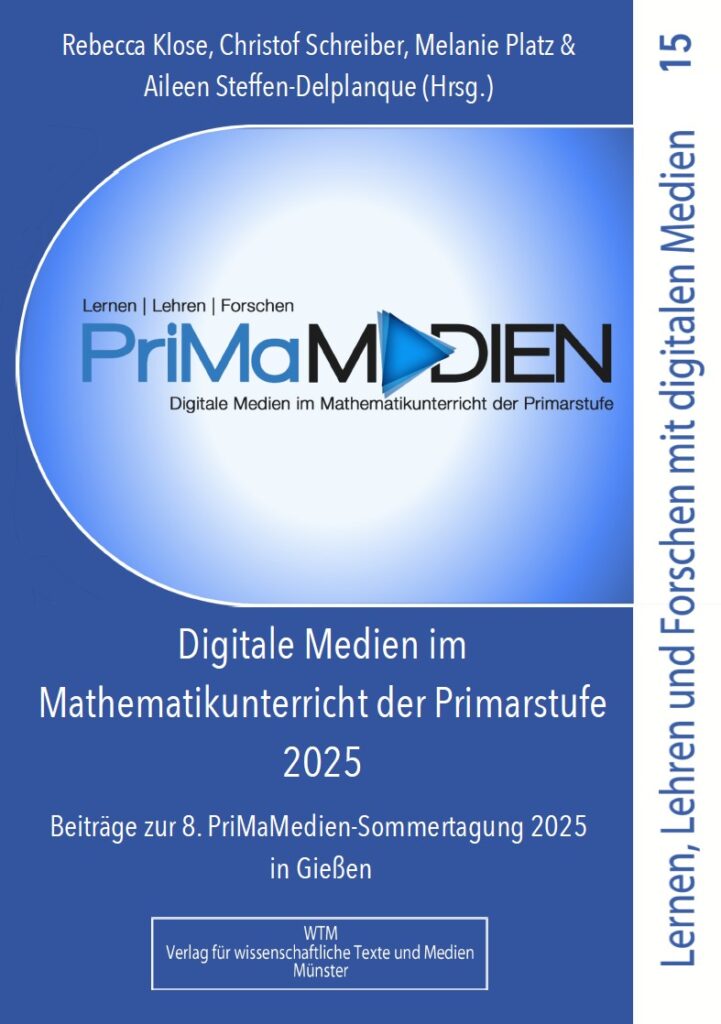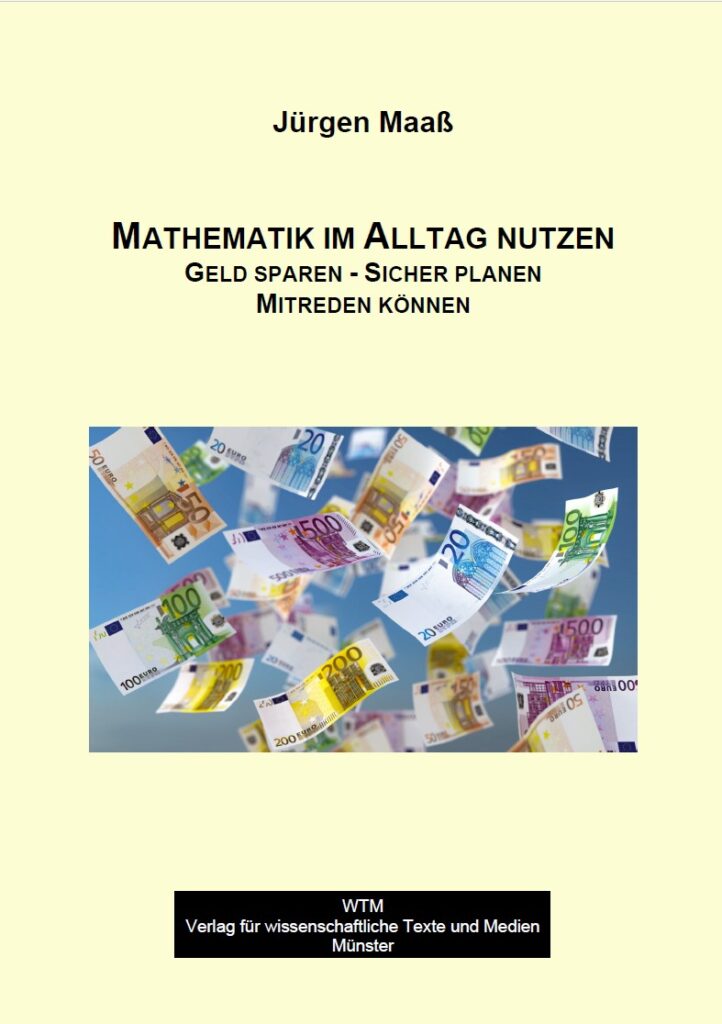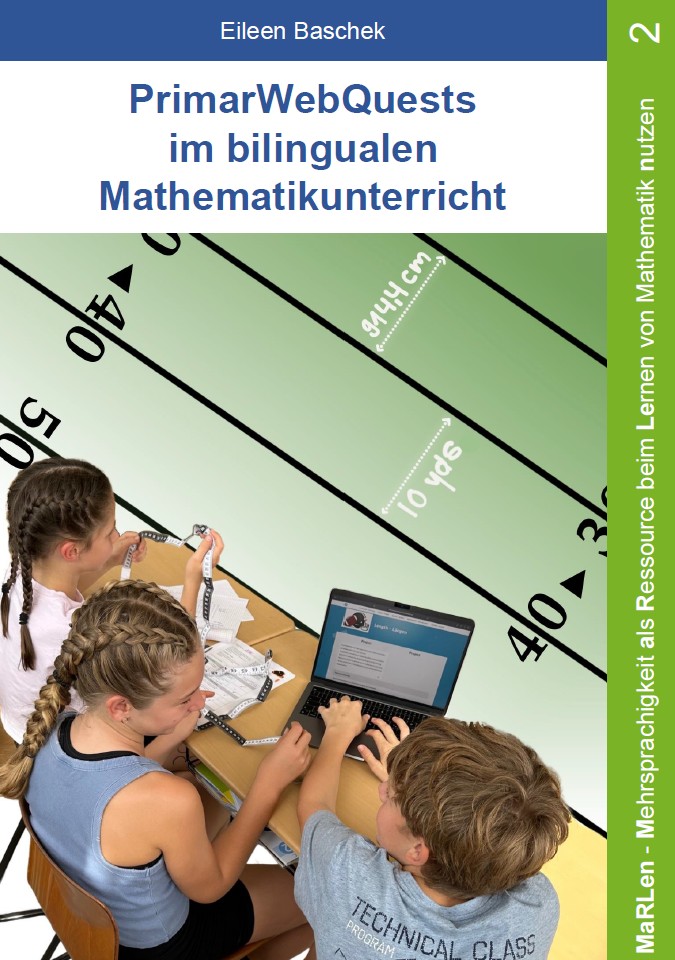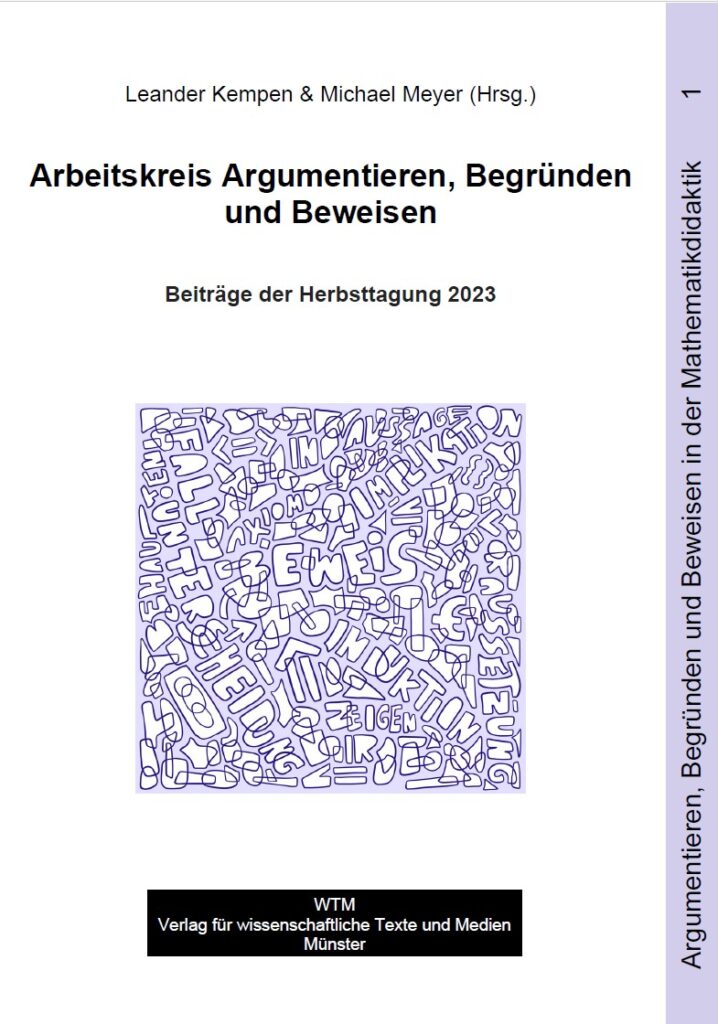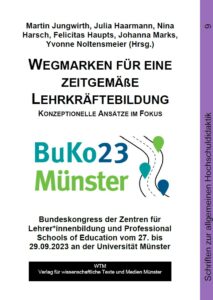 Tagungsband des 16. Bundeskongresses der Zentren für Lehrer*innenbildung
Tagungsband des 16. Bundeskongresses der Zentren für Lehrer*innenbildung
Band 9 der Reihe Schriften zur allgemeinen Hochschuldidaktik
Münster 2024, ca. 160 S., 17 cm x 24 cm s/w Graustufen
Print: ISBN 978-3-95987-283-6, 24,90 €
Ebook: ISBN 978-3-95987-284-3, 22,90 €
https://doi.org/10.37626/GA9783959872843.0
Hier können Sie das Buch kaufen (edition-buchshop)
Abstract
Der Bundeskongress (BuKo) ist das größte bundesweite Treffen der Zentren für Lehrer*innenbildung und Professional Schools of Education in Deutschland. Gastgeber des BuKo 2023 war das Zentrum für Lehrerbildung der Universität Münster. Vom 27. bis 29. September 2023 versammelten sich Expert*innen von Universitäten, Hochschulen, Schulverwaltungen und weiteren Bildungsinstitutionen aus dem deutschsprachigen Raum, um über zukunftsweisende Konzepte und Herausforderungen in der Lehrkräftebildung zu diskutieren.
Unter dem Motto „Wegmarken für eine zeitgemäße Lehrkräftebildung – Konzeptionelle Ansätze im Fokus“ befassten sich die Teilnehmer*innen auf der Tagung mit sechs wichtigen Themenschwerpunkten: Agilität, Digitalisierung, Kooperation, Mobilität, Reflexion und Teacher Wellbeing.
Ausgehend von diesen Schwerpunkten bot der BuKo 2023 eine fachübergreifende Keynote, 21 Vorträge und 6 Workshops sowie 5 Netzwerkgruppen und zudem eine phasen- und institutionenübergreifende Podiumsdiskussion zum Thema Lehrkräftemangel.
Dieser Tagungsband bietet eine Auswahl der Konzepte, die während des BuKo 2023 vorgestellt wurden. Die beitragenden Autor*innen bieten innovative Ansätze und praxisorientierte Lösungen für die Lehrkräftebildung innerhalb der vordefinierten Themenschwerpunkte.
Die Herausgeber*innen begrüßen die die inhaltliche Vielfalt und Reichweite der Beiträge, welche sowohl die aktuellen Herausforderungen als auch die Zukunftsperspektiven der Lehrkräftebildung beleuchten. Der Tagungsband richtet sich sowohl an Lehrkräftebildner*innen und Forscher*innen wie auch an Praktiker*innen, die an der Gestaltung der Lehrkräftebildung interessiert sind und nach inspirierenden Ansätzen für ihre Arbeit suchen.
BEITRÄGE
Simone Baumann: Profession(alisierung) durch Reflexion und Proflexion
Abstract
Profession(alität) von Lehrpersonen basiert nicht nur auf ‚Wissen und Können‘, sie hängt zudem u.a. damit zusammen, wie eine Lehrperson sich selbst (durch ihre (Bildungs-)Biografie) beschreibt (Kelchtermans, 1993; Shulman, 1986; Weinert, 2001). Die (angestrebte) Identität einer Lehrperson vereint somit vielfältige Eigenschaften und entwickelt diese im Laufe ihrer (Bildungs-)Biografie stetig weiter. (Angehende) Lehrpersonen müssen Möglichkeiten erhalten, ihre (persönliche und berufliche) Identität zu stärken und (weiter) zu entwickeln, ihr Erfahrungswissen zu reflektieren (Franke, 2005) und entlang des Aufbaus von ‚Wissen und Können‘ zu proflektieren (Fischer, 2007), damit sie Bezogenheit (Birkenbeil, 1987), Verständnis sowie Sinn- und Bedeutungsgehalt von professionsspezifischem Wissen und ihrem Tun herstellen können (Baumann, 2023). Der Beitrag diskutiert, ausgehend von einem mehrperspektivischen Professionalisierungsansatz, den Stellenwert von Reflexion und Proflexion und stellt in dem Zusammenhang ein dreidimensionales Reflexionsmodell vor. Hiernach wird konzis konturiert, wie Reflexion(skompetenz) systematisch angeleitet werden kann.
Erste Seite: 1
Letzte Seite: 11
https://doi.org/10.37626/GA9783959872843.0.01
=====================================================
Dagmar M. Benincasa, Jan Springob & Ina Berninger: Am Puls der Zeit! Eine phasenübergreifende Lehrer*innenbildung als Weg zu gelebter Theorie-Praxis-Verzahnung und tatsächlicher Zukunftsorientierung
Abstract
Der konzeptionelle Ansatz der Erasmus+ Teacher Academy „Teacher Education for a Future in Flux” (teff) zielt auf eine transdisziplinäre, internationale, zukunftsorientierte und phasenübergreifende Ausgestaltung der Lehrer*innenbildung sowie die nachhaltige, kontinuierliche Professionalisierung von Lehrkräften ab. Um die Potenziale einer phasenübergreifenden Lehrer*innenbildung zu erschließen, werden in diesem Artikel, aufbauend auf eine erste Forschungsarbeit, Ergebnisse einer Gruppendiskussion mit Akteur*innen der Lehrer*innenbildung aus ganz Deutschland präsentiert, die Möglichkeiten und Herausforderungen der Umsetzung phasenübergreifender Angebote fokussiert. Zur Analyse der qualitativen Daten wurden induktive und deduktive Methoden eingesetzt. Die Untersuchung legt die Notwendigkeit eines institutionellen Daches nahe, unter dem Lehramtsstudierende, Referendar*innen und Lehrkräfte zusammenkommen können, um gemeinsame Lern-möglichkeiten in einer strukturierten theorie- und praxisorientierten Weise wahrzunehmen, die sich auf übergreifende, für alle Phasen relevante Themen konzentrieren. Die starre Trennung der drei Phasen, insbesondere der universitären Lehrer*innenausbildung und der berufsbegleitenden Fortbildung, erscheint überholt und wird dem umfassenden Verständnis der heutigen, ständig und in hohem Maße vernetzten Welt nicht gerecht. Begegnungsorte wie die teff-Akademie stellen sich den Herausforderungen im Rahmen partizipativer und agiler Formate, die den Akteur*innen aller drei Phasen offenstehen.
Erste Seite: 12
Letzte Seite: 22
https://doi.org/10.37626/GA9783959872843.0.02
=====================================================
Björn Bulizek, Nina Harsch, Matthias Kostrzewa & Mechthild Wiesmann: Teilen und Mitgestalten – Kooperation und Agilität als Leitgedanke im Universitätsverbund digiLL
Abstract
Seit seiner Gründung 2016 verfolgt der Universitätsverbund für digitales Lehren und Lernen in der Lehrer/-innenbildung (digiLL) das Ziel, digitalisierungsbezogene Kompetenzen von Akteur*innen aller Phasen der Lehrer*innenbildung zu fördern und ein bundesweites Netzwerk zur Stärkung des standortübergreifenden Lernens und Lehrens in einer Kultur der Digitalität auf- und auszubauen. Im Zentrum steht dabei die Entwicklung und Bereitstellung von Lernmodulen als Open Educational Resources (OER), welche die Expertise von mittlerweile bundesweit elf beteiligten Standorten zusammentragen und frei zugänglich machen. Alle Lernmodule durchlaufen dabei einen umfangreichen Qualitätssicherungsprozess. Für die erfolgreiche Zusammenarbeit im Verbund sind besonders die agilen und kooperativen Strukturen und Prozesse zentrale Faktoren. Dabei agiert der Verbund als Community of Practice (CoP) im Sinne von Open Educational Practices (OEP) und es haben sich offene Bildungspraktiken durch enge Kollaborationen und orts- und systemunabhängige Arbeitsprozesse (weiter-)entwickelt. Im Beitrag möchten wir aufzeigen, welche Vorteile und Chancen eine solche, gemeinsam wertschätzende, kollegiale und kooperative Zusammenarbeit mit sich bringt und welchen Gelingensbedingungen diese unterliegen. Zudem möchten wir Einbindungsmöglichkeiten des digiLL-Angebots in die eigene Arbeit und Lehre vorstellen, einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen geben sowie weitere Zentren für Lehrer*innenbildung bzw. Schools of Education ermutigen, aktiv am Verbund zu partizipieren.
Erste Seite: 23
Letzte Seite: 29
https://doi.org/10.37626/GA9783959872843.0.03
=====================================================
Fatima Chahin-Dörflinger, Ansgar Klinger, Saskia Koltermann & Jens Winkel: Zeitgemäße Lehrkräftebildung – mit dem Referenzrahmen Schulqualität
Abstract
Die Referenzsysteme der Länder zur Schulqualität formulieren klare Antworten auf die zentrale Frage des Kongresses „Wegmarken für eine zeitgemäße Lehrkräftebildung“ über die zukunftsfähige Aus- und Fortbildung von (angehenden) Lehrkräften. Im ersten Teil des Beitrags soll exemplarisch verdeutlicht werden, welche zentralen Dimensionen schulischer Qualität insbesondere in Deutschland von Bedeutung sind. Am Beispiel der Referenzrahmen aus Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg wird die Struktur und Funktion solcher Rahmen verdeutlicht. Im zweiten Teil wird aufgezeigt, wie allen an Schule Beteiligten Materialien zur Unterstützung der inneren Schulentwicklungsprozesse auf der Basis des Referenzrahmens Schulqualität NRW zur Verfügung gestellt werden. Im dritten Teil wird überprüft, ob solche Referenzsysteme für die Zielfindung im Kontext der Fragestellungen für Projekte im Forschenden Lernen eingesetzt werden können. Zudem soll diskutiert werden, ob sie eine Anregung für die Diskussion von Schulqualität in Zentren für Lehrerbildung und Schools of Education sein könnten.
Erste Seite: 30
Letzte Seite: 38
https://doi.org/10.37626/GA9783959872843.0.04
=====================================================
Matthias Conrad & Stephan Schumann: Das Konstanzer Konzept „edu 4.0“ zur Förderung von digitalisierungsbezogenen Kompetenzen im Lehramtsstudium
Abstract
Die Förderung von digitalisierungsbezogenen Kompetenzen angehender Lehrkräften ist das erklärte Ziel des Entwicklungsprojekts „edu 4.0“. Das hierfür an der Universität Konstanz entwickelte Konzept verfolgt vier ineinandergreifende Ziele, um die Professionalisierung von Hochschuldozierenden in diesem Bereich voranzutreiben. Die im Projektverlauf initiierten Maßnahmen und Angebote beinhalten den Aufbau von Inhouse-Expertise im Bereich Digitalisierung, die Entwicklung von digitalisierungsbezogenen Lehr- und Lernformaten sowie die Durchführung von begleitenden Forschungsprojekten. In diesem Zusammenhang wurde ein Rahmenmodell des professionellen Handelns in der digital-gestützten Lehre von Hochschuldozierenden in der Lehrkräftebildung entwickelt, welches sowohl digitalisierungsbezogenes Wissen und Fertigkeiten von Dozierenden als auch damit einhergehende Einstellungen und Überzeugungen umfasst. Das Modell bildet die Grundlage für die Entwicklung und Durchführung aktueller und zukünftiger digitalisierungsbezogener Lehr- und Weiterbildungs-angebote in der Lehramtsausbildung.
Erste Seite: 39
Letzte Seite: 47
https://doi.org/10.37626/GA9783959872843.0.05
=====================================================
Jens Damköhler, Markus Elsholz & Thomas Trefzger: Förderung der Reflexionskompetenz angehender Physiklehrkräfte im Lehr-Lern-Labor
Abstract
Die Fähigkeit und Bereitschaft zur Reflexion eigenen unterrichtlichen Handelns, in den vergangenen Jahren oft als Reflexionskompetenz modelliert, wird häufig als eine Grundlage der Professionalisierung von Lehrkräften angesehen. So nimmt die Förderung der Reflexionskompetenz in der Ausbildung angehender Lehrkräfte eine zentrale Rolle ein. Im Würzburger Lehr-Lern-Labor-Seminar (LLL-Sem) im Fach Physik absolvieren Studierende des Lehramts nach einer Vorbereitungszeit insgesamt drei Praxistage im Abstand von jeweils zwei Wochen. Im Rahmen dieser Praxistage betreuen sie bis zu 8 Schüler:innen an selbst entwickelten Experimentierumgebungen. Zwischen den einzelnen Praxis tagen finden Phasen der Überarbeitung und Reflexion statt. Darüber hinaus erhalten die Studierenden in diesen Phasen reflexionsbezogenen Input, wie eine „Reflexionsschulung“ oder ein „Noticing-Training“. Im Rahmen eines begleitenden Dissertationsprojekts werden Aspekte der Reflexionskompetenz sowie deren Entwicklung in der Praxisphase des LLL untersucht. Die Beurteilung der Qualität einer Reflexion spielt dabei eine zentrale Rolle. So wird unter anderem den Fragen nach dem Verhältnis von Selbst- und Fremdreflexionsprozessen nachgegangen.
Erste Seite: 48
Letzte Seite: 57
https://doi.org/10.37626/GA9783959872843.0.06
=====================================================
Anne Fett, Peter Grüttner, Elena Reichelt & Norman Sträßer: Interkulturelle Professionalisierung durch selbstgeleitete und kooperative E-Portfolio-Arbeit in allen Mobilitätsphasen
Abstract
Das Zertifikatsangebot LAIK (Lehramt Interkulturell), das im Rahmen des DAAD-Projekts “Internationalisierung der Lehrer*innenbildung” entwickelt und implementiert wurde, bietet Lehramtsstudierenden ein neuartiges strukturiertes Reflexionsangebot für die Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung von Auslandsaufenthalten (Studium, Praktikum, kombinierte Aufenthalte): Das auf der ursprünglich quelloffenen Lernumgebung Mahara basierende Tool, welches durch einen Pilotdurchgang auf die Bedürfnisse Lehramtsstudieren-der zugeschnitten wurde, ermöglicht diesen die Arbeit an einem E-Portfolio während aller Mobilitätsphasen. Durch LAIK treten Studierende in einen Prozess interkultureller Selbstreflexion ein, der sowohl im sicheren, privaten Raum als auch in kollegialer Fallberatung mit anderen Studierenden (Tandem-Feedback) erfolgt – und in den Mentor*innen der Heimatuniversität sowie Betreuende im Ausland digital eingebunden werden. Dieser Prozess fördert ein Bewusstsein für die eigenen kulturellen Prägungen und verdeutlicht die Mehrdimensionalität von Unterricht in interkulturellem Kontext. Auch während des Aufenthalts entwickeltes Material kann geteilt und mit Studierenden sowie Mentor*innen reflektiert werden. Die interkulturelle Professionalisierung Lehramtsstudierender erfolgt innerhalb von LAIK eingebettet in einen gleichsam selbstgeleiteten und begleiteten Reflexionsprozess, der die “Wegmarken” von Digitalisierung, Reflexion, Kooperation und Mobilität integriert und ein Best-Practice-Beispiel zukunftsfähiger Kompetenzentwicklung darstellt.
Erste Seite: 58
Letzte Seite: 67
https://doi.org/10.37626/GA9783959872843.0.07
=====================================================
Lena Geuer, Claudia Gómez Tutor, Frederik Lauer, Norbert Wehn & Roland Ulber: Kooperationsstrukturen an vernetzten Schnittstellen entlang der Lehrkräftebildungskette
Abstract
Die aktuellen Herausforderungen benötigen eine enge Zusammenarbeit aller Beteiligten im Bereich der Lehrkräftebildung, um gerechte Bildungschancen und eine angemessene Vorbereitung auf die Anforderungen der digitalen Welt sicherzustellen. Die damit verbundene Transformation erfordert eine effektive Vernetzung und Zusammenarbeit sowie die Pflege von Schnittstellen, um einen reibungslosen Transfer von Wissen und Bausteinen sowohl interdisziplinär als auch interinstitutionell zu ermöglichen. Dies ist entscheidend, um alle Aspekte im Mehrebenensystem der Lehrkräftebildung zu adressieren. Das Projekt „Unified Education: Medienbildung entlang der Lehrerbildungskette (U.EDU)“ hat dazu Strategien und Wege auf der vertikalen und horizontalen Ebene der Lehrkräftebildung entwickelt. Diese Ansätze sind strukturell in die drei Phasen der Lehrkräftebildung integriert, um eine ganzheitliche Lösung zu gewährleisten.
Erste Seite: 68
Letzte Seite: 78
https://doi.org/10.37626/GA9783959872843.0.08
=====================================================
Kirsten Gronau, Annika Zarrath, Sarah Paschelke & Ulrike-Marie Krause: Die Rolle agiler Prozesse bei der digitalen Transformation in der Schule: Ergebnisse einer Interviewstudie
Abstract
Agilität hat das Potenzial, viele Herausforderungen von Schulentwicklung, z. B. im Bereich der Digitalisierung, zu adressieren. Eine Befragung von insgesamt zwölf Schulleitungen, schulischen Digitalisierungsbeauftragten und medienpädagogischen Berater*innen aus Niedersachsen ergab, dass an den Schulen der Befragten bereits eine Mischform zwischen agiler und klassischer Schulentwicklung praktiziert wird, aber agile Methoden besonders im Umgang mit Heterogenität und Motivation bei Zusammenarbeit, Entscheidungsfindung und Partizipation noch besser eingesetzt werden können. Unter Berücksichtigung dieser Erkenntnisse wurde innerhalb eines Projekts zum Thema Digitalisierung in der Lehrkräftebildung in einem Design-Thinking-Prozess eine Fortbildung entwickelt, die Schulleitungen, schulische Digitalisierungsbeauftragte und Kollegien bei der Nutzung agiler Prozesse für die digitale Transformation an der Schule unterstützt.
Erste Seite: 79
Letzte Seite: 88
https://doi.org/10.37626/GA9783959872843.0.09
=====================================================
Anne Laaredj-Campbell & Richard Powers: eTwinning for Future Teachers: Digitale Projektarbeit international und interkulturell gestalten in der Lehrkräfteausbildung mit Erasmus+ eTwinning
Abstract
In einer zunehmend globalisierten Welt befinden sich Schule und Unterricht in einem ständigen Wandel. Was in der Vergangenheit funktioniert hat, funktioniert vielleicht heute oder in Zukunft nicht mehr. Das bedeutet, dass die Zukunft der Bildung über das traditionelle Klassenzimmer hinausgehen muss. Es ist entscheidend, dass wir Lernerfahrungen schaffen, die sich an den persönlichen und beruflichen Werdegang der einzelnen Person anpassen und gleichzeitig durch kollaboratives Arbeiten einen Sinn für die Gemeinschaft schaffen. Umso wichtiger ist es, angehenden Lehrkräften internationale Erfahrungen und interkulturelle Kenntnisse zu vermitteln. Dies wiederum wirft eine Reihe wichtiger Fragen auf, wie zum Beispiel: Was brauchen Lehrkräfte, um sich auf diese Entwicklung vorzubereiten? Welche Rolle spielt die digitale Projektarbeit bei der Unterstützung dieses Wandels? Hier können Erasmus+ und eTwinning eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Unterrichtsqualität spielen. Mit eTwinning-Projekten können künftige Lehrkräfte zugleich ihr digitales Know-how erweitern, ihren Unterricht authentischer gestalten und ihre Schulklassen effektiver begleiten. Internationalisierung ist ein zentraler Baustein für die Weiterentwicklung der Lehramtsausbildung.
Erste Seite: 89
Letzte Seite: 94
https://doi.org/10.37626/GA9783959872843.0.10
=====================================================
Kathrin Maleyka & Melanie Korn: ‚Dem Beruf (m)ein Gesicht verleihen‘ – Reflektierte Profilierung als Anspruch zeitgemäßer und nachhaltiger Lehrkräftebildung am ZfL Kiel
Abstract
Der Beitrag beleuchtet das Potenzial eines einheitlichen Selbstverständnisses aller Zentren für Lehrkräftebildung. Am konkreten Beispiel des Kieler Konzepts ‚Dem Beruf (m)ein Gesicht verleihen‘ wird ausgeführt, dass individuelle Persönlichkeits- und Professionalitätsentwicklung Lehramtsstudierender ein Element eines solchen Selbstverständnisses sein kann. Ausgehend hiervon wird angeregt, dass sich auch Zentren stärker profilieren, indem sie sich als learning community und als Impulsgeber für eine zeitgemäße und nachhaltige Lehrkräftebildung verstehen.
Erste Seite: 95
Letzte Seite: 103
https://doi.org/10.37626/GA9783959872843.0.11
=====================================================
Zina Maria Morbach, Inga Steinbach, Ruth Maria Mell & Wiebke Nierste: Glokal denken – Glokal handeln! Internationalisierung und Nachhaltigkeit in der universitären Lehrkräftebildung – Ein Werkstattbericht des Workshops auf dem BuKo 2023
Abstract
Die Sicherung von Nachhaltigkeit in der Internationalisierung von Lehramtsstudiengängen stellt Universitäten vor zahlreiche Herausforderungen: so ist zwischen der Wichtigkeit persönlicher internationaler Begegnungen und der Reduktion des institutionellen ökologischen Fußabdrucks zu vermitteln, Lernerfahrungen zahlreicher Beteiligter sind nachhaltig zu sichern und institutionelle Kooperationen mit einer dauerhaften Perspektive zu etablieren. Der in Kooperation von Lehramt.International-Projekten aus Gießen, Marburg und Darmstadt angebotene Workshop hat im Rückgriff auf Praxiserfahrungen ausgewählte projektrelevante Facetten des Zusammenhangs von Internationalisierung und Nachhaltigkeit aufgegriffen. Es geht darum, Nachhaltigkeit im Sinne einer auf die breite Internationalisierung der Lehrkräftebildung zugespitzten Differenzierung inhaltlicher, institutioneller und zukunftsorientierter Faktoren zu verstehen. Im Workshop wurde im Anschluss an einen kurzen Input zur thematischen Einordnung Raum für den Erfahrungsaustausch und die Entwicklung weiterführender Perspektiven unter folgenden Schwerpunkten angeboten: 1) Bildung für nachhaltige Entwicklung als Gegenstand im inter-nationalen Setting, 2) Nachhaltigkeit und virtual/blended/short-term mobility, 3) Nachhaltige Internationalisierungsstrategien in der Lehrkräftebildung, 4) Nachhaltige Sicherung von (transkulturellen) Lernerfahrungen.
Erste Seite: 104
Letzte Seite: 115
https://doi.org/10.37626/GA9783959872843.0.12
=====================================================
Nico Noltemeyer & Rina Martina Ferdinand: Die Vermittlung digitalisierungsbezogener Kompetenzen: Good Practice mit Lehrkräften in der ersten Phase und Actionbound
Abstract
Der vorliegende Beitrag gibt Einblick in ein Seminarkonzept, das im Rahmen des BMBF-geförderten Projektes ‚Digitalisierung in der Oldenburger Lehrerinnen- und Lehrerbildung‘ (DiOLL) entstanden ist. Das Konzept greift die Kompetenzformulierungen des Kultusministeriums zur ‚Bildung in der digitalen Welt‘ auf, indem Studierende mit Hilfe der Anwendung Actionbound und Materialien aus dem Bildungsprojekt IT2School der Wissensfabrik ein eigenes Projekt entwerfen und durchführen. Im Sommersemester 2023 wurde dieses Seminarkonzept praktisch erprobt und forschend begleitet. Der Beitrag schließt mit der Reflexion dieser Forschungsergebnisse.
Erste Seite: 116
Letzte Seite: 123
https://doi.org/10.37626/GA9783959872843.0.13
=====================================================
Lea Schröder & Lea Schulz: Online Lernmodule zur Gestaltung eines diklusiven Unterrichts für die Lehrkräftebildung
Abstract
Um den Unterricht an eine heterogene Schüler*innenschaft zu adaptieren, können digitale Medien eine Unterstützung darstellen. Sie können genutzt werden, um z. B. Lernstände aufzuzeigen, individuell zu unterstützen und zu-künftige Lernschritte vorzuschlagen (Fichtner et al., 2023; Schulz, 2018). Dennoch können auch neue Barrieren entstehen, die eine Teilhabe für alle am Unterricht erschweren. Daher ist es wichtig, Lehrkräfte auf den diklusiven (digital-inklusiven) Unterricht vorzubereiten (Böttinger & Schulz, 2023).
Das Projekt „inklusiv.digital“ entwickelt OER-Modulbausteine für Studierende und Lehrkräfte verschiedener Fachdidaktiken sowie zentraler Themen zum Lernen und Lehren mit digitalen Medien in inklusiven Settings. In einem interdisziplinären Team entwickeln Expert*innen aus den Bereichen der Fachdidaktiken, der Sonderpädagogik, der Inklusionspädagogik sowie der Medien-pädagogik die Bausteine didaktisch und bereiten sie für diklusive Unterrichtssettings auf. Ziel ist es, die Aus-, Fort- und Weiterbildung im Kontext der Qualifizierung von Lehrkräften für diklusiven Unterricht zu unterstützen.
Der modulare Aufbau der Lernmaterialien, kombiniert mit der Flexibilität einer offenen CC-BY-Lizenz, ermöglicht ihre Anwendung in verschiedenen Lernformaten, wie Selbstlernkursen und begleitetem Blended-Learning. Die Inhalte der Module vermitteln spezifisches Wissen für den diklusiven Unterricht, das für angehende Lehrkräfte von essenzieller Bedeutung ist. Darüber hinaus sind sie so gestaltet, dass auch Personen ohne spezifische Fachkenntnisse die Inhalte nachvollziehen und in ihrem eigenen Unterricht umsetzen können. Die Integration dieser Module in eine bundesweite OER-Plattform ist geplant, um einen breiten und einfachen Zugang zu ermöglichen.
Erste Seite: 124
Letzte Seite: 134
https://doi.org/10.37626/GA9783959872843.0.14
=====================================================
Adeline Weinberg & Simone Mattstedt: Interkulturelle und professionelle Kompetenzen kombiniert: Schulpraktika im Ausland
Abstract
Um dem bildungspolitischen Anliegen nach Stärkung der interkulturellen Kompetenzen von (angehenden) Lehrkräften nachzukommen, bietet das Zentrum für Lehrerbildung der Universität Münster (ZfL) seit einigen Jahren zahlreiche Möglichkeiten für Auslandspraktika an. Dazu zählen Kurzzeitpraktika sowie freiwillige Praktika im Lehramtsbachelorstudium als auch neuerdings das Praxissemester im Masterstudium. Um die Kompetenzziele erfüllen und die Qualität der Begleitung gewährleisten zu können, erfolgt ein intensiver Aus-tausch und in Teilen sogar eine Kooperation mit ausgewählten Schulen sowie ein umsichtiges Beratungs- und Begleitangebot bereits im Vorfeld des Auslandsaufenthalts. Dabei werden alle Beteiligten der Institutionen und Lernorte im Praxissemester eingebunden. Ein spezielles Begleitangebot in den Bildungswissenschaften sowie seitens der schulpraktischen Ausbildungsinstitution nimmt direkten fachlichen Bezug zum Auslandsaufenthalt. Die Erfahrungen sind positiv, wenn auch sensible und kritische Fragen gestellt werden.
Erste Seite: 135
Letzte Seite: 144
https://doi.org/10.37626/GA9783959872843.0.15
=====================================================
Christina Wurst, Tim Fütterer & Annika Goeze: Digitale Medien im Fachunterricht: Innovative Konzeption einer forschungsbasierten Onlinefortbildung zum lernwirksamen Ein-satz digitaler Medien in der pädagogischen Praxis
Abstract
In diesem Beitrag wird ein Konzept für Lehrkräftefortbildungen zum forschungsbasiert lernwirksamen Einsatz digitaler Medien im Fachunterricht (moderne Fremdsprachen und Naturwissenschaften) vorgestellt. Das Konzept zielt darauf ab, auf zentrale Herausforderungen und Desiderate der Lehrkräftefortbildung konzeptionelle Antworten anzubieten. Die rein digitale Fortbildung wurde als mehrwöchige Reihe mit u.a. synchronen Online-Austausch-Runden in Professional Learning Communities und asynchronem Selbststudium entwickelt (insg. mind. 18 Std.). Bei der Entwicklung des Konzeptes wurde auf eine starke, iterative Verflechtung von Forschung und Praxis gesetzt: Im Sinne des Design-Based Research Ansatzes wurden Fachleiter-, Fachdidaktiker- und Lehrer*innen bei der Erarbeitung, Gestaltung und Evaluation der Inhalte, Materialien und Abläufe einbezogen. U. a. wurden Video-Fallvignetten geskriptet und verfilmt („staged videos“), um Einsatzmöglichkeiten digitaler Medien durch einen Vergleich zwischen „conventional practice” und „good practice“ in den Fortbildungen veranschaulichen und diskutieren zu können. Der Beitrag thematisiert nach vier Durchführungen erste Evaluationsdaten auf der Reaktionsebene der Teilnehmer*innen.
Erste Seite: 145
Letzte Seite: 154