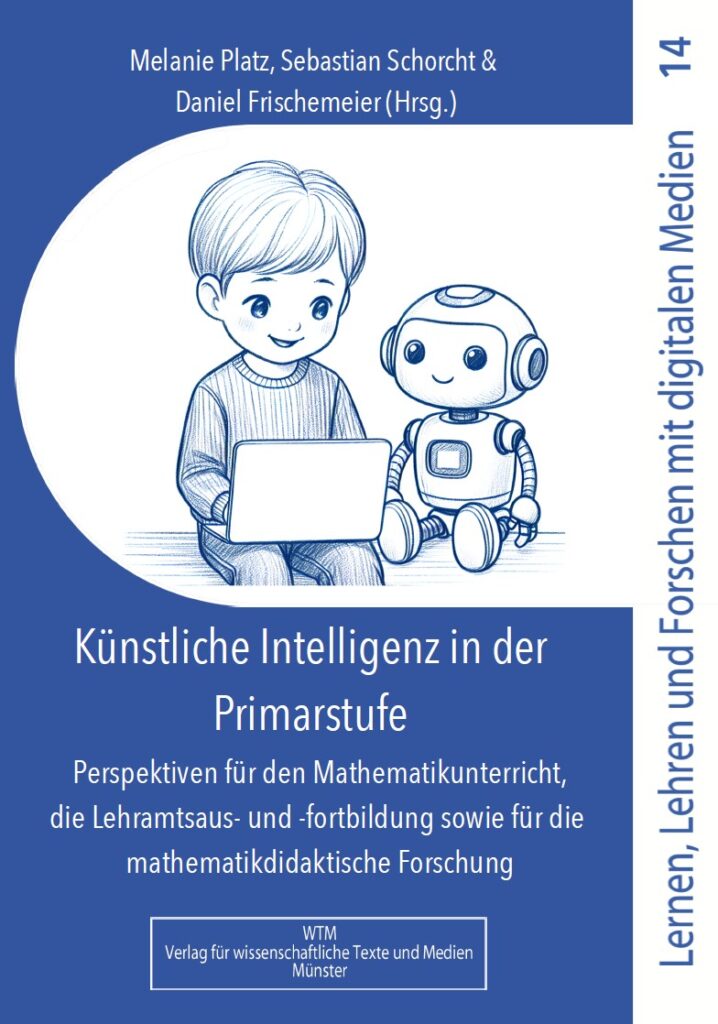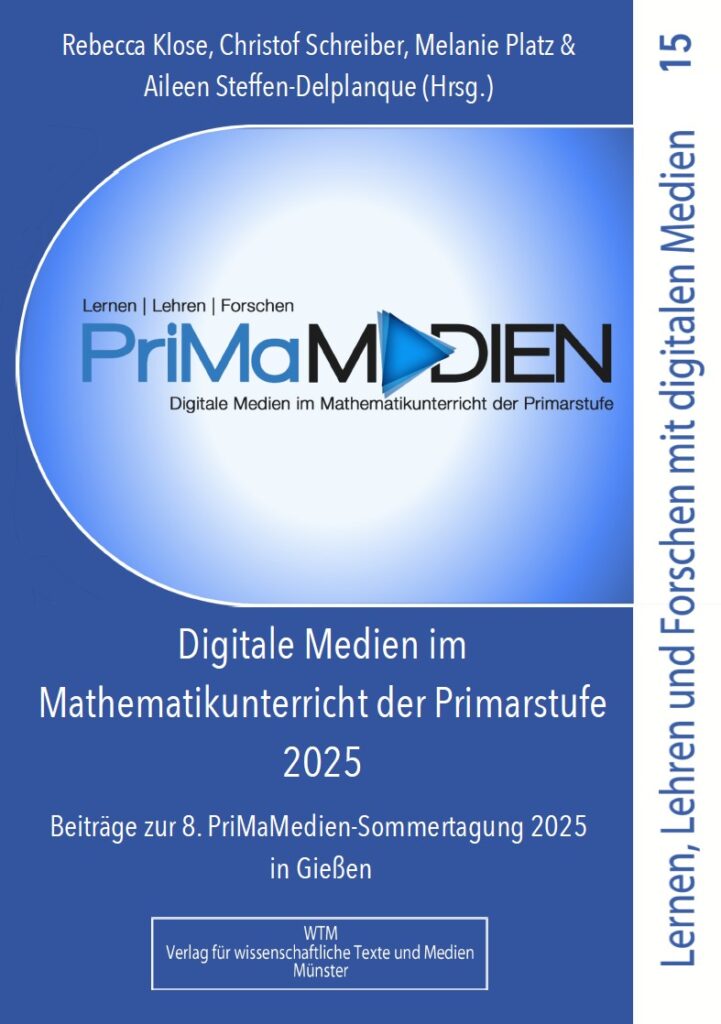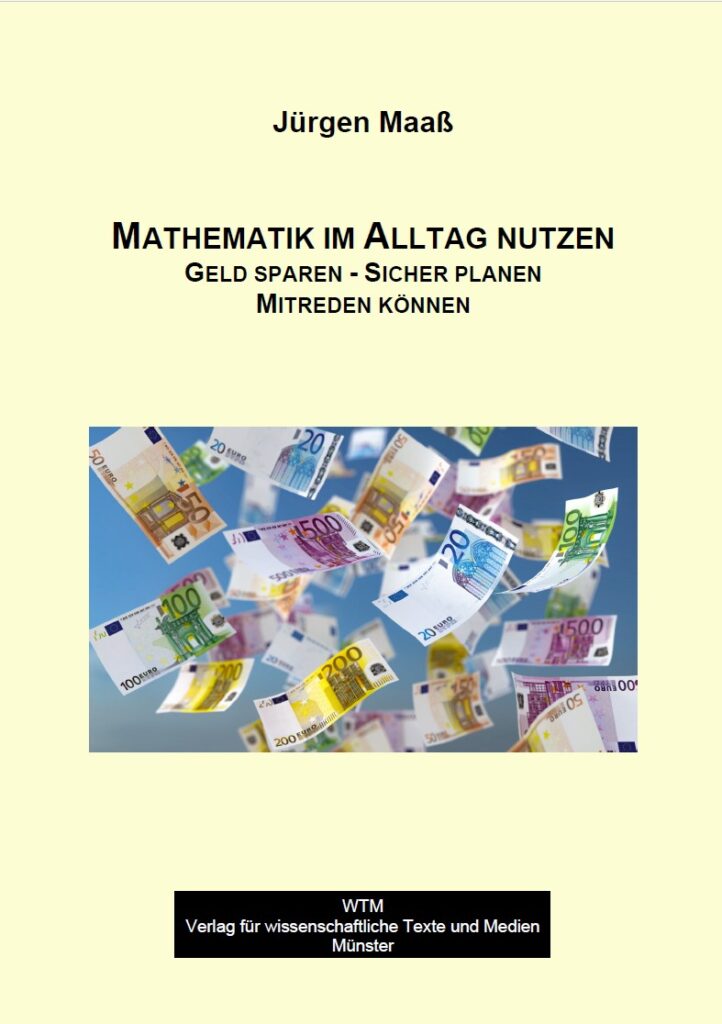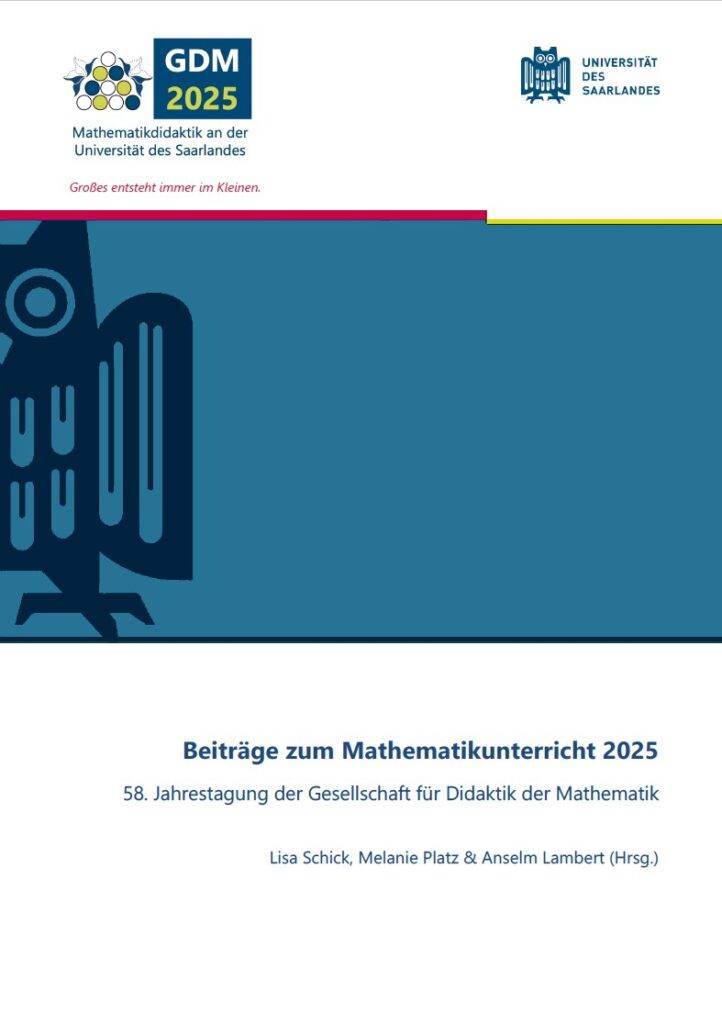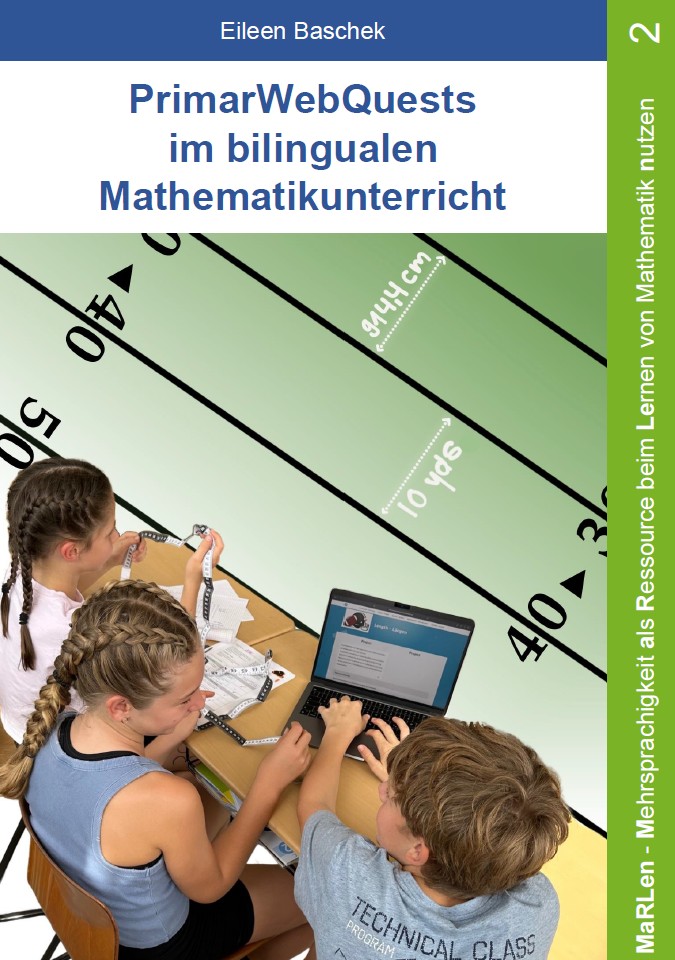Band 10 der Reihe Festschriften der Mathematikdidaktik
Münster 2025, ca. 210S.
978-3-95987-223-2 Print 34,90 €
978-3-95987-224-9 E-Book 31,90 €
https://doi.org/10.37626/GA9783959872249.0
Für Bestellungen bei edition-buchshop –> hier klicken
Mit dieser Festschrift anlässlich ihres 65. Geburtstages würdigen wir Dagmar Bönig und ihr herausragendes Wirken in der Mathematikdidaktik. In den vergangenen Jahrzehnten hat sie mit zahlreichen Projekten die mathematische Bildung im Primar- und Elementarbereich sowie die Aus- und Fortbildung von Lehrkräften maßgeblich geprägt. Als Professorin beeinflusste sie mehrere Studierendengenerationen und damit auch zahlreiche heute praktizierende Lehrkräfte. Dabei zeichnet sie sich stets durch ihre wertschätzende und offene Haltung gegenüber kindlichen Ideen aus, die sie ihren Studierenden vorlebt. Die Festschrift vereint eine vielfältige Sammlung von Beiträgen aus Wissenschaft und Praxis. Zu den Autor*innen zählen (ehemalige und aktuelle) Kolleg*innen, Lehrer*innen und Erzieher*innen, von denen viele bei Dagmar Bönig studierten, promovierten oder in Forschungsprojekten mit ihr zusammenarbeiteten. Herausgegeben wird der Band von den Mitgliedern der Arbeitsgruppe Mathematikdidaktik am Fachbereich 12 der Universität Bremen sowie den ehemaligen Mitgliedern Johanna Scharlau und Daniel Walter.
BEITRÄGE
Christiane Benz & Hedwig Gasteiger: Strukturierte Diagnose und Beobachtung grundlegender arithmetischer Basiskompetenzen in natürlichen Lernsituationen
Abstract
Um Kinder vor Schuleintritt beim Erwerb arithmetischer Basiskompetenzen in natürlichen Lernsituationen unterstützen zu können, müssen diese Basiskompetenzen von den Fachkräften in den Handlungen und Äußerungen der Kinder erkannt und eingeschätzt werden. Dafür wünschen sich Fachkräfte Unterstützung in Form von geplanten diagnostischen Spielen oder pädagogischen Situationen, die präzise Beobachtungen und strukturierte Dokumentationen ermöglichen. Anhand von zwei natürlichen Lernsituationen werden diesbezüglich Umsetzungsmöglichkeiten vorgestellt.
Erste Seite: 7
Letzte Seite: 18
=====================================================
Yvonne Ates, Sandra Buljevic, Claudia Halfter, Anna Körner, Nikola Leufer & Imke Meyer: Zur Entwicklung des Bremer Bildungsplans für Kinder im Alter von 0 bis 10 Jahren – Bildungsbereich Mathematik
Abstract
Mathematisches Lernen beginnt lange vor dem Unterricht in der Grundschule. Der neue Bremer Bildungsplan – Bildungsbereich Mathematik – für Kinder im Alter von 0 bis 10 Jahren unterstreicht die Bedeutung früher mathematischer Bildung in besonderem Maße. In diesem Beitrag stellen wir die Struktur des Plans vor und zeigen mit Praxisbeispielen zum Thema Längen Umsetzungsmöglichkeiten für eine anschlussfähige mathematische Bildung in Kindertageseinrichtungen und Grundschulen auf.
Erste Seite: 19
Letzte Seite: 28
=====================================================
Kathrin Effenberger, Anna Körner & Bernadette Thöne: Mit Bilderbüchern in die Welt der Mathematik eintauchen – schon im Krippenalter!
Abstract
Die Bedeutung frühkindlicher mathematischer Bildung ist seit vielen Jahren unbestritten. Mittlerweile gibt es auch zahlreiche fachdidaktische Ideen für mathematisch gehaltvolle Aktivitäten im Elementarbereich. Für das Krippenalter lassen sich bisher allerdings nur wenige Praxisbeispiele finden. In diesem Beitrag möchten wir deshalb Bilderbücher zu verschiedenen inhaltlichen Leitideen vorstellen, mit denen schon die Allerjüngsten in die Welt der Mathematik eintauchen können, und von unseren Erfahrungen beim Einsatz dieser Bücher in der Krippe berichten.
Erste Seite: 29
Letzte Seite: 40
=====================================================
Jochen Hering, Monika London & Marcus Nührenbörger: Mathematisch reichhaltige Vorlese- und Spielzeit in der Kita: Mit dem Eichhörnchen auf der Suche nach den Nüssen
Abstract
Bilderbücher sind von besonderer Bedeutung für frühes mathematisches und sprachliches Lernen. Jedoch erfüllt nicht jedes Bilderbuch, in dem Dinge gezählt werden oder Zahlen vorkommen, die Anforderungen, wie sie Dagmar Bönig an eine substanzielle und kombinierte Förderung sprachlicher und mathematischer Bewusstheit legt. Der folgende Beitrag erörtert daher die fachlichen Hintergründe mathematisch und sprachlich reichhaltiger Bilderbücher und veranschaulicht das Potential am Beispiel des Bilderbuches ‚Fünf Nüsse für Eichhörnchen‘, das auf die Mathematik zählt, indem es von der Kunst erzählt, zu erkennen und sich daran zu freuen, was einem wichtig ist.
Erste Seite: 41
Letzte Seite: 52
=====================================================
Susanne Prediger, Corinna Hankeln & Lea Voss: Oberflächenübersetzung oder tiefgehende Darstellungsvernetzung? Digitale Diagnosen zum Multiplikationsverständnis von Kindern
Abstract
Operationsverständnis von Kindern lässt sich durch Darstellungswechsel-Aufgaben diagnostizieren. Als typische Schwierigkeit untersuchen wir Oberflächenübersetzungen (d.h. wenn Zahlen isoliert übersetzt, aber nicht die multiplikative Struktur vernetzt wird). Der Beitrag berichtet aus digital gestützten Diagnosen zum Multiplikationsverständnis von n = 238 Kindern der Klasse 5/6. Oberflächenübersetzungen tauchen insgesamt bei 92 % der Kinder mindestens einmal auf, und zwar in unterschiedlichen Darstellungen und Antwortformaten. Je häufiger Kinder Oberflächenübersetzungen durchführen, desto geringer ist ihre Gesamtpunktzahl im Test (r = – .67**). Oberflächenübersetzungen sagen auch andere Fehler voraus.
Erste Seite: 55
Letzte Seite: 65
=====================================================
Elisabeth Rathgeb-Schnierer & Stephanie Schuler: „Erfinde eine Rechengeschichte zur Aufgabe 13 ∙ 5“ –Operationsverständnis durch Darstellungswechsel erfassen
Abstract
Anknüpfend an den Befund, dass die Übersetzung eines Terms in eine Rechengeschichte für Schülerinnen herausfordernd ist, haben wir uns dazu entschieden, genau diese Übersetzung zum Thema des Beitrags zu machen. In mehreren Klassen des dritten und vierten Schuljahrs ließen wir anlässlich Dagmar Bönigs 65. Geburtstag Schülerinnen Rechengeschichten zur Aufgabe 13 · 5 schreiben. Dabei stellte sich uns die Frage, in welcher Weise dieser intermodale Transfer von Kindern vorgenommen wird und welche Grundvorstellungen der Multiplikation sich zeigen.
Erste Seite: 67
Letzte Seite: 76
=====================================================
Anna Körner & Nicoletta Sack: Zeichne ein Bild zur Aufgabe 15 : 5 = 3 – Operationsverständnis zur Division entwickeln
Abstract
Der Aufbau von Operationsverständnis zu den vier Grundrechenarten ist ein zentrales Ziel des Arithmetikunterrichts der Grundschule. Im vorliegenden Beitrag wird der Blick auf die Entwicklung des Divisionsverständnisses gerichtet. Nach einer einführenden theoretischen Einordnung stellen wir empirische Ergebnisse von Schüler*innen vor, die mehrfach im Grundschulverlauf darum gebeten worden sind, eine Zeichnung zu einer vorgegebenen Divisionsaufgabe zu erstellen. Abschließend werden Konsequenzen für den Mathematikunterricht diskutiert.
Erste Seite: 77
Letzte Seite: 86
=====================================================
Daniela Götze: Bedeutungsverschiebung des Wortes ‚teilen‘ bei der Behandlung der Division – Analyse konzeptueller Hürden von Grundschulkindern
Abstract:
Viele Lernende der Grund- aber auch der weiterführenden Schule zeigen Schwierigkeiten beim Erkennen und Benennen von Divisionsaufgaben in anschaulichen Darstellungen. Die zugrunde liegenden Ursachen sind allerdings bisher wenig erforscht und Gegenstand des vorliegenden Beitrags. Anhand von drei Einzelfallanalysen wird aufgezeigt, dass Grundschulkinder typische ikonische Darstellungen der Division oftmals eher additiv zerlegend deuten und dies mit der Division gleichsetzen. Die Ursache kann durch die möglicherweise ungeklärte Bedeutungsverschiebung des Wortes ‚teilen‘ von additiv zerlegenden zu dividierenden Darstellungen erklärt werden.
Erste Seite: 87
Letzte Seite: 96
=====================================================
Silke Ruwisch & Cathleen Heil: Mathematikunterricht, der wirklich bewegt ─ Anlässe zum Modellieren unter freiem Himmel
Abstract:
Auch in den eher kognitiv geprägten Mathematikunterricht lassen sich Bewegungsanlässe sinnstiftend integrieren. Zwar kann Bewegung auch eine lernbegleitende, vom mathematischen Lernen losgelöste Funktion haben. Bewegung kann aber auch themenerschließend für den mathematischen Lerngegenstand selbst sein, insbesondere, wenn sie notwendiger Teil eines Modellierungsprozesses im Realraum ist. Im Artikel werden konkrete Beispiele dargestellt, die die Idee der bewegten Auseinandersetzung mit Mathematik im Rahmen von Modellierungsprozessen konkretisieren.
Erste Seite: 97
Letzte Seite: 106
=====================================================
Günther Krauthausen, Johanna Scharlau & Daniel Walter: “Ab ins Archiv“: Erkunden einer Gewinnstrategie zum NIM-Spiel
Abstract:
Das NIM-Spiel ist ein Klassiker in der Mathematikdidaktik. Es bietet reichhaltige Gelegenheiten zur Förderung prozessbezogener Kompetenzen, indem es vor allem Kommunikations- und Argumentationsanlässe bereitstellt. Neue Chancen bietet eine digitalisierte Umsetzung des Spiels – die App ‚NIM‘. Insbesondere eröffnet das sogenannte Archiv Möglichkeiten zur differenzierten Spielanalyse. Praxiserprobungen legen Denk- und Nutzungsweisen von Kindern aus dritten und vierten Klassen offen.
Erste Seite: 107
Letzte Seite: 116
=====================================================
Jonathan von Ostrowski & Christian Hunold: Würfelnetze finden mit Polypad – prozessbezogene Kompetenzen fördern
Abstract
Die Auseinandersetzung mit Würfelnetzen ist ein zentraler geometrischer Inhalt des Grundschulmathematikunterrichts. Wie anhand der Aufgabe, alle Würfelnetze zu finden, die prozessbezogenen Kompetenzen gefördert werden können, wird in diesem Beitrag untersucht. Kinder aller vier Grundschuljahre nutzten für das Finden und Dokumentieren der Würfelnetze die Plattform Polypad.
Erste Seite: 117
Letzte Seite: 128
=====================================================
Petra Scherer, Elke Söbbeke & Lara Sprenger: Zur Gestaltung eines inklusiven Mathematikunterrichts – Flexible substanzielle Lernangebote in flexiblen unterrichtlichen Settings
Abstract
Die Gestaltung eines inklusiven Mathematikunterrichts stellt vielfältige Anforderungen, um für alle Lernenden erfolgreiches Mathematiklernen zu realisieren. Es gilt, sowohl individuelle Lernprozesse als auch Situationen des gemeinsamen Lernens zu ermöglichen. Dabei sind neben der Berücksichtigung der Individualität auch übergreifende gemeinsame Ziele im Blick zu behalten. Der Beitrag präsentiert zunächst geeignete Lernsettings für den inklusiven Mathematikunterricht, um anschließend zur zentralen Leitidee ‚Muster und Strukturen‘ ein ausgewähltes Lernsetting zum Thema ‚Figurierte Zahlen‘ vorzustellen. Die konkrete Lernumgebung wird durch Lernendendokumente illustriert und hinsichtlich ihrer Möglichkeiten für den inklusivenMathematikunterricht diskutiert.
Erste Seite: 129
Letzte Seite: 140
=====================================================
Kerstin Gerlach & Natascha Korff: Mathematikunterricht interdisziplinär stärken: Gemeinsam gestaltet es sich reflektierter
Abstract
In diesem Beitrag werden zwei mathematikdidaktische Themenfelder, die in Praxis und Forschung seit jeher interdisziplinär angelegt sind, wiederum zusammengedacht. An der konzeptuellen Verknüpfung von sprachsensiblem Fachunterricht (Mathematik- und Sprachdidaktik) und inklusivem Mathematikunterricht (Mathematik- und Inklusionsdidaktik) wird exemplarisch verdeutlicht, dass sich das Verstehen und Gestalten von Mathematikunterricht reflektierter gestaltet, wenn nunmehr drei Perspektiven vernetzt werden. Denn die Perspektiven ergänzen einander nicht nur, sondern fordern sich in ihrer Vernetzung auch wechselseitig zu Präzisierungen und Korrekturen heraus.
Erste Seite: 141
Letzte Seite: 151
=====================================================
Angelika Bikner-Ahsbahs & Christine Knipping: Das matelier: eine Raumkonzeption
Abstract
Das matelier der Universität Bremen ist ein mathematikdidaktisches Lehr-Lern-Labor mit einer ansprechenden Sammlung, welche das Interesse an Mathematik wecken soll. Dahinter steht eine dynamische Raumkonzeption, die wir in diesem Beitrag mit Bezug auf Lefebvre darlegen. Raum wird nach Lefebvre kontinuierlich als sozial produziert und reproduziert verstanden. Beispiele aus der Arbeit im matelier illustrieren diese Konzeption und zeigen, wie räumliche Praktiken das ursprüngliche Konzept erweitert haben. Das matelier als physischer und sozialer mathematikdidaktischer Raum umfasst heute auch virtuelle Komponenten. Zudem verbindet dieser Raum unterschiedliche Institutionen innerhalb der Universität wie auch in der Region. So entsteht ein Transferraum.
Erste Seite: 155
Letzte Seite: 164
=====================================================
Bernadette Thöne, Tobias Huhmann & Hartmut Spiegel: Lerngelegenheiten im ‚matelier unterwegs‘ und darüber hinaus – illustriert am Beispiel einer raumgeometrischen Aufgabenidee
Abstract:
Die Ausbildung angehender Lehrkräfte braucht Praxisphasen, werden doch hier Inhalte aus (fach-)didaktischen Veranstaltungen konkret erprobt und Erfahrungen mit lernenden Kindern gewonnen, die als eigene Lernchancen aufgegriffen und reflektiert werden können. In Bremen ermöglicht das ‚matelier unterwegs‘ Studierenden solche Erfahrungen mit Grundschulkindern. In diesem Beitrag stellen wir dieses Konzept vor und konkretisieren damit verbundene Lernchancen für Kinder und Studierende am Beispiel des Aufgabenformats ‚Unterwegs in der Würfelstadt‘. Dieses Aufgabenformat betrachten wir zudem im Hinblick auf seine Aufgabenqualität und zeigen mögliche Erweiterungen hin zu einer substanziellen Lernumgebung auf.
Erste Seite: 165
Letzte Seite: 176
=====================================================
Simone Reinhold & Bernd Wollring: „Bitte Pakete bilden!“ Texte von Kindern und Studierenden zum
Erkennen und Benennen von Einheiten in Fröbel-Arrangements
Abstract
Im Mittelpunkt dieses Beitrags stehen analoge und digitale Settings zu Würfelkonstruktionsaufgaben, die an Anregungen Fröbels anknüpfen und neben räumlichvisuellen Anforderungen auch arithmetische Betrachtungen von Teil-Ganzes-Beziehungen berühren. Grundschullehramtsstudierende sollten zunächst verbale Anleitungen für Kinder zur Erstellung von Schönheitsformen zur 3. Spielgaben geben, bevor Bautexte zur Programmierung von OpenSCAD, einem digitalen Tool, zu erstellen waren. Verschiedenartige Strukturierungsprozesse offenbaren die jeweiligen Lerngelegenheiten und Potenziale der Settings für Kinder und Studierende.
Erste Seite: 177
Letzte Seite: 188
=====================================================
Marianne Grassmann, Elke Mirwald & Roland Rink: „Das hätte ich nicht erwartet“ – Studierende ermitteln Lernausgangslagen von Grundschulkindern zu verschiedenen Größenbereichen
Abstract
Für die Festschrift zu Ehren von Dagmar Bönig verknüpfen wir die Themen ‚Größen im Mathematikunterricht der Grundschule‘ und ‚die Ausbildung von Grundschullehramtsstudierenden‘. In einer kleinen, nicht repräsentativen Untersuchung erkunden wir, inwiefern Studierende in der Lage sind, einzelne Aufgaben einer Lernausgangsanalyse zu Längen und Geldwerten den Anforderungsbereichen der Bildungsstandards und des Rahmenplans zuzuordnen und welche Schlussfolgerungen sie aus der ermittelten Lernausgangslage der Kinder für den Unterricht ziehen. Wir erläutern
kurz die Notwendigkeit der Ermittlung der Lernausgangslage, warum der Themenbereich Größen ausgewählt wurde, und betonen die Bedeutung der Auseinandersetzung mit der Kompetenzentwicklung bei den Studierenden, bevor wir die Ergebnisse präsentieren.
Erste Seite: 189
Letzte Seite: 199
=====================================================
Maike Vollstedt, Christoph Durchhardt & Anwaril Hamidy: Mathematische Resilienz und Unterstützung im universitären Umfeld: Inwiefern unterscheiden sich Studierende?
Abstract
Mathematik ist für Grundschullehramtsstudierende oftmals herausfordernd, und sie erweisen sich als unterschiedlich resilient. Viele benötigen Unterstützung. Diese explorative Studie untersucht, inwiefern sich Gruppen von Studierenden charakterisieren lassen, die sich bezüglich der Facetten mathematischer Resilienz (Value, Struggle, Growth) sowie emotionaler bzw. instrumenteller Unterstützung von Lehrenden und Kommiliton*innen unterscheiden. Die in einer Cluster-Analyse aufgefundenen vier Cluster werden anhand signifikanter Unterschiede charakterisiert.
Erste Seite: 201
Letzte Seite: 210