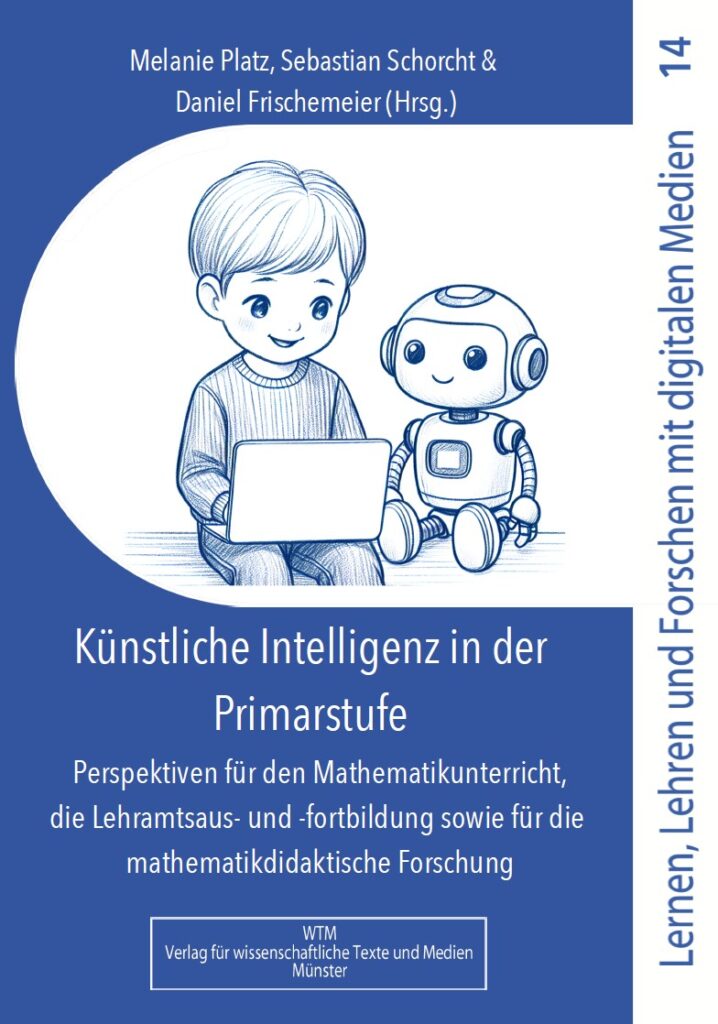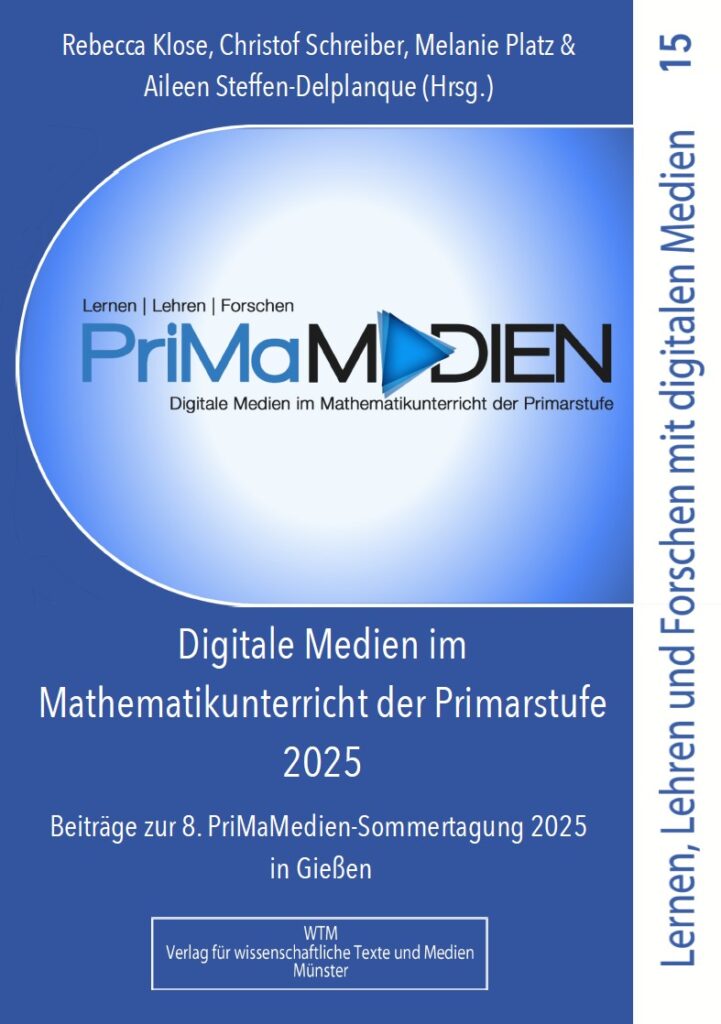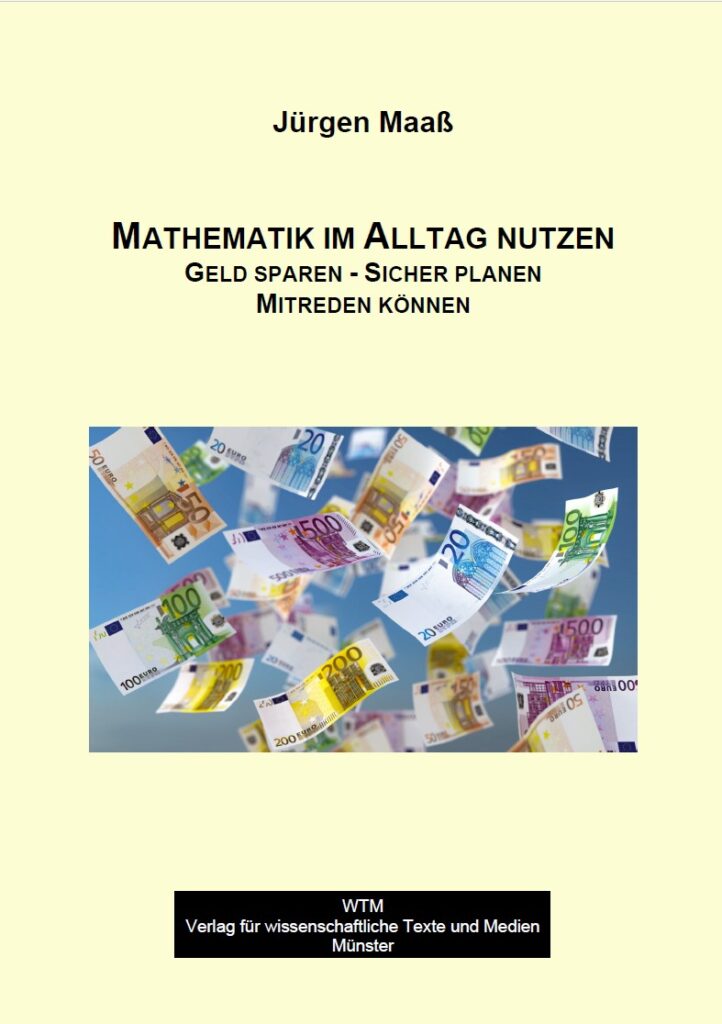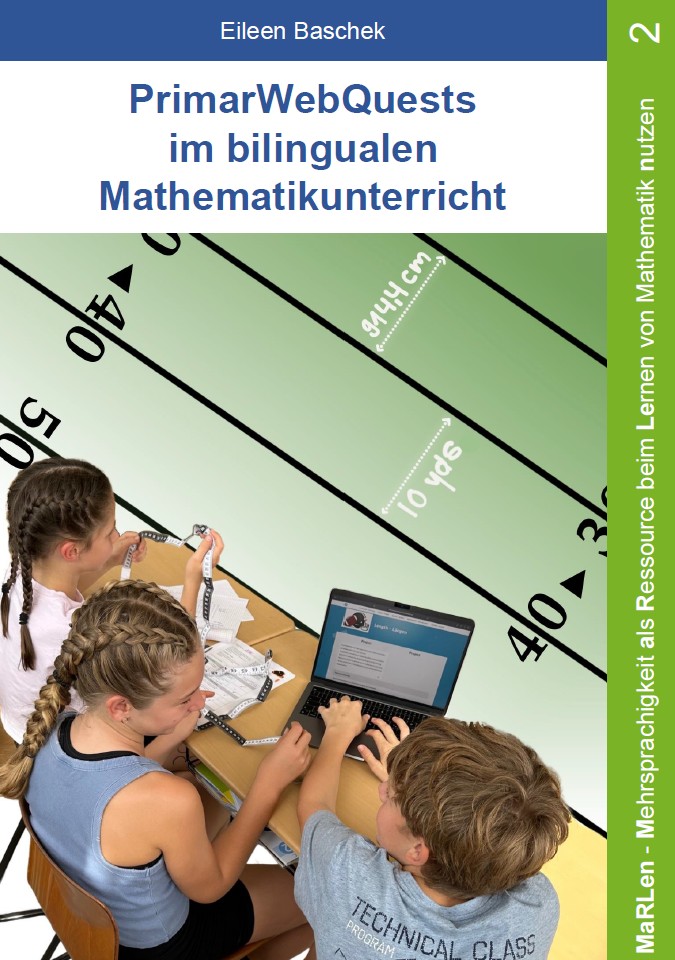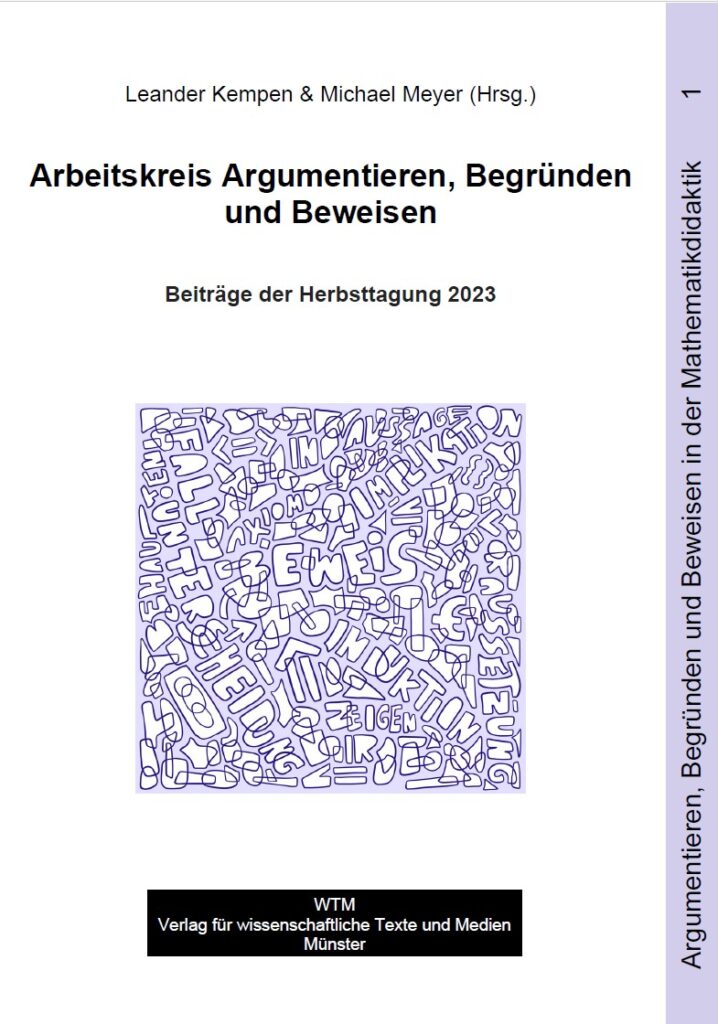Tagungsband der Herbsttagung des GDM-Arbeitskreises Problemlösen online 2021
Band 19 der Reihe Ars inveniendi et dejudicandi
Münster: WTM-Verlag 2023
Ca. 150 Seiten, DIN A5
978-3-95987-269-0 Print 22,90 €
978-3-95987-270-6 E-Book 20,90 €
https://doi.org/10.37626/GA9783959872706.0
Für Bestellungen bei edition-buchshop hier klicken
Abstract
Die Community des GDM-Arbeitskreises Problemlösen hat sich auch im Herbst 2021 über aktuelle Forschungsperspektiven, Unterrichtserfahrungen wie auch Perspektiven aus diesem Themenfeld ausgetauscht. Wie im Jahr zuvor wurde auch die 8. Herbsttagung nicht in Präsenz, sondern auf Distanz abgehalten: Am 30. September und 1. Oktober 2021 haben sich Interessierte des mathematischen Problemlösens online zusammengefunden. Die Vorträge und ein Workshop wurden live durchgeführt und rege diskutiert.
Aus den Vorträgen und Diskussionen während der Herbsttagung resultieren zehn Beiträge, die ihren Weg in den vorliegenden Tagungsband gefunden haben:
Im internationalen Hauptvortrag der Herbsttagung hat Prof. Dr. Peter Liljedahl (Simon Fraser Universität, Kanada) seine Forschung zur lernwirksamen Implementation von Problemlöseaufgaben im Unterricht vorgestellt. In den weiteren Beiträgen sind Überlegungen zur Förderung des Problemlösens im Lehramtsstudium bzw. in der Studieneingangsphase und der Rolle des Problemlösens aus der Perspektive der Lehrkräfte in diesem Band auch Praxisbeträge enthalten, die sowohl die Grundschule als auch die Sekundarstufe fokussieren.
Die Sprecher*innen des Arbeitskreises freuen sich, dass sich die Freund*innen des Problemlösens trotz räumlicher Distanz zum wiederholten Male weiterhin thematisch nah sind.
=====================================================
Titel des Beitrags: Building Thinking Classrooms. A Summary of 15 Years of Research
Abstract: Student difficulty with mathematics has been a pervasive and systemic problem since the advent of public education—not because students can’t learn mathematics, but because, by and large, students can’t learn it by being told how to do it. Since the publication of the NCTM Principles and Standards (1998) there has been a concerted effort to change this reality by transitioning to more progressive and student-centered pedagogies. And progress has been made. Yet, something is still missing. Systemically, we are still struggling with high failure rates, low self-efficacy, and massive student disengagement. In this article I look at the results of a research project that was specifically designed to change this reality by finding ways to get students to think. The results of this work shows that there are a collection of teaching practices that any teacher can use to turn their classroom into a space where students think, learn, and succeed.
Verfasser*innen: Peter Liljedahl
Erste Seite: 3
Letzte Seite: 14
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872706.0.01
=====================================================
Titel des Beitrags: We’ve built Thinking Classrooms. Erfahrungen aus einem Jahr Unterricht
Abstract: In diesem Beitrag werden Erfahrungen mit dem Unterrichten im Sinne von Peter Liljedahls Thinking Classroom-Konzept beschrieben und reflektiert. Dabei werden zwei Schwerpunkte gesetzt: Erstens geht es um Anregungen, wie sich die Ideen von Peter Liljedahl an einer deutschen Regelschule mit rund 30 Schüler:innen in einem gewöhnlichen Klassenzimmer umsetzen lassen. Auch werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie man digitale Lernplattformen wie bettermarks innerhalb des Konzepts nutzen kann. Zweitens thematisiert der Beitrag in der Praxis aufgetretene Probleme bei der Umsetzung des Konzepts. Dazu wird am Beispiel der Teilung in eine Basis- und eine Fortgeschrittenengruppe in einer sehr heterogenen Klasse gezeigt, wie sich eine Modifikation des Konzepts als vorteilhaft erwies. Ebenso wird am Beispiel des Anfertigens nützlicher Notizen aber auch reflektiert, warum sich andere Abweichungen als kontraproduktiv herausstellten.
Verfasser*innen: Max van Bahlen
Erste Seite: 15
Letzte Seite: 28
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872706.0.02
=====================================================
Titel des Beitrags: Rough draft mathematics als Zugang zu Problemlöseaufgaben für inklusive Lerngruppen
Abstract: Probleme lösen zu können, weist eine große Bedeutung für mathematisches Lernen als auch für das tägliche Leben auf. Daher sollte allen Schüler:innen ein Zugang dazu ermöglicht werden. Bisher gibt es jedoch kaum empirische Untersuchungen zu den Problemlösefähig- und -fertigkeiten von mathematisch leistungsschwächeren Schüler:innen oder inklusiven Lerngruppen. In unserer Studie analysieren wir daher, in welcher Weise mit Hilfe des methodischen Vorschlags „Rough Draft Mathematics“ (Jansen, 2020a) in einer inklusiven Lerngruppe Schüler:innen dabei unterstützt werden, einen Zugang zu Problemlöseaufgaben (hier: Pferde-Fliegen-Aufgabe; Wittmann & Müller, 2005, S. 68) zu finden, bei der zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten gelöst werden sollen. Im Beitrag wird anhand einer videografierten Unterrichtssequenz die Aufgabeninitiierung im Plenum einer 4. Klasse analysiert, in der die Schüler:innen gemeinsam erste Ideen, sogenannte „rough drafts“, zur Bearbeitung der Problemlöseaufgabe sammeln. Dabei wird deutlich, dass die Äußerungen der Schüler:innen weit über das bloße Rezipieren der Aufgabenstellung hinausgehen und somit bereits der Einstieg mittels „Rough Draft Mathematics“ eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Problemlöseaufgabe zeigt. Außerdem wird herausgearbeitet, dass Schüler:innen sich auch auf Ideen und Äußerungen ihrer Mitschüler:innen beziehen und diese zum Teil sogar erweitern. Die Ergebnisse zeigen, dass Rough Draft Mathematics eine soziale Praktik für den inklusiven Mathematikunterricht, vor allem auch für das Problemlösen, darstellen könnte.
Verfasser*innen: Kerstin Bräuning & Caren Feskorn
Erste Seite: 29
Letzte Seite: 44
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872706.0.03
=====================================================
Titel des Beitrags: Eine Qualitative Längsschnitt-Videostudie mit Leistungsschwachen GesamtSchüler:innen zum mathematischen Problemlösen
Abstract: Mathematisches Problemlösen wird bislang zumeist bei leistungsstarken Schüler:innen untersucht. Für leistungsschwache Schüler:innen und deren spezifische Hürden beim Problemlösen ist kaum etwas bekannt. Anhand dreier homogen eingeteilter, leistungsschwacher Schüler:innenpaare werden Schwierigkeiten und Entwicklungsverläufe über einen Zeitraum von neun Monaten qualitativ herausgearbeitet. Hürden wie Vorwissen, Aufgabenverständnis sowie die Unterscheidung zwischen Heurismenwahl und -umsetzung werfen Fragen bezüglich der Entwicklung von Unterstützungsmöglichkeiten für leistungsschwache Schüler:innen und damit einhergehend für die zukünftige Unterrichtsentwicklung auf.
Verfasser*innen: Raja Herold-Blasius
Erste Seite: 45
Letzte Seite: 60
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872706.0.04
=====================================================
Titel des Beitrags: Ein geometrisches Problem aus dem Schulbuch – Erfahrungen und Möglichkeiten im ungarischen Lehramtsstudium
Abstract: In der letzten Zeit geraten geometrische Aufgaben im ungarischen Mathematikunterricht etwas in den Hintergrund. So haben immer mehr Lehramtsstudierende größere Defizit an geometrischen Kenntnissen zu Beginn ihres Studiums als es in früheren Jahren der Fall war. Nicht nur wegen der Wichtigkeit der Geometrie an sich, sondern auch aus fachdidaktischen Gründen ist dieser Inhaltsbereich wichtig, da geometrische Aufgaben besonders für den Problemlöseunterricht und die Entwicklung mathematischen Denkens geeignet sind. Ein Beispiel hierfür wäre, dass zu einer geometrischen Aufgabe im Allgemeinen oft mehrere, verschiedene Lösungswege angefertigt und analysiert werden können. Es gibt Aufgaben, die besonders für das Finden und Nutzen von verschiedenen Lösungswegen geeignet sind. Solche sind in ungarischen Lehrbüchern leicht zu finden. Eine problemorientierte Arbeit mit geometrischen Schulbuchaufgaben an dem mathematikdidaktischen Seminar kann – neben anderen Vorteilen – sich positiv auf die Einstellung zum Problemlösen und auf die Aufgabenkultur der künftigen Mathematiklehrerinnen und -lehrer auswirken. An einem konkreten Beispiel wird eine Möglichkeit für eine solche Arbeit am Online–Unterricht aufgezeigt.
Verfasser*innen: Gabriella Ambrus
Erste Seite: 61
Letzte Seite: 74
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872706.0.05
=====================================================
Titel des Beitrags: Problem erkannt? – Problem gebannt?
Abstract: Die Kegelschnitte sind die Grundlage zur Lösung der historischen Probleme Trisektion, Würfelverdopplung und Kreisquadratur außerhalb der von Euklid erlaubten Werkzeuge. In diesem Beitrag wird einerseits die Wandlung des Begriffs Problem im Zusammenhang mit zugelassenen Werkzeugen thematisiert und für die SI als potenzieller Unterrichtsgegenstand vorgestellt. Problemlösen ist – psychologisch betrachtet – sehr interessant, deshalb erfolgt ein Brückenschlag ausgehend von Köhlers Experiment mit Schimpansen auf Teneriffa bis in die Belletristik. Unter Berücksichtigung der aktuellen Diskussion um Werkzeuge und Unter-richtsinhalte werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie die antike mathematische Problemlösung den heutigen, technisch unterstützten Unterricht, positiv beeinflussen kann, bzw. wie die Denkstrukturen der Antike adaptiert werden können.
Verfasser*innen: Wilfried Dutkowski
Erste Seite: 75
Letzte Seite: 86
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872706.0.06
=====================================================
Titel des Beitrags: Brainteasers vs. offene Problemfelder
Abstract: In diesem Artikel setzen wir Brainteaser und offene Problemfelder miteinander in Verbindung. Wir erarbeiten, dass erstere mit einer klassischen Unart verbunden sind, den Weg zur Behauptung zu vertuschen. Hierzu stellen wir drei klassische Aufgaben vor. Allein genommen wirken sie für sich wie Brainteaser, deren Lösung eines genialen Einfalls bedarf. Zusammengenommen – und mit etwas Kontext angereichert – wird jedoch klar, dass es viel produktiver ist, sie als Übungsfälle für das allgemeine Prinzip der Nutzung von Invarianten zur Lösung von Aufgaben darstellen.
Verfasser*innen: Karl Heuer & Deniz Sarikaya
Erste Seite: 87
Letzte Seite: 98
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872706.0.07
=====================================================
Titel des Beitrags: Problemlösen aus Studierendensicht – Ergebnisse der Evaluation eines Seminarkonzepts zur Förderung dieser Kompetenz
Abstract: Im Rahmen einer quasi-experimentellen Studie im Prätest-Posttest-Kontrollgruppen-Design standen metakognitive Prozesse beim Problemlösen im Fokus. Die Studierenden der Experimentalgruppe des zweiten Mastersemesters waren alle zwei Wochen dazu aufgefordert, eine Problemaufgabe allein oder zu zweit im Rahmen des Seminars zu lösen und ihren Bearbeitungsprozess zu dokumentieren. Zusätzlich sollten sie unterschiedliche Bearbeitungen der gleichen Problemlöseaufgabe nachvollziehen und eine Rückmeldung hierzu schreiben. Durch die Reflexion des eigenen Bearbeitungsprozesses, entsprechende Feedbacks durch die Dozierenden und die Einschätzung fremder Bearbeitungsprozesse wurde versucht, das eigene Denken im Sinne der Metakognition beim Problemlösern bewusst zu machen. Im Beitrag wird betrachtet, inwieweit sich Unterschiede zwischen der Experimentalgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe bei den Erwartungen an das Problemlösen im Unterricht bzw. hinsichtlich der Überzeugungen zur Struktur mathematischen Wissens zeigen. Zusätzlich wird die Zufriedenheit der Experimentalgruppe mit dem Seminarkonzept betrachtet.
Verfasser*innen: Nadine Böhme & Heike Hahn
Erste Seite: 99
Letzte Seite: 116
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872706.0.08
=====================================================
Titel des Beitrags: Problemlösen in der Studieneingangsphase: Analyse authentischer Problembearbeitungsprozesse
Abstract: Im Rahmen der Entwicklung einer Interventionsmaßnahme zur Förderung der Problemlösekompetenz von Studienanfänger:innen an der Universität Duisburg-Essen wurden durch Videographierung von Bearbeitungsprozessen zu authentischen Aufgaben aus den Anfängervorlesungen (Analysis und Lineare Algebra) des Gymnasiallehramts bzw. des Fachbachelors grundlegende Erkenntnisse zum Problemlösen in der Studieneingangsphase gesammelt. Hierbei hat sich gezeigt, dass die Bedeutung des Vorwissens in diesem Kontext größer ist, als bisher bekannt war. Der vorliegende Artikel zeigt anhand von zwei Beispielprozessen das Vorgehen bei der Auswertung des gesammelten Videomaterials und präsentiert die wichtigsten Ergebnisse. Darüber hinaus werden die daraus resultierenden Ergänzungen der Interventionsmaßnahme beschrieben und mögliche Implikationen für die weitere Forschung angedeutet.
Verfasser*innen: Thomas Stenzel
Erste Seite: 117
Letzte Seite: 130
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872706.0.09
=====================================================
Titel des Beitrags: „Status quo“ des Problemlöseunterrichts in der Grundschule: Wird der Kompetenzbereich (weiterhin) vernachlässigt?
Abstract: Obwohl das Problemlösen in der Fachdidaktik nicht zuletzt durch die Bildungsstandards einen unverzichtbaren Kompetenzbereich darstellt, ist die Untersuchung der schulischen Implementierung wenig fortgeschritten. Vielmehr werden Erklärungsansätze für Schwierigkeiten bei der Unterrichtsgestaltung auf einer Erfahrungsbasis diskutiert, ohne den tatsächlichen „Status Quo“ auf einer empirischen Basis zu kennen. Im Rahmen des Beitrags wird eine fragebogengestützte Studie präsentiert, an der 186 Grundschullehrkräfte aus zwei Bundesländern teilnahmen. Es werden ausgewählte Aspekte zur Implementierung des Problemlösens (Frequenz der Implementierung, Umsetzungsart, Hemmnisse, Quellen der Unterrichtsideen) thematisiert und die Beeinflussung durch die Kontrollvariablen (fachlicher Hintergrund, Berufserfahrung, Haltung zum Problemlösen) präsentiert. Die Ergebnisse zeigen u. a., dass die Berufserfahrung keinen Einfluss auf Hemmnisse in der Implementierung nehmen, wenngleich sich der fachliche Hintergrund und die Haltung der Lehrkräfte auf die erlebten Unterrichtsschwierigkeiten auswirken. Insgesamt gibt dieser Beitrag Aufschluss über Faktoren, die den unbefriedigenden Status erklären können und bietet somit klare Rückschlüsse für die Praxis.
Verfasser*innen: Inga Gebel, Ana Kuzle & Nina Sturm
Erste Seite: 131
Letzte Seite: 149
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872706.0.10