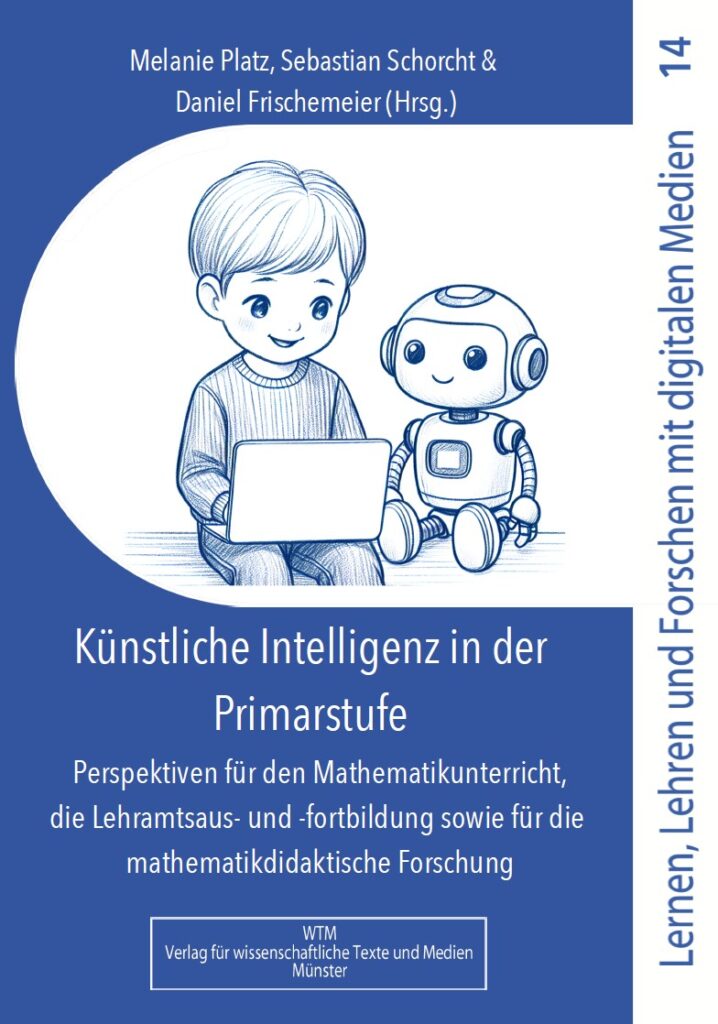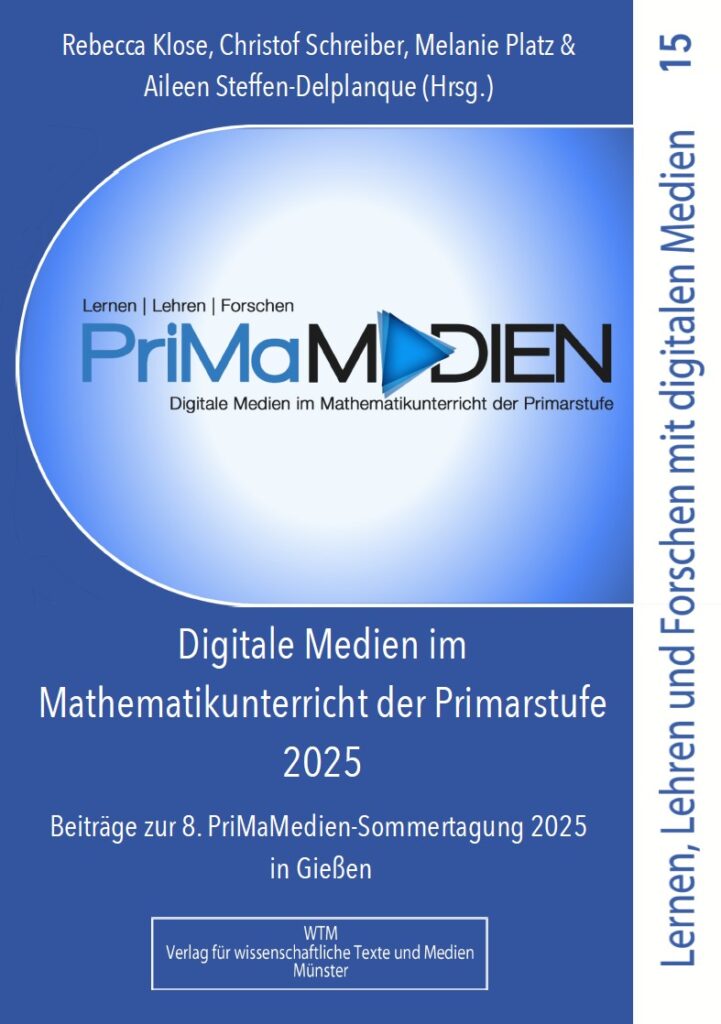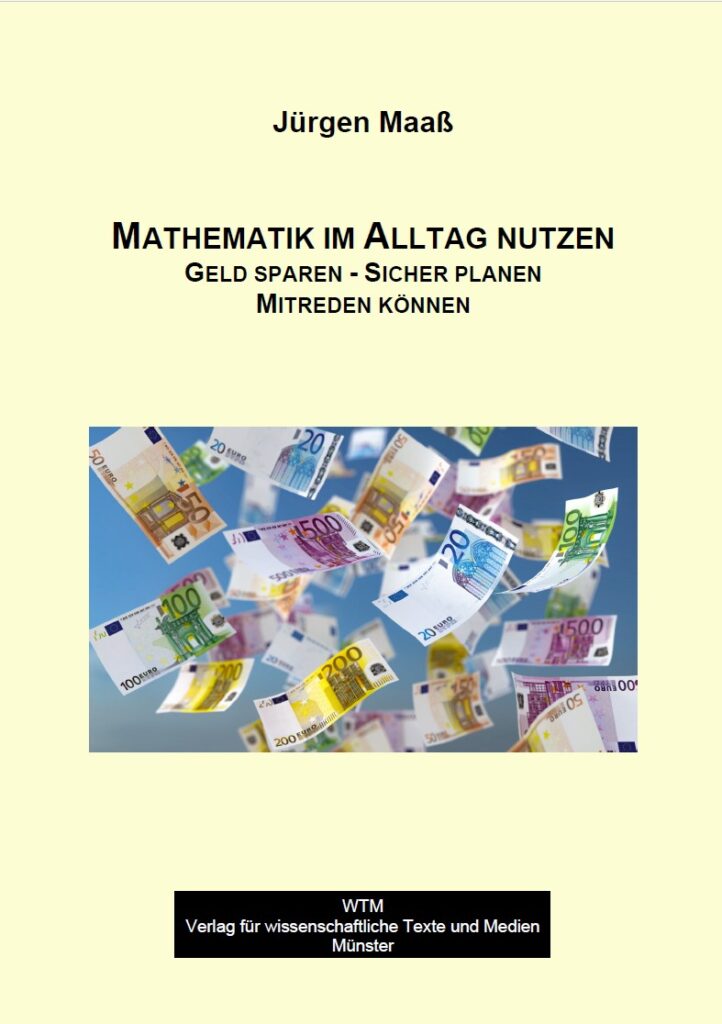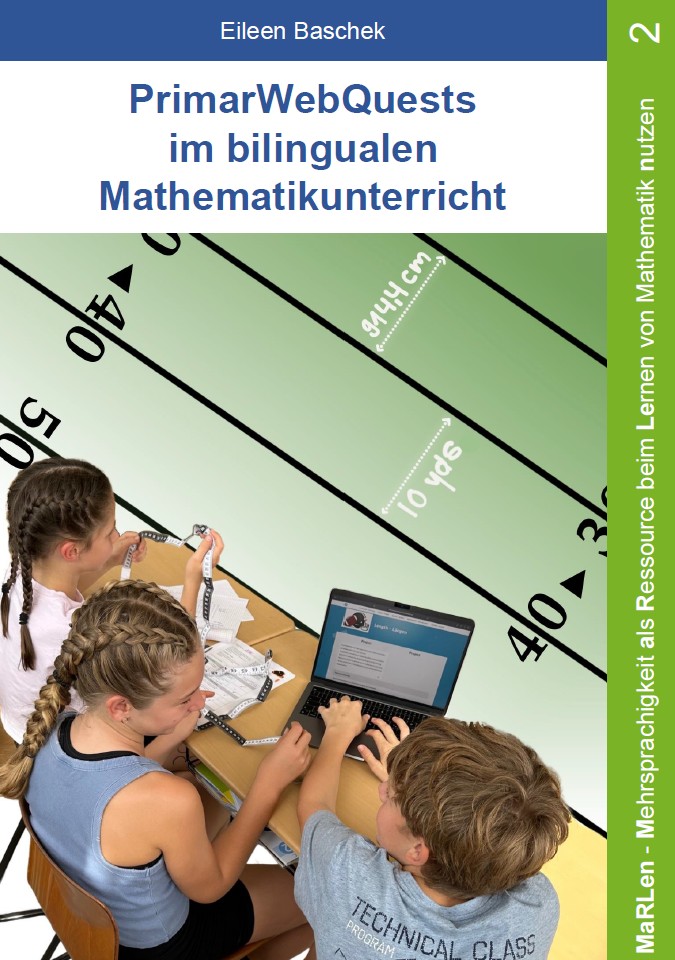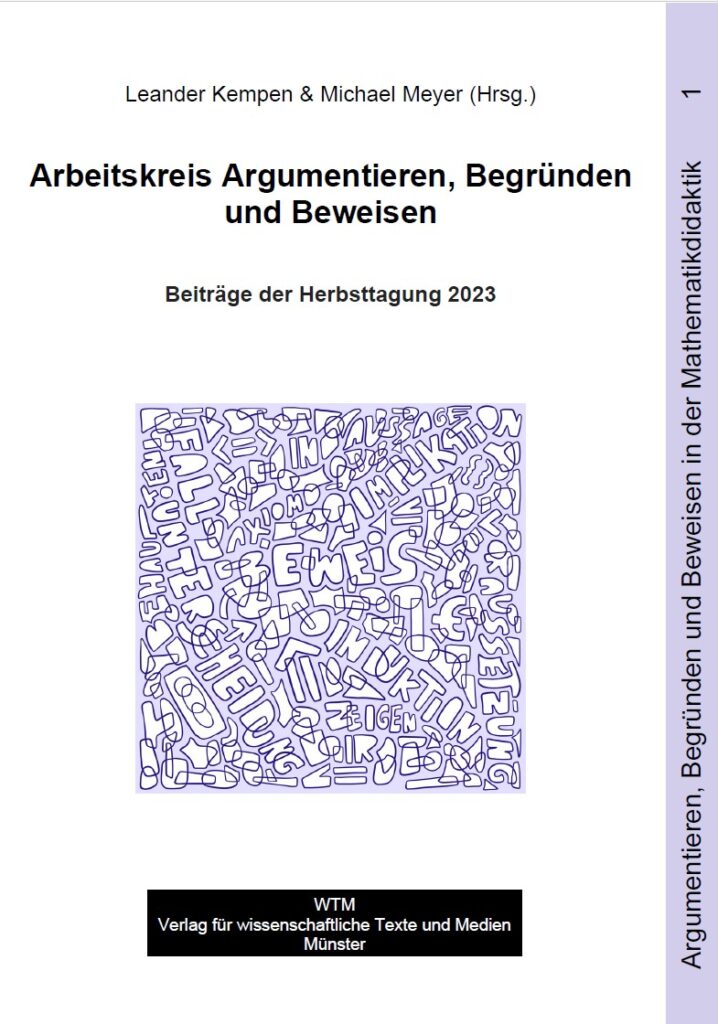Band 5 der Reihe Mathematiklehren und -lernen in Ungarn
Band 5 der Reihe Mathematiklehren und -lernen in Ungarn
Münster 2023, 450 S.
Print: ISBN 978-3-95987-271-3, 55,90 €
Ebook: ISBN 978-3-95987-272-0, 50,90 €
https://doi.org/10.37626/GA9783959872720.0
Für Bestellungen bei edition-buchshop hier klicken
Vorschau
Zur Vorschau klicken sie auf das Bild.
Abstract
Mathematik ist überall. Mathematik ist für alle. Aufgrund ihres hohen Rangs in der Wissensgesellschaft ist Mathematik ein unverzichtbarer Bestandteil einer allgemeinen Bildung, was für die Schule bedeutet, den Wert eines an den Strukturen und Wesenszügen von Mathematik orientierten Denkens für alle zur Geltung zu bringen.
In bildungstheoretischer Sicht stellen Mathematik und mathematisches Denken einen spezifischen, unersetzbaren Modus der Welterschließung dar, der für die kognitive Entwicklung von fundamentaler Bedeutung ist. Mathematisches Denken ist daher in Vorschul- und Schulzeit kontinuierlich und systematisch zu fördern.
Was das Nicht-Substituierbare des durch mathematisches Denken gekennzeichneten Weltzugangs und Weltverständnisses ausmacht, welche diesbezüglichen Ansprüche und Anforderungen vor, in und nach der Schule wesentlich sind, davon handelt dieser Band.
Mathematik ist in Ungarn traditionell von hoher kultureller und wissenschaftlicher Bedeutung. Nicht nur für das Problemlösen à la Pólya gilt Mathematik als „Schule des Denkens“. Intention der Buchreihe „Mathematiklehren und -lernen in Ungarn“ ist es, die beispielgebende Rolle des Landes und den inspirativen Austausch über Grenzen hinweg zum Ausdruck zu bringen.
Mit der Herausgabe dieses Buches ist die Hoffnung verbunden, dem vielfach vernachlässigten Thema „Mathematik und mathematisches Denken“ neue Anstöße und Anregungen zu geben. An so manchen Stellen im Buch wird zudem ersichtlich, dass für eine Entwicklung des mathematischen Denkens gewisse Bedingungen von nennenswertem Belang sind. Sie betreffen insbesondere die Aufgeschlossenheit gegenüber der Mathematik in Unterricht, Schule und Gesellschaft.
BEITRÄGE
Verfasser*innen: Lisa Hefendehl-Hebeker
Titel des Beitrags: Grundzüge mathematischen Denkens
Erste Seite: 11
Letzte Seite: 32
Abstract
Die Mathematik gründet in Denkhandlungen, die uns Menschen eigen sind. Wurzeln des mathematischen Denkens von früher Kindheit an bestehen im Erkennen und Erforschen von Mustern. Von hier aus gewinnt es eigene Ausprägungen und eine weite Anwendbarkeit, und es unterliegt eigenen Standards der Strenge.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872720.0.01
Verfasser*innen: Kinga Szűcs
Titel des Beitrags: Der Bedeutungswandel von Beweisen in der Entwicklungsgeschichte des mathematischen Denkens
Erste Seite: 33
Letzte Seite: 50
Abstract
Die Mathematik – und somit das mathematische Denken – hat sich in ihrer mehrere Jahrtausende umfassenden Geschichte enorm verändert, wobei der Vorstellung vom Beweis sowie dessen Rolle bei der Verifizierung vom mathematischen Wissen eine zentrale Bedeutung zugekommen ist. In der ersten Phase der Entwicklung, der vorgriechischen Mathematik, existierten keine Beweise, sodass auch nicht von einer mathematischen Theorie gesprochen werden kann. Dahingegen führte die Sicherung des mathematischen Wissens in der griechischen Antike – in der zweiten Phase der Entwicklung – unter Rückgriff auf durch Regeln der Logik geleitete, auf Axiome basierende, deduktive Beweise zu einer formal-deduktiv aufgebauten, auf reines Denken zurückgreifenden Wissenschaft. Bis zur sogenannten Grundlagenkrise der Mathematik gegen Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts war dies das vorherrschende Bild von der Mathematik. Dieses Bild blieb im Laufe der Jahrhunderte lange unverändert, nur der Grad der formalen Abfassung wurde immer höher. Die Grundlagenkrise verdeutlichte allerdings, dass das mathematische Wissen nicht absolut gesichert werden kann. Als eine Antwort auf diese Problematik entstand die Vorstellung von der Mathematik als einer quasi-empirischen Wissenschaft, in der die – weiterhin deduktiven – Beweise keine allgemeingültigen Begründungen, sondern nur temporäre Erklärungsversuche sind. Diese Vorstellung bezeichnet die dritte Stufe der Entwicklung. In der vierten, bislang letzten Phase der Entwicklung werden Ansätze diskutiert, welche neben der deduktiven Schlussfolgerung auch andere Schlussweisen als Beweise zulassen und somit zum Aufgeben der seit der Antike geltenden mathematischen Strenge führen würden.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872720.0.02
Verfasser*innen: Gert Kadunz
Titel des Beitrags: Bemerkungen zur Semiotik in der Mathematikdidaktik
Erste Seite: 53
Letzte Seite: 72
Abstract
Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist die Zeichentheorie nach Charles S. Peirce ein fester, wenngleich nicht immer beachteter Teil der theoretischen Fundierungen mathematikdidaktischer Überlegungen. Die Anwendungsmöglichkeiten dieser Zeichentheorie sind vielfältig. Ein aus meiner Sicht wesentlicher Punkt bei der Verwendung dieser Zeichentheorie ist die Konzentration auf das Sichtbare, also auf die für den Sehsinn zugänglichen Aktivitäten der Lehrenden und Lernenden. Innerhalb der Mathematikdidaktik besitzt die Hinwendung zum Sichtbaren und damit das Vor-Augen-Führen von Mathematik eine lange Tradition. Der folgende Beitrag versucht, an Hand ausgewählter Beispiele aus der Geschichte der Mathematikdidaktik der letzten fünf Jahrzehnte die Verwendungen von Sichtbarem zu beschreiben. Einen aktuellen Stand dieser Verwendung stellt die Peirce’sche Semiotik dar.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872720.0.03
Verfasser*innen: Gregor Nickel
Titel des Beitrags: „Tapferkeitsluxus der reinen Ratio“ – Aspekte mathematischen Denkens
Erste Seite: 73
Letzte Seite: 96
Abstract
Im ersten Teil diskutieren wir den höchst instruktiven Blick Robert Musils auf das mathematische Denken, den er u.a. in einem frühen Essay (1918) und in seinem Hauptwerk Der Mann ohne Eigenschaften entfaltet. Auf den Spuren Musils werden dann Aspekte mathematischen Denkens skizziert, wobei sich eine spannungsreiche Struktur von Gegensätzen zeigt. Wir schließen mit einem kurzen Verweis auf Platons Unterscheidung von mathematischem und philosophischem Denken.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872720.0.04
Verfasser*innen: Daniel Koenig
Titel des Beitrags: Die Zahl als Denktypus. Zahlworte und Zahlbegriffe in der Symbolphilosophie Ernst Cassirers
Erste Seite: 97
Letzte Seite: 122
Abstract
Sprache, Mythos, Religion und Kunst, aber auch die exakten Naturwissenschaften bauen – Ernst Cassirer zufolge – als symbolische Formen je ein eigenständiges Reich objektiver Bedeutung auf. Insbesondere stellen in der Mathematik Zahlen einen spezifischen Typus des Denkens dar. Der vorliegende Beitrag befasst sich zunächst mit den für die Mathematik eigentümlichen Ausgestaltungen von (sprachlichen) Zahlworten und (wissenschaftlichen) Zahlbegriffen, erläutert dann, inwieweit ein durch Symbole und Beziehungen gegebenes System charakteristisch für die Mathematik ist, und geht schließlich auf mögliche Implikationen für die Mathematikdidaktik ein
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872720.0.05
Verfasser*innen: Zoltán Kondé
Titel des Beitrags: Mathematisches Denken – Intelligenz und kognitive Prozesse
Erste Seite: 123
Letzte Seite: 138
Abstract
Im vorliegenden Beitrag wird ein Überblick über den konzeptionellen Rahmen gegeben, der zum Verständnis und zur Untersuchung der Natur des mathematischen Denkens und seiner individuellen Unterschiede verwendet wird. Wir geben einen kurzen Überblick über die wichtigsten Theorien und Modelle der Intelligenz- und Arbeitsgedächtnisforschung und präsentieren einige Ergebnisse über die empirische Beziehung zwischen einigen Aspekten des mathematischen Denkens und der Intelligenz und kognitiven Prozessen. Die möglichen Zusammenhänge werden anhand von Beobachtungen aus unserer eigenen Forschung illustriert.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872720.0.06
Verfasser*innen: Nina Unshelm & Hans-Stefan Siller
Titel des Beitrags: Kritisches Denken als Teil mathematischen Denkens – ein exemplarischer Diskurs
Erste Seite: 139
Letzte Seite: 168
Abstract
Ein wesentlicher Teil der 21st Century Skills ist das kritische Denken. Im Mittelpunkt des vorliegenden Beitrags steht die Frage: Inwiefern ist mathematisches Denken auch kritisches Denken? Dazu werden zunächst die beiden Denkweisen charakterisiert und anschließend verschiedene Facetten des mathematischen Denkens mit dem Konzept des kritischen Denkens verglichen, um eine mögliche Übereinstimmung zu analysieren. Anhand passender Themen und Aufgabenstellungen, die kritisches Denken im Mathematikunterricht anregen können, wird exemplarisch aufgezeigt, wie die 21st Century Skills durch eine Verbindung mit expliziten Inhalten gefördert werden können
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872720.0.07
Verfasser*innen: András Ambrus & Krisztina Barczi-Veres
Titel des Beitrags: Die Rolle der Mathematik für einen selbst – Lebensberichte
Erste Seite: 169
Letzte Seite: 184
Abstract
Ziel dieses Artikels ist es, mittels einiger Lebensberichte zu zeigen, dass sich die Rolle der Mathematik nicht nur für die Gesellschaft, sondern auch für den Einzelnen im Laufe der Zeit deutlich verändert. Die geständnishaften Schilderungen haben wir von Menschen mit den unterschiedlichsten engen und losen Verbindungen zur Mathematik erhalten. Dabei kamen uns die Lebens- und Unterrichtserfahrungen des älteren von uns (András Ambrus) und seine Begegnungen mit vielen Menschen gerade in der Lehrtätigkeit zugute.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872720.0.08
Verfasser*innen: Melissa E. Libertus
Titel des Beitrags: Die Entwicklung des mathematischen Denkens in der frühen Kindheit
Erste Seite: 187
Letzte Seite: 200
Abstract
Von Geburt an zeigen Kinder ein grundlegendes Verständnis für eine überraschend breite Palette numerischer Konzepte. In diesem Beitrag gebe ich einen Überblick über die aktuelle Literatur zur Darstellung kleiner und großer Zahlen bei Säuglingen und Kleinkindern und darüber, wie dieses Verständnis ihre rudimentäre Auffassungsgabe arithmetischer Operationen wie Addition und Subtraktion unterstützt. Darüber hinaus haben Längsschnitt- und Trainingsstudien gezeigt, dass insbesondere Darstellungen und Operationen mit großen, ungefähren Mengen mit den mathematischen Fähigkeiten der Kinder zusammenhängen. Abschließend gehe ich auf die Entwicklung des kindlichen Erwerbs der Bedeutung von Zahlwörtern ein und zeige auf, wie sich dieser Prozess im Kontext verschiedener Sprachen unterscheiden kann.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872720.0.09
Verfasser*innen: Julia Köck & Günter Maresch
Titel des Beitrags: Bemerkenswerte Zusammenhänge zwischen der Mathematikleistung und dem räumlichen Denkvermögen von Primarstufen- und Sekundarstufenschüler*innen
Erste Seite: 201
Letzte Seite: 212
Abstract
In einigen internationalen Studien der letzten Jahre wurde ein möglicher Zusammenhang zwischen der Mathematikleistung und dem räumlichen Denkvermögen untersucht. Zum einen wurde dabei festgestellt, dass Personen mit Stärken in den MINT/STEM-Feldern bei Raumvorstellungstests besser abschneiden. Zum anderen konnte beobachtet werden, dass durch Training des räumlichen Denkvermögens eine Verbesserung der Mathematikleistung bewirkt werden kann. Die Verhaltens- und Gehirnforschung erklärt diese Transferleistung dadurch, dass beim Verarbeiten von räumlichen und numerischen Informationen ähnliche neuronale Netzwerke zum Einsatz kommen. In der in diesem Beitrag vorgestellten Studie wurde das räumliche Denkvermögen von Schüler*innen (N = 237) im Alter von 8 – 13 Jahren anhand einer Testung bestimmt und zudem wurde die Note im Unterrichtsfach Mathematik erfasst. Die Analyse zeigt, dass jene Schüler*innen mit einer besseren Mathematiknote auch bei der Testung zum räumlichen Denkvermögen ein besseres Ergebnis erzielen und dass diese Effekte über alle Altersgruppen hinweg zumeist groß sind.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872720.0.10
Verfasser*innen: Lukas Donner
Titel des Beitrags: Effektives mathematisches Denken – eine Annäherung mithilfe von Wettbewerbsaufgaben
Erste Seite: 213
Letzte Seite: 224
Abstract
Effektives mathematisches Denken zeigt sich beim Lösen mathematischer Probleme im bewussten Einsatz heuristischer Strategien sowie in der Nutzung typischer effektivitätssteigernder Methoden der Mathematik wie beispielsweise der sogenannten Baustein-Idee. Eine Förderung dieser Facette des Denkens gelingt insbesondere dann, wenn nicht bei der individuellen Lösung einer bestimmten Aufgabe die Auseinandersetzung als abgeschlossen betrachtet wird, sondern die Lösung als Ausgangspunkt für weiterführende mathematische Untersuchungen dient. Exemplarisch sollen diese Gedanken anhand ausgewählter Wettbewerbsaufgaben dargestellt werden.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872720.0.11
Verfasser*innen: Johann Sjuts
Titel des Beitrags: Illustrative Aufgaben zum mathematischen Denken (in den mittleren Schuljahrgängen)
Erste Seite: 225
Letzte Seite: 248
Abstract
Mathematisches Denken in den Schuljahrgängen von 5 bis 7 ist einerseits durch Inhalte von Arithmetik, Stochastik, Geometrie und Algebra, andererseits durch inhaltsübergreifende Wesenszüge geprägt. Dazu gehören Klärungen von Existenz und Eindeutigkeit sowie Verfahrensweisen des indirekten Begründens, Grundbestandteile des logischen Denkens, Prinzipien und Strategien beim problemlösenden Denken und ebenso begrifflich-ordnendes Denken, regelbasiertes Denken und schlussfolgerndes Denken. Spezifika mathematischen Denkens lassen sich durch Aufgaben verdeutlichen.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872720.0.12
Verfasser*innen: Anna Schreck & Bruno Scheja & Benjamin Rott
Titel des Beitrags: Mathematisches Denken – die „vergessene“ Kompetenz? Ein neuer Versuch, damit praktisch umzugehen
Erste Seite: 249
Letzte Seite: 266
Abstract
Mathematisches Denken ist eine wichtige Fähigkeit, sei es in der Ausbildung, im Beruf oder im alltäglichen Leben. Insofern ist bemerkenswert, dass mathematisches Denken in den deutschen Kernlehrplänen als wesentliche mathematische Teilkompetenz keine explizite Berücksichtigung findet. Da es damit keinen allgemeinen, praktischen Unterrichtsstandard bezüglich der Vermittlung von mathematischem Denken gibt, versucht dieser Artikel einige Schulaufgaben vorzustellen, die im Unterricht mathematisches Denken fördern und anregen können. Dazu werden zunächst die einzelnen Aspekte und Methoden mathematischen Denkens dargelegt.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872720.0.13
Verfasser*innen: Zsolt Fülöp
Titel des Beitrags: The functional approach to algebra: the development of structural thinking in lower secondary school education
Erste Seite: 267
Letzte Seite: 288
Abstract
Ziel dieses Beitrags ist es, die Hauptvorteile des funktionalen Ansatzes im einführenden Algebraunterricht zu veranschaulichen. Die verschiedenen Schwierigkeiten und kognitiven Hindernisse, mit denen Schüler konfrontiert sind, wenn sie Wortprobleme mit algebraischen Methoden lösen müssen, sind in der einschlägigen Literatur gut dokumentiert. Es treten einige typische Fehler auf, wie z. B. Schlussfolgern, Umkehrfehler, Fehlinterpretation der Variablen oder der Unbekannten. Die Gründe für diese Schwierigkeiten können sehr unterschiedlich sein. Es liegt jedoch auf der Hand, dass der Übergang von der Arithmetik zur Algebra eine Verlagerung vom prozeduralen Denken zum strukturellen Denken beinhaltet. Um in der Algebra erfolgreich zu sein, müssen sich die Schüler von arithmetischen Konventionen lösen und eine algebraische Denkweise annehmen. In unseren Versuchen haben wir einen funktionalen Ansatz für die Algebra gewählt, der diesen Übergang erleichtern könnte. Mit Hilfe dieses Ansatzes haben wir in zwei Klassen der Jahrgangsstufe 7 einen Algebra-Einführungskurs durchgeführt. Um die Hauptaspekte des funktionalen Ansatzes zu untersuchen, analysierten wir die Antworten der Schüler und verglichen unsere Ergebnisse mit anderen früheren Forschungsarbeiten.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872720.0.14
Verfasser*innen: Tünde Kántor
Titel des Beitrags: Mathematisches Denken beim Lösen von Wettbewerbsaufgaben
Erste Seite: 289
Letzte Seite: 308
Abstract
Wir werden das Denken beim Lösen von Aufgaben des XIV-ten Internationalen Ungarischen Mathematikwettbewerbs (9. Klasse) untersuchen. Unsere Untersuchungen basieren auf der Lösung der 5. Aufgabe der Aufgabenserie. Wir haben die schriftlichen Arbeiten von 59 Teilnehmerinnen und Teilnehmern (15 Jahre alt) evaluiert. Die Untersuchung der Lösung mathematischer Wettbewerbsaufgaben ist sehr wichtig, um die heuristischen Vorgehensweisen, die Strategie oder Taktik und die Denkweise der Jugendlichen zu analysieren. Die Analyse basiert auf kognitionspsychologischen Aspekten, Lehrerfahrungen und der erwarteten, möglichen und tatsächlichen Lösungen der Wettbewerbsaufgaben. Unsere Aussagen stammen in erster Linie aus der Erfahrung. Als theoretischer Hintergrund dienen uns die Heuristik von Pólya und Sternbergs Forschungen und Ergebnisse in Bezug auf mathematisches Denken. Die Bestandteile des mathematischen Denkens der am Wettbewerb beteiligten Jugendlichen, die wir untersuchen, beziehen sich auf das feststellbare mathematische Wissen, die verwendeten Methoden, Theoreme und Verfahren, Ideen, Annahmen, Experimente, Missverständnisse sowie die angefertigten Skizzen. Wir haben vor allem betrachtet, wie die Jugendlichen Probleme heuristisch lösen.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872720.0.15
Verfasser*innen: Sebastian Bauer & Andreas Büchter
Titel des Beitrags: Mathematisches Denken in Abituraufgaben in Deutschland – Anspruch, Wirklichkeit und Möglichkeiten
Erste Seite: 309
Letzte Seite: 324
Abstract
Aus früheren und neueren Analysen von Abituraufgaben (und Prüfungsaufgaben am Ende der Sekundarstufe I) ist bekannt, dass das zum Lösen der Aufgaben verlangte mathematische Denken insgesamt kein hohes Anforderungsniveau erreicht. Wesentliche Bestandteile von mathematischem Denken bleiben außen vor. Der beschränkte Anspruch scheint systemische Ursachen zu haben (die von einem kognitiv anregungsarmen Mathematikunterricht bis zu einer auf Bewältigbarkeit bedachten eng angelegten Art von Aufgaben im Schulabschluss reichen). Indes ließe sich durch Aufgaben mit hohem Potential zur kognitiven Aktivierung ein tiefergehendes und einsichtsvolles Verständnis von Mathematik erzielen. Schon mit Aufgabenvariationen wäre es erreichbar, Herausforderungen für reichhaltigere mathematische Denkoperationen zu schaffen.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872720.0.16
Verfasser*innen: Józsefné Pálfalvi & Gabriella Ambrus
Titel des Beitrags: Besonderheiten der Entwicklung des mathematischen Denkens in der Ausbildung von Mathematiklehrerinnen und -lehrern für die Jahrgangstufen 5-8 und 9-12
Erste Seite: 325
Letzte Seite: 342
Abstract
Eine wichtige Aufgabe des schulischen Mathematikunterrichts ist die Entwicklung des mathematischen Denkens. Dafür sind unterschiedliche Möglichkeiten für Schülerinnen und Schüler unterschiedlichen Alters vorzusehen. Dies ist beispielsweise bei den Altersgruppen der Ober- und Sekundarstufe der Fall. Die Berücksichtigung von Altersunterschieden und -verhältnissen im Mathematikunterricht sollte sich auch in der Ausgestaltung der Struktur der Ausbildung angehender Lehrkräfte niederschlagen.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872720.0.17
Verfasser*innen: Manfred Borovcnik & Ödön Vancsó
Titel des Beitrags: Die Entwicklung stochastischen Denkens
Erste Seite: 345
Letzte Seite: 384
Abstract
Stochastisches Denken beinhaltet den Umgang mit Unsicherheit und die Einbeziehung von Wahrscheinlichkeiten in die Entscheidungsfindung, wobei die Variabilität und die unvollkommenen Informationen in der realen Welt berücksichtigt werden. Es umfasst Schlüsselelemente wie Wahrscheinlichkeitsbewertung, Erkennen von Unsicherheit, Datenanalyse, Aktualisierung von Überzeugungen, Risikobewertung, Entscheidungsfindung unter Unsicherheit, Szenario-Analyse und Bayessches Denken. Im ersten Abschnitt befassen wir uns mit probabilistischem und statistischem Denken und dem Unterschied zwischen diesen beiden Denkweisen. Probabilistisches Denken ermöglicht es dem Einzelnen, mit Ungewissheiten umzugehen, fundierte Entscheidungen zu treffen und die Variabilität der Welt zu verstehen. Obwohl es dem statistischen Denken ähnlich ist, unterscheidet es sich in Bezug auf Schwerpunkt, Umfang, Kontext, Methodik und Anwendung. Um probabilistisches Denken zu fördern, werden Schlüsselkonzepte hervorgehoben, darunter Wahrscheinlichkeit, Quantifizierung von Wahrscheinlichkeiten, Ungewissheit, bedingte Wahrscheinlichkeit, Unbeständigkeit, Stichproben, Variation und Verteilung sowie Erwartungswert. Das Verständnis dieser Konzepte verbessert das probabilistische Denken und die Entscheidungsfähigkeit. Die Betonung dieser Konzepte im Unterricht durch Beispiele und Visualisierungen vertieft das Verständnis und die Anwendung probabilistischen Denkens.
Im zweiten Abschnitt wird die Rolle der Intuition, der grundlegenden Ideen und des stochastischen Denkens im Mathematikunterricht mit Schwerpunkt auf Wahrscheinlichkeit erörtert. Die Aneignung von Konzepten beinhaltet ein Zusammenspiel zwischen primären Intuitionen und theoretischem Input. Theoretische Konzepte zielen darauf ab, sekundäre Intuitionen aufzubauen, aber isolierte Konzepte haben wenig nachhaltige Wirkung. Der Ansatz des operativen Konzepterwerbs ist für die Wahrscheinlichkeit aufgrund der Unsicherheit begrenzt. Über grundlegende Ideen der Wahrscheinlichkeit, wie z. B. die Überprüfung von Informationen und statistische Schlussfolgerungen gibt es durchaus unterschiedliche Auffassungen. Es gibt verschiedene Auslegungen der Wahrscheinlichkeit: frequentistisch, subjektiv und a priori. Stochastisches Denken und Intuition prägen theoretische Konzepte, und die Wahrnehmung von Zufallsvariationen ist in der Statistik von entscheidender Bedeutung. Die deskriptive Statistik, die Wahrscheinlichkeitstheorie und die statistische Schlussfolgerung bieten unterschiedliche Sichtweisen auf dieselben Informationen. Bei der statistischen Schlussfolgerung geht es um die Repräsentativität von Stichproben und um Zufallsstichproben. Der Text hebt die Bedeutung von Intuition, grundlegenden Ideen und stochastischem Denken im Mathematikunterricht hervor und betont die Erforschung von Interpretationen und Perspektiven für ein tieferes Verständnis der Wahrscheinlichkeit.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872720.0.18
Verfasser*innen: Regina Bruder
Titel des Beitrags: Raum und Form als Leitidee zur Strukturierung mathematischen Denkens
Erste Seite: 385
Letzte Seite: 412
Abstract
In diesem Beitrag werden ausgehend von einem gestuften Ansatz zur Operationalisierung von mathematischen Denkaktivitäten (Lernhandlungen) im Rahmen der Leitidee „Raum und Form“ curriculare Aspekte im Kontext der aktuellen deutschen Bildungsstandards bis zum mittleren Schulabschluss betrachtet und beispielhaft diskutiert. Im Zentrum stehen zwei Ansätze zur Weiterentwicklung der Kerncurricula: Ein Weg zur Verknüpfung von allgemeinen (prozessbezogenen) Kompetenzen und Lerninhalten verbunden mit der Aufnahme von grundlegendem Metawissen über die relevanten Lernhandlungen, die damit dann selbst zum Lerngegenstand werden, sowie eine strukturelle Verankerung kumulativen Kompetenzaufbaus zu den relevanten Lernhandlungen über verschiedene Stützpfeiler im Spiralcurriculum.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872720.0.19
Verfasser*innen: Emese Vargyas & Ysette Weiss
Titel des Beitrags: Geometrisches Denken – der Satz des Thales als Werkzeug und Untersuchungsgegenstand in Lehrbüchern
Erste Seite: 413
Letzte Seite: 432
Abstract
Dieser Beitrag möchte eine Brücke zwischen typischen Denk- und Herangehensweisen in den universitären Mathematikveranstaltungen und der Begriffsentwicklung in der Elementargeometrie im Schulunterricht schlagen. Inwieweit sind die in deutschen Lehrbüchern angeregten Zugänge zum Satz des Thales exemplarisch für das mathematische Arbeiten? Welche Zugänge zur Mathematik, welche Wesenszüge der Mathematik werden dabei angesprochen? Anhand repräsentativer Lehrbuchbeispiele werden die dort vorgenommenen Begriffsentwicklungen diesbezüglich analysiert und implizit vermittelte Vorstellungen mathematischen Arbeitens und geometrischen Beweisens reflektiert.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872720.0.20
Verfasser*innen: Gabriella Ambrus
Titel des Beitrags: Problemlösendes und modellierendes Denken in sogenannten Aufsatzaufgaben
Erste Seite: 433
Letzte Seite: 450
Abstract
Zu den Komponenten des mathematischen Denkens gehören das modellierende und das problemlösende Denken, die nicht unabhängig voneinander sind. Während beide im schulischen Mathematikunterricht eine wichtige Rolle spielen, gibt es bei den Vermittlungsmöglichkeiten des modellierenden Denkens mehr Fragezeichen. Besonderes Augenmerk wird in dieser Studie auf solche Modellierungsaufgaben gelegt, die rechnerisch begründete Stellungnahmen zu der Fragestellung einer realen Situation verlangen und hier als Aufsatzaufgaben bezeichnet werden.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959872720.0.21