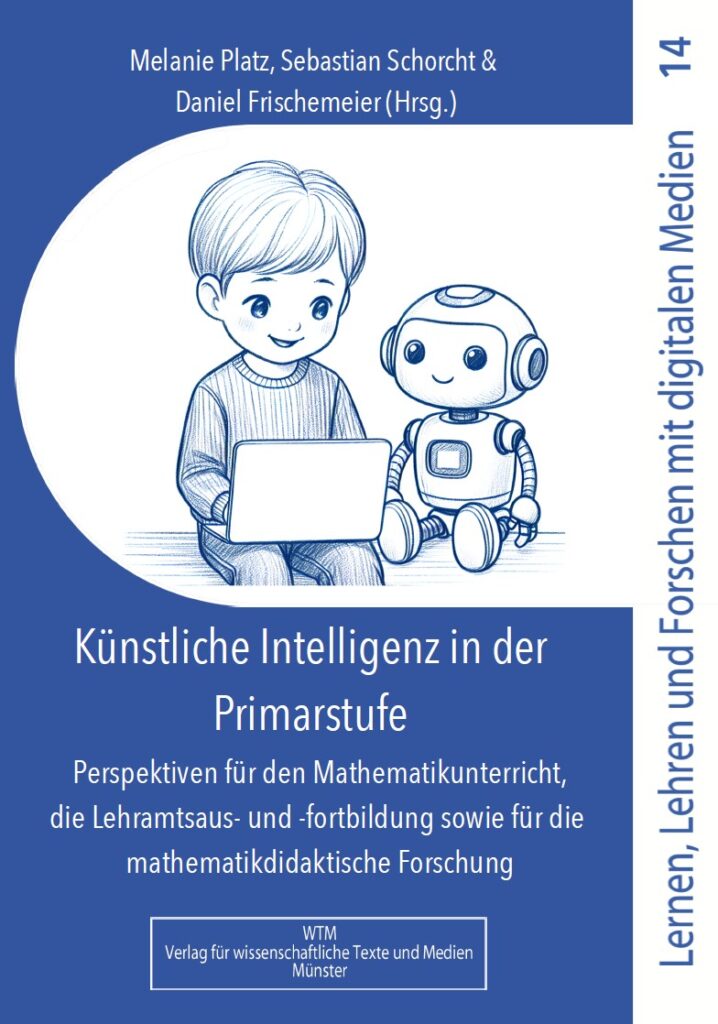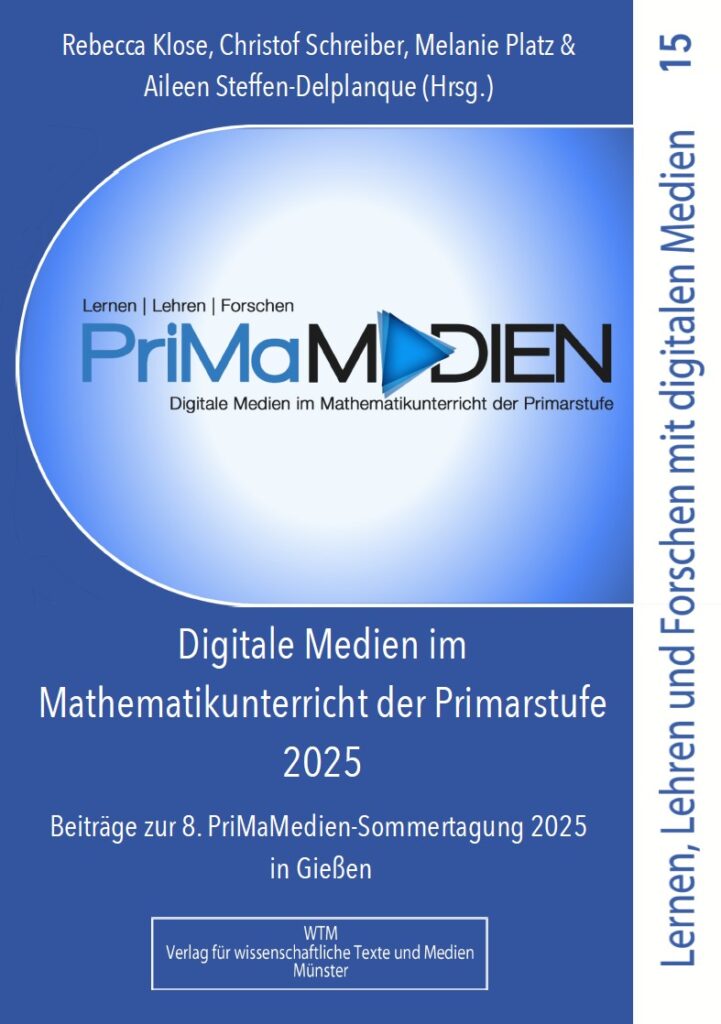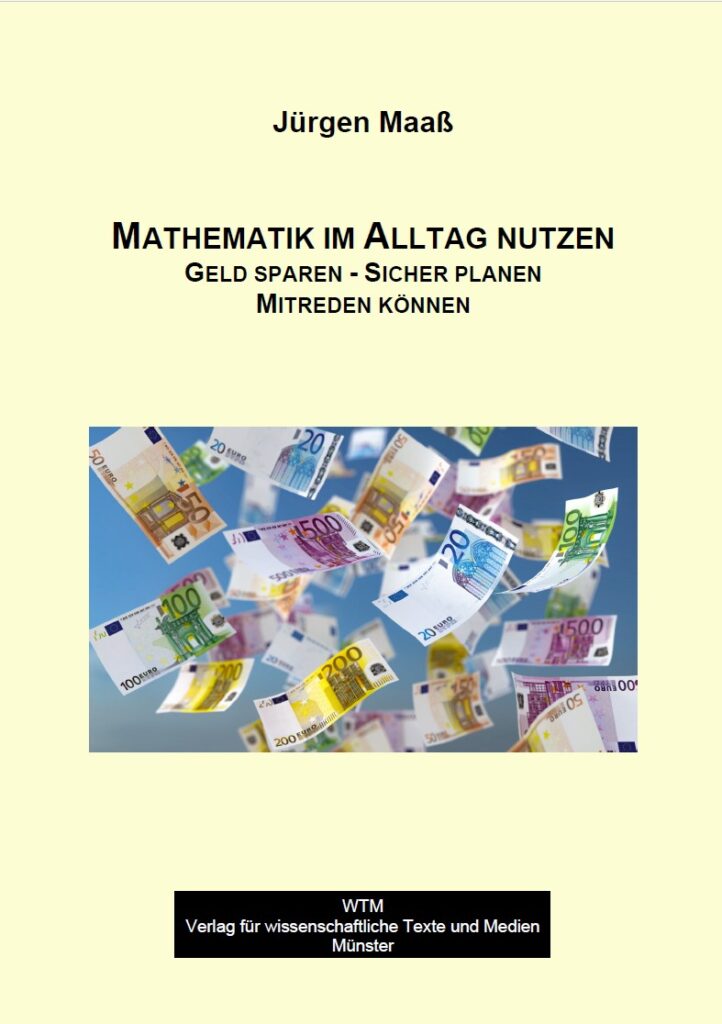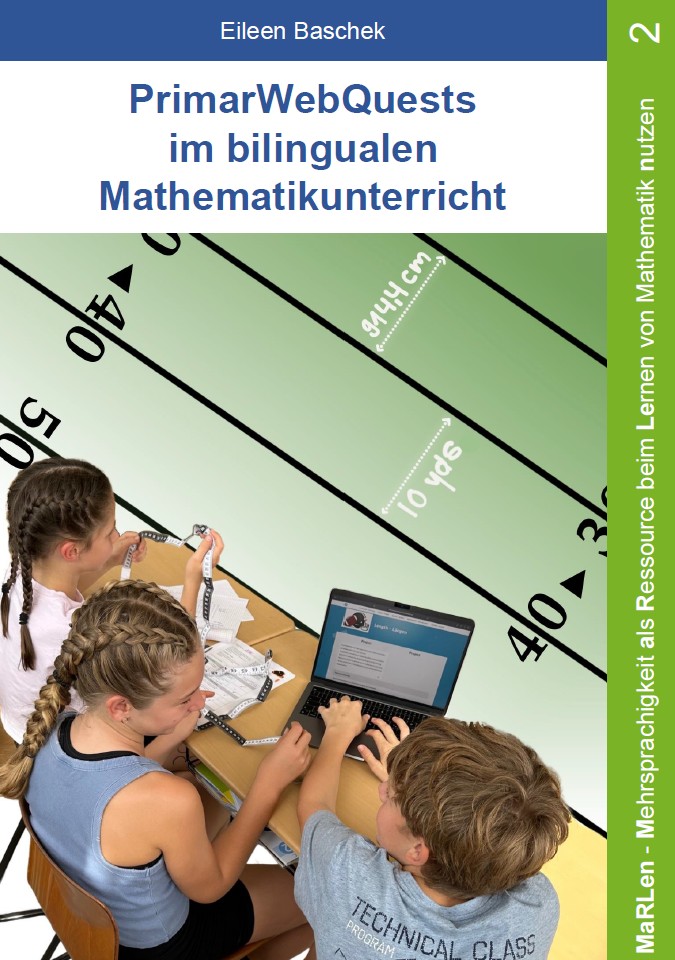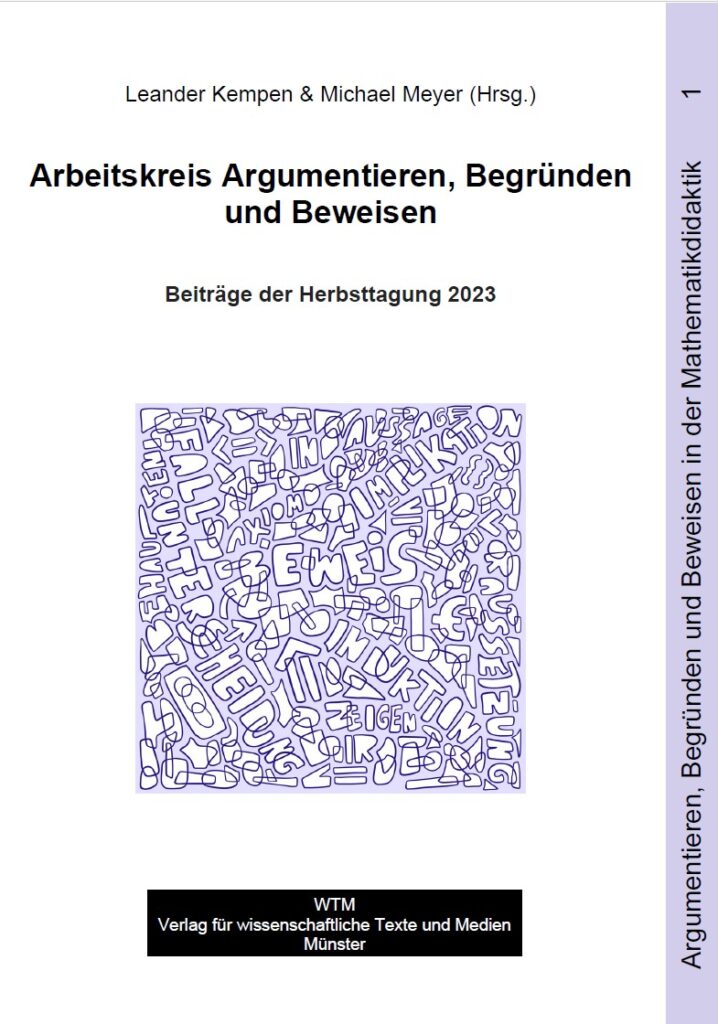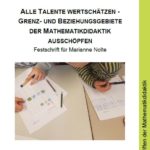 Festschrift für Marianne Nolte
Festschrift für Marianne Nolte
Münster 2019, ca. 310 S.
Print: ISBN 978-3-95987-121-1, 35, 90 €
Ebook: ISBN 978-3-95987-122-8, 32,90 €
https://doi.org/10.37626/GA9783959871228.0
Für Bestellungen bei edition-buchshop hier klicken
Diese Festschrift ist Frau Professorin Dr. Marianne Nolte zum Eintritt in den Ruhestand gewidmet. Die Autor*innen sind nationale und internationale Kolleg*innen aus ihrer akademischen Schaffenszeit. Neben Beiträgen aus der Mathematikdidaktik, u.a. zur besonderen mathematischen Begabung und zur Rechenschwäche, den Arbeitsschwerpunkten Prof. Noltes, finden sich Artikel benachbarter Disziplinen – der Mathematik, der Erziehungswissenschaft, der Kinder- und Jugendpsychologie, der integrativen Lerntherapie und der Deutschdidaktik – in diesem Band wieder.
Nach einem Geleitwort von Herrn Professor Dr. Karl Kießwetter sind Aufsätze folgender Autor*innen enthalten:
- Miriam Bachmann
- Anna Bock
- Torsten Fritzlar
- Klaus Hasemann
- Friedhelm Käpnick, & Ralf Benölken
- Susanne Koch
- Günter Krauthausen
- Roza Leikin
- Jens-Holger Lorenz
- Elisabet Mellroth
- Carl Ludwig Naumann & Susanne Wilckens
- Angelika Nührig
- Kirsten Pamperien & Arne Pöhls
- Hartmut Rehlich
- Maike Schindler & Benjamin Rott
- Michael Schulte-Markwort
- Marcus Schütte, Judith Jung & Götz Krummheuer
- Linda J. Sheffield
- Martin Stein & Jana Thiele
- Peter Stender
- Thomas Trautmann
- Ulrich Vieluf, Stanislav Ivanov & Roumiana Nikolova
- Katrin Vorhölter & Gabriele Kaiser
Kießwetter, Karl: Die William-Stern-Gesellschaft und ich sagen: „Wir danken, – und wir hoffen auf eine weitere gute Zusammenarbeit“. pp 10 – 17
https://doi.org/10.37626/GA9783959871228.0.01
Bachmann, Miriam: Wenn Zahlen zur Last werden. pp 18 – 23
Der Beitrag erzählt die Geschichte von Paula, einem 8-jährigen Mädchen. Und wie wichtig es für Kinderpsychiater und Psychotherapeuten ist, das Denken und Wesen ihrer Patienten zu verstehen.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871228.0.02
Bock, Anna: Inklusiven Mathematikunterricht mit anderen Augen sehen – Chancen und Gelingensbedingungen interdisziplinärer Tandems in der Lehrer*innenbildung. pp 24 – 30
Im Zuge der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention hat die Bundesrepublik Deutschland sich verpflichtet, ein inklusives Bildungssystem umzusetzen (UN CRPD, Artikel 24). Damit einhergehend ergeben sich komplexe Anforderungen an Lehrkräfte im Mathematikunterricht (u.a. Wolfswinkler et al. 2014, Nolte & Pamperien 2017), sodass Lerngelegenheiten in der Lehramtsausbildung, die auf das inklusive Unterrichten vorbereiten, an Bedeutung gewinnen. Ein möglicher Ansatz sich diesem Ziel zu nähern ist es, die Kooperation von Studierenden der Sonderpädagogik und des Regelschullehramtes mit dem Fach Mathematik in der Ausbildung zu unterstützen (Nolte & Bock 2019). Unter dieser Prämisse wurde an der Universität Hamburg, im Rahmen des Projekts ProfaLe1, ein neues Seminarkonzept zum inklusiven Mathematikunterricht entwickelt und evaluiert. Das Seminarkonzept bezieht die Kooperation in Tandems von Lehramtsstudierenden der Sonderpädagogik sowie der Mathematikdidaktik anhand von Fallarbeit2 mit ein. Im Anschluss an das Seminar wurden die Studierenden in einem Interview zu den interdisziplinären Tandems befragt. Ausschnitte aus diesen Interviews, die Einblicke in die wahrgenommenen Chancen und Gelingensbedingungen der interdisziplinären Fallarbeit geben, werden in diesem Beitrag dargestellt und diskutiert.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871228.0.03
Fritzlar, Torsten: Zur Erfassung formaler Strukturen mathematikhaltiger Situationen. pp 32 – 43
Fähigkeiten im Umgang mit Mustern und Strukturen in mathematisch reichhaltigen Situationen werden weithin als Merkmal mathematischer Begabungen im Grundschulalter angesehen. In einschlägigen Arbeiten werden diese Fähigkeiten allerdings mit teilweise unterschiedlichen Akzentuierungen beschrieben. Mit diesem Beitrag sollen eine vergleichende Betrachtung angeregt und mögliche Ergänzungen bisheriger diagnostischer Ansätze zur Diskussion gestellt werden.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871228.0.04
Hasemann, Klaus: Mentales Repräsentieren und das Erfassen von Mustern in der mathematischen Denkentwicklung. pp 44 – 55
Bereits in der Vorschulzeit und in ihren ersten Schuljahren entdecken die Kinder, selbstständig oder durch Anleitung, wie sie sich Repräsentanten von Objekten verschaffen können, die nicht sichtbar oder nur in der Vorstellung vorhanden sind. Sie erkennen Muster und nutzen sie zum Lösen von Aufgaben und in mathematikhaltigen Situationen. Im Folgenden werden Beispiele dazu aus empirischen Untersuchungen und aus der Literatur vorgestellt und interpretiert. Der Blick ist dabei insbesondere auf Kinder gerichtet, bei denen die Fähigkeiten zum Umgehen mit mathematischen Gegenständen besonders gut bzw. weniger gut ausgeprägt sind.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871228.0.05
Käpnick, Friedhelm; Benölken, Ralf: Mathematisch-produktives Forschen in inklusiven Lernsettings. pp 56 – 71
Die enorme und scheinbar immer weiter zunehmende „Heterogenität“ unter den Kindern lässt unter vielen Lehrkräften, aber auch unter einigen Wissenschaftlern/innen Zweifel aufkommen, ob ein inklusives Lernen im Regelunterricht gelingen kann. Um hierauf jedoch eine begründete Antwort geben zu können, ist es notwendig, verschiedene Perspektivebenen des komplexen Systems „(Inklusiver) Unterricht“ zu betrachten und diese einzeln sowie – was entscheidend ist – im Gesamtsystem sachlich-konstruktiv zu werten. In diesem Beitrag geht es um ein dementsprechendes Hinterfragen von Gelingensfaktoren für einen inklusiven Mathematikunterricht in der Grundschule. Ausgehend von einer potenzialorientierten Sicht auf Inklusive Bildung ist der Hauptfokus dabei zunächst auf geeignete Aufgaben für einen inklusiven Mathematikunterricht gerichtet, weil Aufgaben eine „Schlüsselrolle“ für jegliche Lernaktivitäten von Schüler/innen im Mathematikunterricht spielen. Aus potenzialorientierter Sicht, wonach Unterricht prinzipiell vorrangig aus einer kindorientierten Perspektive betrachtet werden sollte, erscheinen offene substanzielle Aufgaben mit Möglichkeiten zum forschend-produktiven Mathematiktreiben – entsprechend den jeweiligen individuellen Lernvoraussetzungen jeder Schülerin bzw. jedes Schülers – besonders geeignet. Dieser Ansatz spiegelt auch einen aktuellen Trend in der deutschen Mathematikdidaktik wider (vgl. z.B. Benölken, Dexel & Berlinger, 2018; Fuchs, 2015; Häsel-Weide & Nührenbörger, 2017; Käpnick, 2016). Eine konkrete Aufgabenidee für ein solches mathematisch-produktives Forschen verdanken wir Marianne Nolte. Sie schlug uns vor vielen Jahren im Rahmen eines gemeinsamen Ideenaustausches zu geeigneten Aufgaben für die Förderung mathematisch begabter Grundschulkinder das Erforschen von 4×4-Sudoku-Quadraten vor. Wir haben diese schöne Idee seitdem vielfach in unseren Projektgruppen zur Förderung von mathematisch begabten Drittklässlern/innen (im Projekt „Mathe für kleine Asse“, zum Konzept z.B. Käpnick, 2008) wie auch von Kindern mit Rechenproblemen (im Projekt „MaKosi“, d.h. „Mathematische Kompetenzen sichern“, zum Konzept Benölken, 2016) an der Universität Münster eingesetzt – stets erfolgreich und wir haben dabei immer wieder neue kreative Lösungsideen von Kindern mit sehr verschiedenen Leistungspotenzialen erfahren. Dies soll im Folgenden anhand authentischer Eigenproduktionen von Kindern dokumentiert werden. Ausgehend von Impressionen dieser vermeintlich „kontrastierenden“ Gruppen, die den Nutzen offener substanzieller Problemfelder für einen potenzial- und damit kindorientierten inklusiven Mathematikunterricht aufzeigen können (siehe auch Nolte & Pamperien, 2016; Hirt & Wälti, 2014), werden anschließend Querbezüge zu anderen wichtigen Gelingensbedingungen für einen inklusiven Mathematikunterricht hergestellt.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871228.0.06
Koch, Susanne: Zur Vernetzung fachdidaktischer und fachwissenschaftlicher Aspekte von Problemaufgaben für die Grund- und Mittelstufe. pp 72 – 86
https://doi.org/10.37626/GA9783959871228.0.07
Krauthausen, Günter: Muster finden – Eine Anforderung für Grundschulkinder und Studierende. pp 88 – 101
Im Rahmen der PriMa-Maßnahme (Kinder der Primarstufe auf verschiedenen Wegen zur Mathematik; Nolte 2015) werden den mathematisch besonders begabten Kindern elementarmathematische Problemstellungen angeboten, die eine motivierende Herausforderung darstellen sollen. Der vorliegende Beitrag beschreibt, wie eine typische Aufgabe aus dieser Fördermaßnahme strukturerhaltend für die Lehramtsausbildung der Grundschule adaptiert wurde. Ziel war es, den Studierenden sowohl Lernchancen im Hinblick auf ihr Verständnis von Mathematikunterricht, von Mathematik lernenden Kindern als auch für die eigene Professionalisierung als zukünftige Mathematik-Lehrperson zu eröffnen.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871228.0.08
Leikin, Roza: Solving problems using symmetry as a creativity-directed activity in teacher education. pp 102 – 113
https://doi.org/10.37626/GA9783959871228.0.09
Lorenz, Jens-Holger: Sachaufgaben im Mathematikunterricht – Das Verhältnis von Sprachverstehen und arithmetischen Kompetenzen. pp 114 – 124
Der Beitrag versucht die Untersuchungs- und Erkenntnisfortschritte zu skizzieren, welche durch die Arbeiten von Marianne Nolte Ende des letzten Jahrhunderts angestoßen wurden und sich zu einem wachsenden Problem im Mathematikunterricht entwickelten. Es wird auf die sich durch geänderte gesellschaftliche Entwicklungen wachsenden Anforderungen eingegangen, die Lehrkräfte zu bewältigen haben, um Kinder mit heterogenen Sprachkompetenzen zu einem Bild von Mathematik zu führen. Das Verhältnis von Sprache und Mathematik, gemeinhin als konträr konzipiert, wird im Unterricht spannungsreich zusammengeführt. Hierauf muss Mathematikdidaktik Antworten parat haben, soll nicht chronisches Missverständnis das Ergebnis von Unterricht sein.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871228.0.10
Mellroth, Elisabet: Swedish teachers´ perspectives on educating highly able pupils. pp 126 – 133
This text is a brief summary of two studies presented in my doctoral thesis. The aim of the studies was to capture teachers’ perspectives on orchestrating teaching of mathematically highly able pupils (MHAPs) in diverse classroom. Positioning theory was used to analyze teachers’ (N=17) discussions in the context of a long term (two-year, 120 h) professional development programme on gifted education. The results show that, when teachers connect theories of gifted education with their teaching expertise, they express possibilities and obstacles, but also rights and duties, in their professional task, to include MHAPs in classroom learning. The teachers express a duty to collaborate with colleagues to meet the learning needs of MHAPs. Differentiation and well-composed mathematical tasks are suggested as possible ways of catering for those needs. Through the lens of positioning theory, the results show that teachers have deep knowledge of what constitutes high ability and that they have the power to orchestrate teaching to meet the needs of MHAPs. Whether they can or do use this power, however, is a question yet to be explored.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871228.0.11
Naumann, Carl Ludwig; Wilckens, Susanne: Das Krümmen des Häkchens – Einstellungen zu Rechtschreibung, Lesen und LRS (sowie zu Rechnen und Dyskalkulie) am Beginn und nach dem Ende der Schulzeit – deutschdidaktische Erwägungen. pp 134 – 153
Das schriftbezogene akademische Selbstkonzept, vor allem zu Beginn und nach der Schulzeit, und die landläufige Auffassung von Schrift als regellos werden beleuchtet. Zum Verständnis der Schrift und ihres Erwerbs dienen parallele Phänomene bei der Zahl und ihrem Erwerb. Für lese-rechtschreib-schwache SchülerInnen werden zwei Hilfen herausgestellt: Das Arbeitsbündnis zwischen Kind, Lehrkraft und Eltern und eine klarere Sicht auf den Lese-Zweck und die hochgradige Strukturiertheit der Schrift
https://doi.org/10.37626/GA9783959871228.0.12
Nührig, Angelika: Daniel lernt eben später lesen, schreiben und rechnen – ein Fallbericht aus der integrativen Lerntherapie. pp 154 – 167
Den Titel dieser Festschrift assoziiere ich mit der Entstehung des Masterstudiengangs für integrative Lerntherapie und damit mit dem gemeinsamen Diskurs, an dem u. a. Marianne Nolte, Helga Breuninger, Carl Ludwig Naumann und die Verfasserin beteiligt waren. Die Zusammenarbeit und die Gespräche waren stets geprägt von der gegenseitigen Wertschätzung der Beteiligten und einem angemessenen Fehler bejahenden und ressourcenorientierten Blick. Nur so konnte ein Curriculum entwickelt und erfolgreich umgesetzt werden, das dazu beiträgt, dass lerntherapeutische Persönlichkeiten mit dem vielfältigen Fach-Wissen, einem gut ausgeprägten diagnostischen Blick und einer großen Bandbreite an methodischem Repertoire die für jeden Einzel-„Fall“ notwendigen didaktischen Entscheidungen treffen.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871228.0.13
Pamperien, Kirsten; Pöhls, Arne: Förderung mathematisch besonders begabter Grundschulkinder – am Beispiel des Uni-Projektes der Maßnahme PriMa. pp 168 – 179
Seit fast 20 Jahren wird unter dem Namen PriMa (Kinder der Primarstufe auf verschiedenen Wegen zur Mathematik) eine Kooperationsmaßnahme der Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg, der William-Stern-Gesellschaft Hamburg (WSG) und der Beratungsstelle besondere Begabungen (BbB) der Behörde für Schule und Berufsbildung/Landesinstitut Hamburg durchgeführt, die einerseits zur Steigerung der Effizienz des Mathematikunterrichts in der Grundschule beitragen und andererseits mathematisch interessierte und begabte Schülerinnen und Schüler (ab der 3. Klasse) fördern soll. Diese Maßnahme bietet mathematisch besonders begabten und mathematisch besonders interessierten Schülerinnen und Schülern der dritten und vierten Klasse Förderangebote (Uni- Zirkel) an der Universität Hamburg unter der Leitung von Frau Prof. Dr. M. Nolte und in ca. 70 Grundschulen (Mathe-Zirkel) in ganz Hamburg. Parallel dazu werden an der Universität und im Landesinstitut Lehrerbildung Mathematiklehrkräfte zu Mathematik-Moderator*innen weitergebildet. Die Maßnahme besteht aus den drei Teilmaßnahmen „Uni-(Mathe-) Zirkel”, „(Schul-)Mathe-Zirkel“ und “Qualifizierung von Mathematik-Moderatorinnen/-Moderatoren” (vgl. Nolte, 2015). Dieser Artikel befasst sich mit der universitären Teilmaßnahme zur Förderung von Dritt- und Viertklässlern. Nach einer dreistufigen Talentsuche wird etwa 50 Kindern das Angebot gemacht, sich ca. alle zwei Wochen an der Universität mit mathematisch interessanten Problemfeldern zu befassen. Diese wurden zu sogenannten progressiven Forscheraufgaben (ProFa) aufbereitet und weiterentwickelt, um als Enrichmentangebot herauszufordern und den Kindern die Möglichkeit zu geben, ihr mathematisches Potenzial zu entfalten. Nach einem kurzen Überblick über die theoretischen Grundlagen bezogen auf mathematische Begabung im Grundschulalter und deren Identifikation wird die Talentsuche des PriMa-Projektes vorgestellt. Im Anschluss daran beschäftigen wir uns mit den progressiven Forscheraufgaben, ihrem Einsatz und dem günstigen Verhalten der Lehrkraft in den Fördergruppen der Uni-Zirkel. Anhand eines Aufgabenbeispiels wird die Förderung veranschaulicht.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871228.0.14
Rehlich, Hartmut: Anschlussaufgaben im Schülerzirkel. pp 180 – 187
Hamburg bietet mathematisch interessierten Schülerinnen und Schülern ein breites Spektrum an Fördermöglichkeiten, zu denen auch die Schülerzirkel gehören, die vor mehr als 25 Jahren von der mathematischen Gesellschaft Hamburg ins Leben gerufen wurden. Der in den Schuljahren 2016 und 2017 von mir angebotene zentrale Zirkel am Geomatikum wurde von Schülern der achten bis zur dreizehnten Klasse besucht und hier lernte ich viele ehemalige Teilnehmer des PriMa-Projekts kennen, die durch ihre muntere fachverliebte Art immer besonders viel zu einem fröhlichen produktiven Arbeitsklima beigetragen haben. Für diese Schüler – es gab natürlich auch Teilnehmer, die vorher nicht im PriMa-Projekt waren, bot der Schülerzirkel „Anschlussaufgaben“. Die Auswahl dieser Aufgaben orientiert sich am Fachlichen und nicht an modernen Moden, wie der sog. Kompetenzorientierung und der Modellierungsmanie. Die eigentliche Quelle höherer Fach- und Kulturbildung ist der Homo ludens mit seinem intellektuellen Spieltrieb, der ganz wesentlich von ästhetischen Empfindungen gesteuert wird. Letztere scheinen den Propagandisten moderner didaktischer Lehren abzugehen, denn anders kann man sich die inflationäre Verwendung von unschönen und phrasenhaften Wortverbindungen wie „Systematisierungskompetenz“, „Darstellungskompetenz“, „Reflexionskompetenz“, ja, sogar „Ich-Kompetenz“ und „Beweiskompetenz“ (!), etc., die nach schlechten Scherzen klingen, nicht erklären. Wir müssen mittlerweile damit rechnen, dass die kleinen Kinder hierzulande sehr bald nicht mehr trocken werden, sondern Töpfchenkompetenz erwerben, wenn dieser pisaesken Sprachverhunzung nicht schnell Einhalt geboten wird. Im Schülerzirkel und auch im Hamburger Projekt zur Hochbegabtenförderung – und ich denke auch im PriMa-Projekt – sehen wir immer wieder, dass vor allem schöne mathematische Inhalte viele Schüler interessieren und sie zur produktiven Beschäftigung reizen, auch wenn – oder sogar weil – sie keinen unmittelbaren Lebensbezug haben.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871228.0.15
Ricken, Gabrielle: Sich vorbereiten auf eine inklusive Schule – das gelingt an der Universität? pp 188 – 198
Lehrkräfte sollen es schaffen; Studierende sich in der Universität vorbereiten: Moderne Schulen sollen inklusive sein! Die Vielfalt in den Voraussetzungen ist das Herausfordernde an dieser Idee: Lernende und Lehrende unterscheiden sich in Erfahrungen, Kenntnissen und Perspektiven. Unterschiede wie Alter, Geschlecht, soziale Herkunft sind vertraut, andere wie Förderbedarfe verunsichern noch. Oft liest man, dass inklusive Aufgaben kooperativ besser bewältigt werden könnten. Das geht aber nur, wenn die Vielfalten „aufeinander treffen“. Wie gelingt Kooperation, wie verbinden Lehrende ihre Perspektiven? Kann man an der Universität individuelle Kompetenzen „verzapfen lernen“? Was muss man überhaupt für einen inklusiven Unterricht können?
https://doi.org/10.37626/GA9783959871228.0.16
Schindler, Maike; Rott, Benjamin: Mathematische Begabungen inklusiv(e): Schulische Inklusion mit Blick auf mathematische Begabungen. pp 200 – 212
https://doi.org/10.37626/GA9783959871228.0.17
Schulte-Markwort, Michael: Und Rechnen mag ich einfach nicht! pp 214 – 219
https://doi.org/10.37626/GA9783959871228.0.18
Schütte, Marcus; Jung, Judith; Krummheuer, Götz: Mathematische Denkentwicklung durch Teilhabe an narrativen und formalen Diskursen – Eine interaktionistische Perspektive. pp 220 – 231
Der folgende Beitrag befasst sich mit dem Mathematiklernen in der frühen Kindheit. Das Lernen von Mathematik wird in vielen Ansätzen theoretisch als ein innerpsychisch zu verortender Prozess modelliert (vgl. u. a. Hasemann & Gasteiger 2014). Soziale Interaktion wird in diesen Theorien zumeist als „kontingente Randbedingung“ (Krummheuer 1992), also als für das Verstehen vom ‚Wesen‘ des Mathematiklernens nicht notwendiges Phänomen, begriffen. Die im folgenden Artikel entwickelte Perspektive grenzt sich von dieser Sichtweise insofern ab, als dass sie der Annahme folgt, dass sich das Erlenen von mathematischen Fähigkeiten durch und im Austausch mit anderen Individuen grundlegender verstehen und beschreiben lässt. Danach rücken die Interaktion der Beteiligten und der gemeinsame mathematische Aushandlungsprozess in den Fokus der Betrachtung. Im Ergebnis zeigt sich, dass sich frühes mathematisches Lernen oder, wie im Weiteren ausgeführt wird, die mathematische Denkentwicklung als Teilhabe an narrativen oder formalen Diskursen beschreiben lässt.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871228.0.19
Sheffield, Linda J.: Incorporating Spatial Reasoning in the Development of Students with Exceptional Mathematical Promise and Creativity. pp 232 – 241
Spatial reasoning is a critical component of science, technology, engineering, art and mathematics (STEAM) educational and occupational innovation and expertise and should be an integral part of any mathematics curriculum. However, in the United States, it is often neglected. Spatial ability was once believed to be a fixed trait, but there is now widespread evidence that it can and should be recognized and developed beginning at very early ages and continuing throughout the educational system. The U. S. National Science Foundation-funded Project M2: Mentoring Young Mathematicians for students in kindergarten through second grade is one example of a proven program for the development of children’s spatial thinking. In spite of at least sixty years of research in this area, much remains to be done.
Key words: spatial reasoning, mathematics, gifted, exceptional promise, STEAM, innovation
https://doi.org/10.37626/GA9783959871228.0.20
Stein, Martin; Thiele, Jana: Mathe-Meistern – ein online-Diagnose-Tool für berufliche Schulen. pp 242 – 257
Lehrer*innen an Schulen im Bereich der beruflichen Bildung machen immer wieder die Erfahrung, dass die Spannbreite unterschiedlicher Bildungsvoraussetzungen mit den Bildungsplänen des Berufskollegs konfligiert. Einheitliche Eingangsbzw. Grundvoraussetzungen der Schüler*innen innerhalb der einzelnen am Berufskolleg angebotenen Bildungsgänge sind nicht gegeben. Im Projekt mathemeistern wurde diese Problematik aufgegriffen und insgesamt vier online-Tests für Berufskollegs mit dem Ziel entwickelt, die Mathematikleistung der Schüler*innen zu diagnostizieren. Bei den mathe-meistern-Tests handelt es sich um Multiple-Choice-Tests mit bis zu 65 Items, der online mit Transaktionsnummern ausgefüllt werden kann. Inhaltlich werden bei dem Test die mathematischen Inhaltskategorien (Arithmetik, Algebra, Bruchrechnung, Geometrie, …) und die mathematischen Kompetenzen (Darstellungen verwenden, Mathematik anwenden, …) abgefragt. Im Rahmen dieses Artikels wird das mathe-meistern-Projekt hinsichtlich der Service- und Forschungskomponente näher betrachtet.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871228.0.21
Stender, Peter: Heuristische Strategien in der Grundschule. pp 258 – 272
Heuristische Strategien sind ein zentraler Gegenstand didaktischer Forschung im Bereich des Problemlösens und der Förderung besonders Begabter. Heuristische Strategien durchdringen jedoch darüber hinaus alle Bereiche der Mathematik: wenn beim Kreieren eines mathematischen Gegenstandes Probleme überwunden wurden, was überwiegend der Fall ist, dann bleiben Spuren der dabei verwenden heuristischen Strategien im mathematischen Gegenstand sichtbar oder rekonstruierbar. Bei der Verwendung oder beim Erlernen des entsprechenden Gegenstandes
kommen diese Strategien dann häufig wieder zum Tragen, was aber oft nur implizit geschieht. Hier werden diese heuristischen Strategien an einem Beispiel aus der Grundschulmathematik explizit gemacht.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871228.0.22
Trautmann, Thomas: Tiefer blicken … Zu Möglichkeiten und Grenzen mehrdimensionaler diagnostischer Fallberatung in der Grundschule. pp 274 – 285
Kinder sind nicht dümmer als Erwachsene, sie haben nur weniger Erfahrungen. Ungefähr so äußerte sich Janusz Korczak (vgl. 1972) in seinem Król Maciuś Pierwszy. In meiner langen Zusammenarbeit mit Marianne Nolte hatte ich niemals das Gefühl, Kinder wären in Mariannes Weltbild weniger erfahren oder gar dumm. Im Gegenteil – nach meiner Auffassung schätzte sie gerade unverstellte kindliche Wahrnehmung als besonders, andersartig, inspirierend und somit stets lohnend, sich damit gründlich zu beschäftigen. Auf dieser Denk-Art entstand der vorliegende Beitrag. Er will uns a. mit eigentümlichen kindlichen Selbstzeugnissen konfrontieren und b. zum eigenen Denken anregen – zum Denken über kindliche Welten, unsere individuellen und professionsspezifischen Modelle von Heranwachsenden und letztlich über unsere Kompetenzen, auf Augenhöhe mit ihnen zu arbeiten (vgl. Trautmann/Trautmann 2016 S. 226). Drittens (c) soll die Methode der Datengewinnung dargestellt werden – die zwischen einer Kindbegleitstudie1 und der mehrperspektivischen diagnostischen Fallberatung (MeDiFa) angesiedelt ist. Unser Gewährskind und Protagonist dafür soll der neunjährige Drittklässler Leo sein, der eingangs folgendermaßen skizziert werden soll.
„Neben seiner Leidenschaft für Fußball, der er in den Hofpausen engagiert aber inkompetent nachgeht, ist Leo in seiner Klasse eher aufgrund der Tatsache bekannt, ein hervorragender Schachspieler zu sein. Dieses Können beschert ihm einen gewissen Grad der Anerkennung sowie Selbstbewusstsein und macht ihn für viele Kinder zu einem beliebten Schachpartner. Fast ebenso typisch für Leo ist seine ausgeprägte mathematische Begabung, was ihn vom Umfeld seiner mathematikbegabten Klasse jedoch nicht vergleichbar abhebt, genau so wie seine Fähigkeiten im Schachspiel. Fremden gegenüber scheint Leo generell eher mit Zurückhaltung und Wortkargheit zu begegnen“ (Trautmann 2014 S. 153).
Im Beitrag soll anhand dieses Jungen die individuelle Ausprägung von Begabungen im schulischen Aufeinandertreffen von Disposition und Performanz dargestellt werden. Mittels einer am Arbeitsbereich Grundschulpädagogik entwickelten Form der mehrperspektivischen Prozessdiagnostik (vgl. Trautmann/ Schmidt/Bichtemann 2009) und einer Modellbildung mit & durch das Kind selbst sollen die Potenzen eines derartigen tieferen Blickens für die tägliche pädagogische Arbeit (re)konstruiert werden.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871228.0.23
Vieluf, Ulrich; Ivanov, Stanislav; Nikolova, Roumania: Zur Wirksamkeit außerunterrichtlicher Begabtenförderung. pp 286 – 295
Die Hamburger Schulbehörde hat in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre ein Bündel von Maßnahmen zur Begabtenförderung in die Wege geleitet. Es umfasste neben der Akzeleration im Rahmen des Schulversuchs „Gefördertes Springen“1 neu entwickelte Enrichmentangebote, allen voran das Projekt „Kinder der Primarstufe auf verschiedenen Wegen zur Mathematik“ (PriMa) 2 . Darüber hinaus wurde die Beratungsstelle besondere Begabungen (BbB) eingerichtet – die erste staatliche Beratungsstelle in Deutschland für Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler sowie Eltern zu Fragen rund um das Thema „(Hoch-) Begabung“ und für die Entwicklung, Implementierung, Begleitung und Evaluation von Maßnahmen zur Begabtenförderung3. Auslöser hierfür waren seinerzeit u. a. Befunde der Längsschnittstudie „Aspekte der Lernausgangslage und der Lernentwicklung an Hamburger Schulen“ (LAU, 1996 bis 2005), die darauf hindeuteten, dass ein nicht geringer Teil der Schülerinnen und Schüler mit hohen und sehr hohen Lernausgangslagen nur unterdurchschnittliche Lernentwicklungen verzeichnete. Eine naheliegende Erklärung hierfür war, dass diese Schülerinnen und Schüler die curricularen Anforderungen ihrer Jahrgangsstufe bereits erfüllten und ihnen der Unterricht für ihre Kompetenzentwicklung zu wenig Anregung bot. Sieben Jahre nach dem Start der LAU-Studie wurde seitens der Schulbehörde eine Folgestudie in Auftrag gegeben, die Längsschnittstudie „Kompetenzen und Einstellungen von Schülerinnen und Schülern“ (KESS, 2003 bis 2012). Im Rahmen dieser Studie wurden neben Tests aus der (inter-)nationalen IGLU-Studie auch die Tests aus der LAU-Studie eingesetzt. 4 So war es möglich, anhand von Vergleichen der Lernentwicklungen der Schülerinnen und Schüler zweier vollständiger Jahrgänge in ausgewählten Kompetenzbereichen die Wirksamkeit der zwischenzeitlich ergriffenen Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Hamburger Schulsystems – insbesondere die Einführung der verlässlichen Halbtagsgrundschule, Englisch in der Grundschule, G 8 ebenso wie Programme zur Begabtenförderung – zu überprüfen. In diesem Beitrag gehen wir anhand des KESS-Datensatzes der Frage nach, ob sich Maßnahmen zur Begabtenförderung in den Lernentwicklungen der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler niederschlagen, ob sich also positive Effekte unterrichtsergänzender Enrichmentangebote für besonders begabte und für hochbegabte Schülerinnen und Schüler nachweisen lassen.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871228.0.24
Vorhölter, Katrin; Kaiser, Gabrielle: Eine Idee – viele Fragen. Überlegungen zur Aufgabenvariation beim mathematischen Modellieren. pp 296 – 305
Schülerinnen und Schüler hinterfragen regelmäßig den Sinn von Mathematik und Mathematikunterricht. Das, was sie dabei als sinnvoll wahrnehmen, ist unterschiedlich. Während einige das Betreiben von Mathematik und das Lösen innermathematischer Problemstellungen als erfüllend wahrnehmen, erfahren andere die Sinnhaftigkeit von Mathematik lediglich durch außermathematische Fragestellungen. Beide Aufgabenformate haben ihren Stellenwert im Mathematikunterricht und können gleichermaßen herausfordernd sein – sowohl für leistungsstarke wie auch für leistungsschwache Schülerinnen und Schüler. Im Beitrag wird dies für außermathematische Fragestellungen, konkret mathematische Modellierungsaufgaben, ausgeführt.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871228.0.25
Marianne Nolte 2Go. pp 306 – 306
Schon etwas älter, aber immer noch zu sehen …