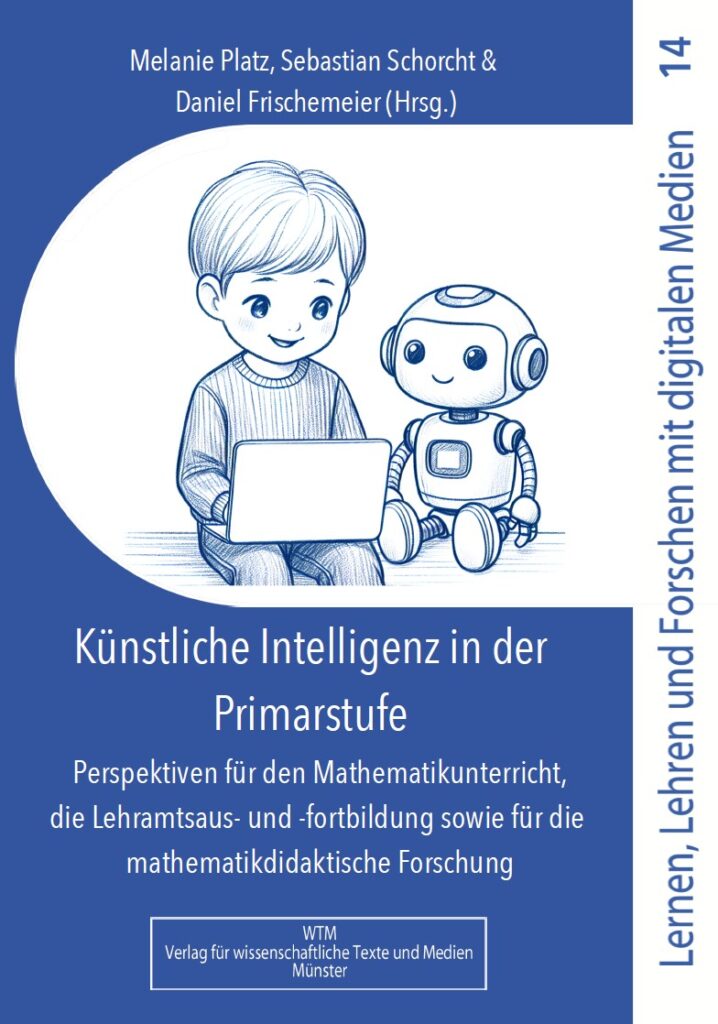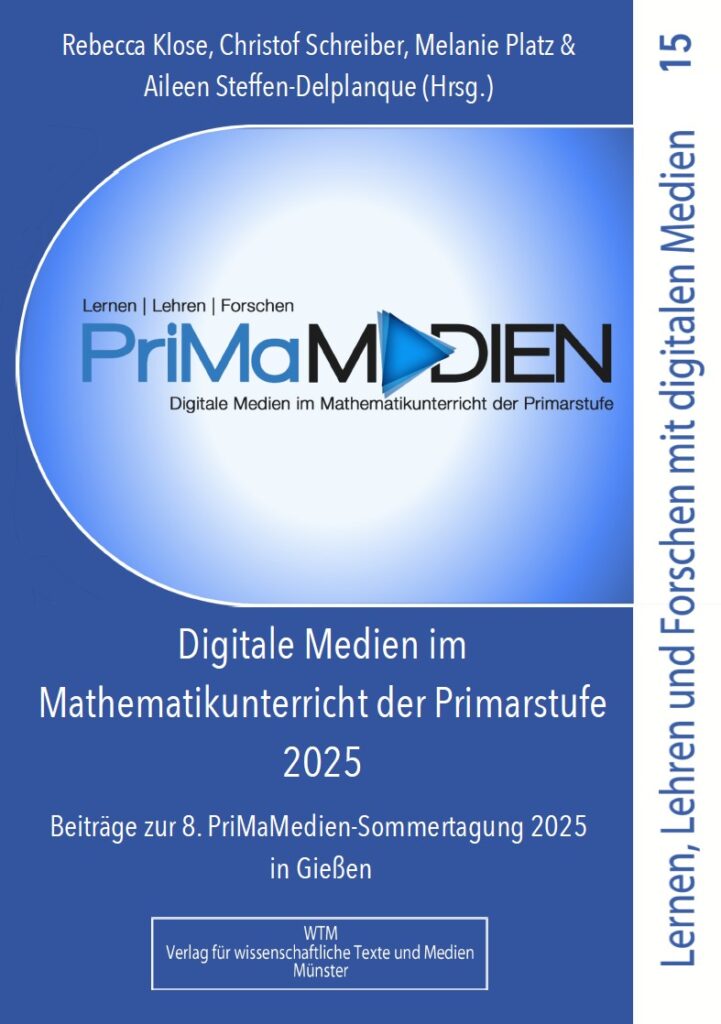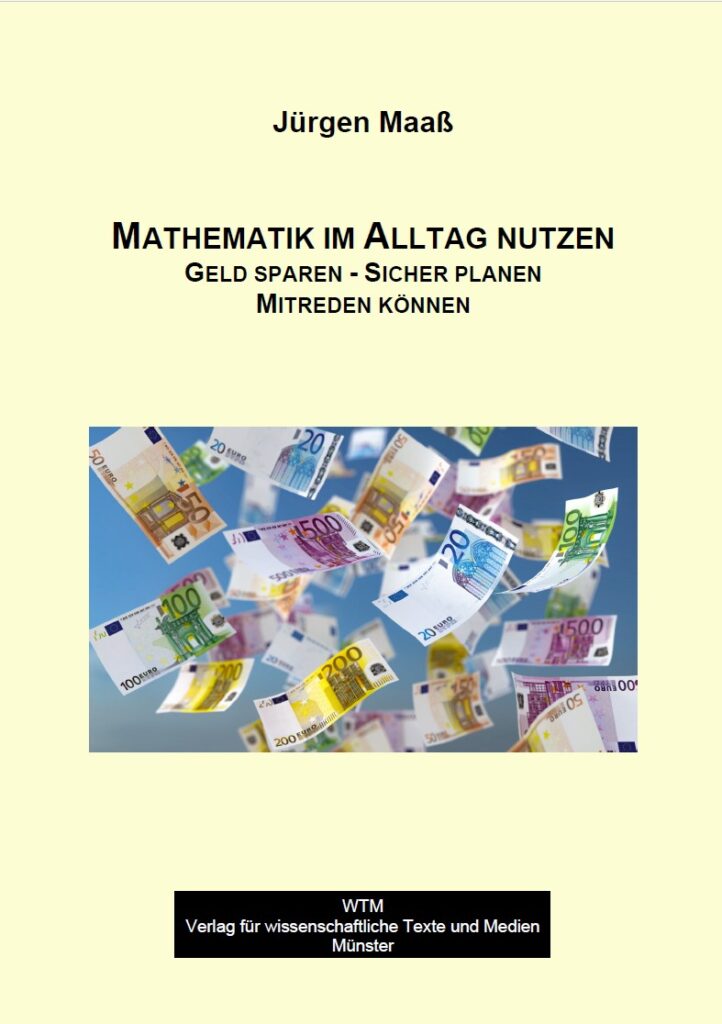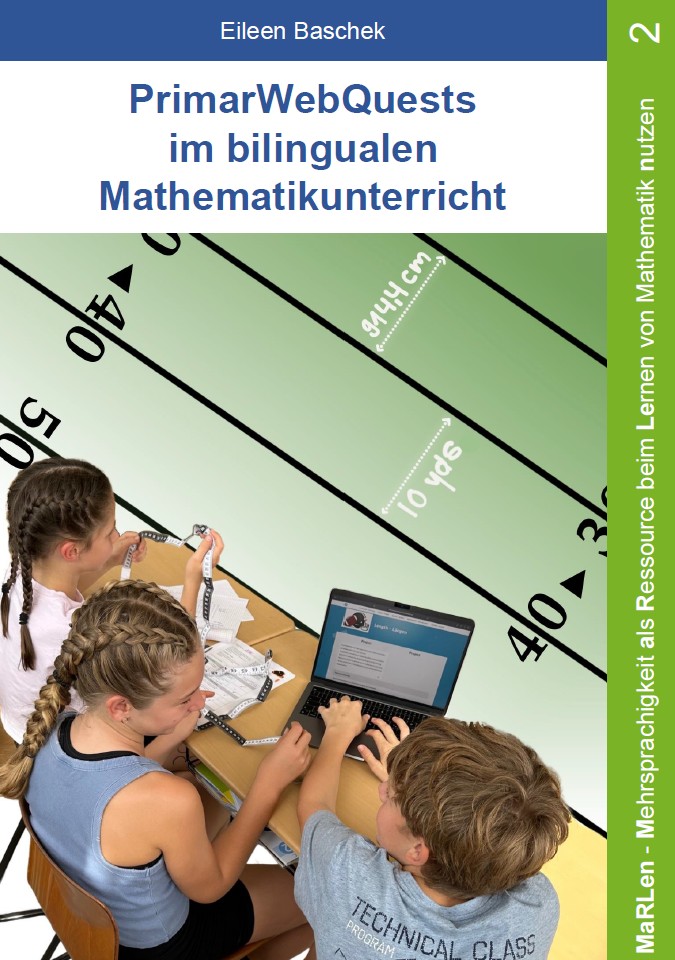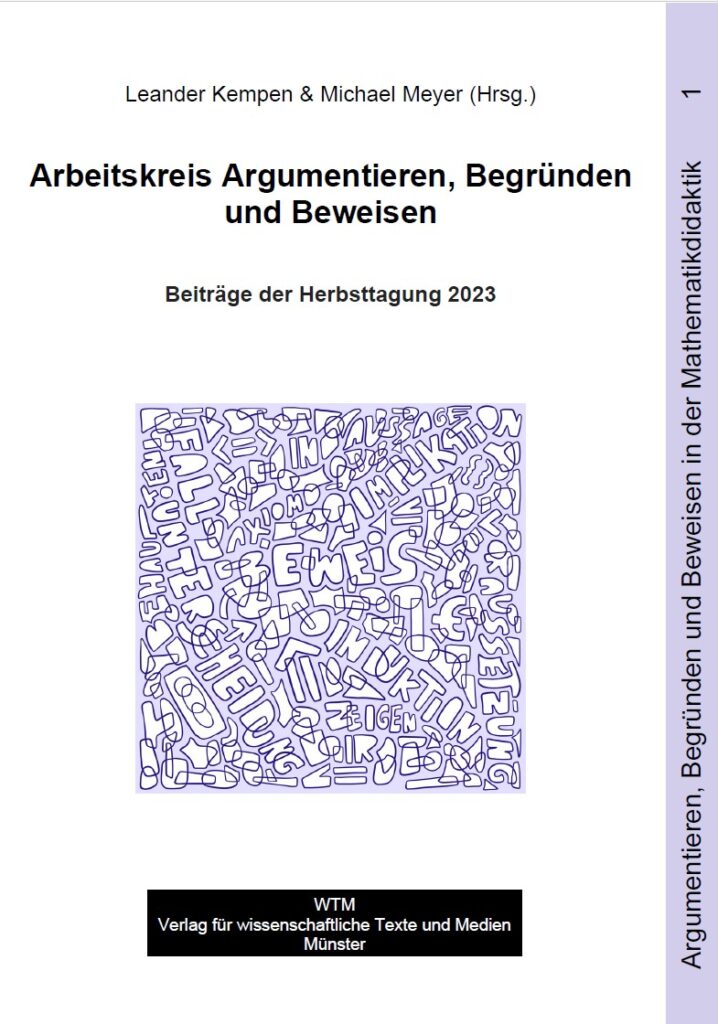Vorträge auf der 39. und 40. Herbsttagung des Arbeitskreises Geometrie in der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik in Saarbrücken
Band 1 der Reihe Beiträge zur Didaktik der Geometrie
Münster: WTM-Verlag 2025
Ca. 260 Seiten, davon 28 in Farbe DIN A5
978-3-95987-355-0 Print 48,90 €
978-3-95987-356-7 E-Book 44,90 €
https://doi.org/10.37626/GA9783959873567.0
Für eine Vorschau bittte auf das Bild klicken.
Das Buch können Sie –> HIER bestellen.
Abstract
Der vorliegende Tagungsband enthält 16 Beiträge der Herbsttagungen 2023 und 2024 des Arbeitskreises Geometrie in der GDM, u. a. zu den Themenbereichen
- soziale Gerechtigkeit im Mathematikunterricht, speziell in der Geometrie,
- vom Phänomen zur Mathematik sowie
- vom Raum in die Ebene und zurück.
Darüber hinaus befinden sich am Ende des Bandes Beiträge zu unterschiedlichen Themen der Geometrie und ihrer Didaktik wie zu Häusern der Vierecke und Tetraeder, zu Vorstellungen zu Kongruenzabbildungen, zu Kreisförmigkeit im weiteren Sinn sowie zu Flächensätzen im Umfeld rechtwinkliger Dreiecke.
BEITRÄGE
Ysette Weiss: Möglichkeiten und Hürden zu einem sprachreduzierten Geometrieunterricht
Abstract
Der Beitrag beschäftigt sich mit Möglichkeiten, Schülerinnen und Schülern mit altersgemäßen Mathematikkenntnissen, die jedoch die Unterrichtssprache Deutsch nicht oder kaum sprechen im Unterricht Mathematik, im Speziellen Geometrie, zu vermitteln. Situationen, in welchen sehr viele Kinder und Jugendliche aus Ländern mit ähnlichen Mathematiklehrplänen in das deutsche Schulsystem entsprechend der Schulpflicht integriert wurden, gab es in der Vergangenheit mehrfach und wird es aller Voraussicht nach auch in Zukunft geben. Die Leitlinien der deutschen Lehrpläne und Bildungsziele basieren wie in den meisten westeuropäischen Ländern auf einer konstruktivistischen Pädagogik. Fördern diese Prinzipien und unsere Bildungstraditionen eine größtmögliche Teilhabe dieser Kinder an unseren Schulen und in der Gesellschaft? Inwieweit berücksichtigen gegenwärtige Ansätze sprachsensiblen Mathematikunterrichts vorhandene mathematische Fertigkeiten und mathematisches Methodenwissen der fremdsprachigen Schüler? Der Ansatz, Mathematik möglichst spracharm zu unterrichten, scheint hier naheliegend. Wir untersuchen, inwieweit existierende Traditionen und Trends diesen Ansatz unterstützen.
Erste Seite: 3
Letzte Seite: 18
=====================================================
Janina Scholtz & Swetlana Nordheimer: Bildungsgerechtigkeit und Gebärdengeometrie am Beispiel von Binomischen Formeln
Abstract
Bildungsgerechtigkeit setzt voraus, dass beispielsweise geometrische Beweise nicht nur spracharm oder gar sprachfrei, sondern in den Sprachen thematisiert werden, die die Lernenden wahrnehmen und verstehen können. Für viele Kinder und Jugendliche in Deutschland sind es nicht Laut- oder Schriftsprachen, sondern Deutsche Gebärdensprache (DGS). In dem vorliegenden Beitrag wird am Beispiel einer kubischen Summe vorgestellt, wie ein algebraischer Beweis in Gebärdengeometrie visualisiert und in DGS formuliert werden kann. Im Hinblick auf unterschiedliche gebärdensprachliche Voraussetzungen der Lernenden werden hier drei verschiedene Varianten eines Beweises angeboten: Beweis am geometrischen Modell, Beweis am Tafelbild mit Termen und ein Beweis, der ohne visuelle Hilfsmittel oder Tafelanschrieb rein in DGS formuliert wurde. Vor allem in der letzten Variante der gebärdengeometrischen Visualisierung können Geometrie und Algebra in einem Gebärdenbild aufeinandertreffen, um bei den Lernenden mentale Bilder zu erwecken, die über das direkt Sichtbare hinausgehen. Das Operieren mit dynamischen mentalen Bildern und nicht nur das bloße Betrachten von direkt über das Auge Wahrnehmbarem kann Bildungsprozesse in Gang setzen.
Erste Seite: 19
Letzte Seite: 44
=====================================================
Wilfried Dutkowski: Allgemeinbildender Geometrieunterricht: Soziale Gerechtigkeit herstellen
Abstract
Geleitet durch das Musical Pygmalion und aufgrund von Erfahrungen, Einschätzungen und Lösungspotenzial aus dem realexistierenden Geometrieunterricht wird aufgezeigt, wie man bildungsferneren Lernenden, gemäß der Forderung Martin Wagenscheins Das Verstehen des Verstehbaren ist ein Menschenrecht (Wagenschein, 1961) nachkommen kann. Dabei werden zwei Perspektiven deutlich, die den Bezug zum Musical herstellen:
- Der Lernerfolg ist von den Erwartungen der Lehrperson abhängig.
- Die soziale Herkunft verhindert Lernzuwachs nur dann, wenn ihr (der sozialen Herkunft) nicht angemessen begegnet wird.
Professor Higgins schafft es mit unkonventionellen Methoden Eliza, die aus einer sozial tiefer stehenden Schicht stammend, sprachlich und intellektuell nicht in die Oberschicht passt, zu ermöglichen, die „Hochsprache“ der Oberschicht zu erlernen.
Im übertragenen Sinn geht es also darum, dass man allen Lernenden methodisch, didaktisch und emotional zu einem besseren Lernverständnis verhelfen kann und dadurch auch Lernerfolge erzielt, die gesellschaftlich als Selektionsinstrument dienen. Das dies auch auf die „Hochsprache“ Mathematik angewandt werden kann, ist unmittelbar klar, wenn man sich die gesellschaftliche Hochachtung vor diesem Fach anschaut.
Erste Seite: 45
Letzte Seite: 56
=====================================================
Titel des Beitrags: Pólya`s Universalstöpsel: Mit 3D-Druck mehrere Körpermodelle erstellen und vergleichen
Matthias Müller & Pascal Lütscher
Abstract
Die Beschäftigung mit einem faszinierenden geometrischen Problem der Erstellung eines dreidimensionalen Körpermodells lässt sich bis ins 18. Jahrhundert zurückverfolgen: Ziel ist es, einen Körper zu finden, der eine kreisförmige Grundfläche hat, von einer Seite wie ein Dreieck aussieht und wie ein Quadrat von der anderen. Dieses Problem hat Pädagogen sowie Mathematikerinnen und Mathematiker gleichermaßen inspiriert, wie beispielsweise G. Pólya im Jahr 1966. In historischen Beispielen wird eine eindeutige Lösung suggeriert, denn viele Beschreibungen von Lösungen für das Problem sind unvollständig. In der Tat gibt es unendlich viele Körper, die die erforderlichen Eigenschaften erfüllen. In diesem Artikel wird untersucht, wie verschiedene Lösungen gefunden werden können, die die angegebenen Bedingungen des geometrischen Problems erfüllen. In diesem Zusammenhang wird ein Ansatz zur Systematisierung nach den Volumina zur Diskussion gestellt. Darüber hinaus werden die Vorteile der Erstellung von 3D-gedruckten Modellen im Vergleich zu analogen Modellen diskutiert.
Erste Seite: 57
Letzte Seite: 67
=====================================================
Hans Walser: Wie rund ist rund?
Abstract
In der Schule kommt bei der Berechnung von „runden“ Sachen (Kreis, Kugel, Zylinder, Kegel) in aller Regel die Kreiszahl π vor. Wir werden einige Beispiele kennenlernen, bei denen Volumen und Oberfläche viel einfacherer Natur sind. Ganzzahlig, rational, allenfalls algebraisch irrational. Trotzdem sind diese Beispiele aus mehreren Perspektiven kreisförmig. Stichworte: Raumvorstellung, Verwendung von CAS und CAD, Modellbau mit verschiedenen Materialien und Techniken, Kartografie (GIS), Spiel mit Formen und Farben.
Erste Seite: 69
Letzte Seite: 82
=====================================================
Hans-Jürgen Elschenbroich: Eine Kugel im Flächenland
Abstract
Im Roman „Flächenland“ (Original: „Flatland“ von E. A. Abbott, 1884) wird das Leben im Flächenland beschrieben. In diesem Beitrag geht es speziell darum, wie der Protagonist („ein altes Quadrat“) das überraschende Auftauchen einer Kugel und ihren Weg durchs Flächenland erst mal erschreckt und verständnislos wahrnimmt und dann schrittweise begreift. Dies wird hier mit den Werkzeugen von GeoGebra modelliert und visualisiert und in einem zweiten Schritt der Bezug zu verschiedenen Geometrien hergestellt. Am Ende erfolgt eine didaktische Einordnung.
Erste Seite: 83
Letzte Seite: 90
=====================================================
Hans-Jürgen Elschenbroich: Von der Ebene in den Raum und zurück – Die Sätze von Thales und Pythagoras
Abstract
Die Sätze von Thales und Pythagoras sind wichtige Sätze der ebenen Schulgeometrie und im Falle Pythagoras auch der berühmteste. Wie lassen sie sich für den dreidimensionalen Raum formulieren und geht das immer? Welche Besonderheiten gibt es dabei und finden wir die ebenen Versionen in den dreidimensionalen wieder? Dies wird mit der dynamischen Raumgeometrie-Software GeoGebra 3D untersucht und visualisiert.
Erste Seite: 91
Letzte Seite: 102
=====================================================
Hartmut Müller-Sommer: Zur räumlichen Satzgruppe des Pythagoras
Abstract
In diesem Beitrag stellt die Quaderecke zusammen mit dem Flächensatz von Faulhaber den Ausgangspunkt dar. Der Satz von Faulhaber kann als räumliches Analogon des Satzes von Pythagoras aufgefasst werden. Ein Blick auf die Geometrie der Quaderecke führt mit den Mitteln der Sekundarstufe I zu einfachen Beweisen des Flächensatzes und zur Entwicklung räumlicher Analoga zu den ebenen Kathetensätzen und zum ebenen Höhensatz. Diese räumlichen Sätze können zur Überraschung des Autors in einer Art Rückführung als neue Sätze der Ebene über produktgleiche Flächeninhalte gedeutet werden.
Erste Seite: 103
Letzte Seite: 116
=====================================================
Wilfried Dutkowski: Archimedische Körper und ihre dynamischen Konstruktionen – Skizzen zur Regeometrisierung des Mathematikunterrichtes
Abstract
In einem Brief von Gauß an Bolyai betonte Gauß, dass das Lernen genüsslicher ist als Wissen, das Erwerben genüsslicher als das Besitzen und es nicht um das Dasein geht, sondern um das Hinkommen. (Gauß, 1808). Diese Weisheit beschreibt Günter Weiser 1981 etwas moderner:
„Der Grundgedanke einer operativen Gesamtbehandlung besteht darin, möglichst verstehend zu lernen, das Merkwissen auf ein Mindestmaß zu beschränken, Lerninhalte untereinander funktional zu verbinden und die Befähigung selbstständigen Lernens mit Hilfe des bereits erworbenen zu bestätigen.“ (Weiser, 1981, S. 71)
In diesem Sinne sollen die hier gemachten Ideen – in Teilen – eine Skizze darstellen, wie man den algebraisch überfrachteten Geometrieunterricht wieder anschaulich und attraktiv gestalten kann, indem man Platonische Körper und Archimedische Körper in den Mittelpunkt stellt. Dabei reicht es zunächst aus, dass man diesen Körpern lediglich die Eigenschaft zuordnet, dass alle Kanten gleichlang sein müssen. Vorbereitend und bei den Lernenden besonders beliebt sind sogenannte Kantenmodelle (z. B. Klickis ®), mit denen man einen Großteil solcher Körper bauen kann.
Erste Seite: 117
Letzte Seite: 126
=====================================================
Henning Heller: Die Bihöhen des Tetraeders
Abstract
Ein Tetraeder besitzt zwei Arten von Höhen: Die Eckhöhen sind die vier Loten von den Ecken auf die gegenüberliegenden Seitenflächen, während die Bihöhen als gemeinsame Lote jeweils gegenüberliegender Kanten definiert sind. Anders als beim Dreieck schneiden sich im allgemeinen Tetraeder weder die Eck- noch die Bihöhen. Wir beweisen nach Gambier (1948), dass es zwei Typen [A] und [B] von Bihöhenschnittpunkten gibt, ermitteln experimentell die drei Klassen von Tetraedern mit zwei Schnittpunkten ([A,A], [A,B], [B,B]) und zeigen schließlich, dass ein Tetraeder mit drei sich in einem Punkt schneidenden Bihöhen orthozentrisch [A,A,A], eine Linksraute [A,B,B] oder ein Disphenoid [B,B,B] ist. Wir schließen mit einem „Haus der Tetraeder“ nach Schnittpunkteigenschaften der Bihöhen.
Erste Seite: 127
Letzte Seite: 148
=====================================================
Heinz Schumann: Über 6-eckige und 6-flächige konvexe Polyeder
Abstract
Die Nutzung geeigneter Dynamischer Raumgeometrie-Systeme, welche für die räumliche Elementargeometrie geschaffen wurden, bietet die Möglichkeit, Themen, deren synthetisch-geometrische Behandlung bisher erschwert war, im virtuellen Raum zu erschließen. Voraussetzung für eine solche Behandlung ist eine ausreichende raumgeometrische Konstruktionskompetenz bei der Nutzung o. g. Systeme. – Die nachstehende Arbeit ist stoffdidaktischer Art und versteht sich als ein Beitrag zum projektorientierten Raumgeometrie-Unterricht der oberen Sekundarstufe und der Mathematiklehrerausbildung.
Themen für die Behandlung von Polyedern im virtuellen Raum sind beispielsweise:
- Raumgeometrische Konstruktion von Polyedern nach vorgegebenen Eigenschaften, z.B. als Analoga zu Polygonen der ebenen Geometrie.
- Polyeder aus Polyedern erzeugen, z.B. durch Abschneiden von Körperteilen.
- Untersuchung von Polyedern, z.B. mittels Zählen, Messen, Berechnen.
- Klassifikation von Polyedern nach bestimmten Eigenschaften, z.B. nach Symmetrie, Anzahl der Ecken bzw. Flächen.
- Satzfindung und Beweisfindung an Polyedern.
Erste Seite: 149
Letzte Seite: 171
=====================================================
Stephan Berendonk, Daniel Dieser & Peter Kaiser: Ein Haus der Vierecke als Ausgangspunkt mathematischer Erkundungen
Abstract
Ausgehend von der Idee, dass für mathematische Objekte durch die Wahl eines sogenannten Merkmalssystems eine lokale Ordnung festgelegt wird, konstruieren wir verschiedene lokale Ordnungen von Vierecken, die wir als Häuser bezeichnen. Beim Bau der einzelnen Häuser durchlaufen wir eine Vielzahl kleiner Kongruenz- und Abbildungsgeometrischer Argumentationen. Nachdem einige Häuser erstellt sind, schauen wir auf die Struktur einzelner Häuser und auf die Beziehungen der Häuser untereinander. Dabei zeigt sich, dass die Idee der Merkmalsorientierung beim lokalen Ordnen mathematischer Objekte interessante Fragen und Tätigkeiten ermöglicht, die zuvor in diesem Kontext nicht denkbar waren.
Erste Seite: 173
Letzte Seite: 210
=====================================================
Dorothee Sophie Dahl: Vorstellungen zu Kongruenzabbildungen im Spannungsfeld von Abbildungs- und Bewegungsgeometrie
Abstract
Zahlreiche Lernende haben Schwierigkeiten im Umgang mit abbildungsgeometrischen Konzepten, was durch verschiedene Studien belegt wird. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, kann die Ausbildung geeigneter (Grund-) Vorstellungen zu Kongruenzabbildungen hilfreich sein. Dieser Beitrag untersucht verschiedene Zugänge zu Kongruenzabbildungen, wobei sowohl abbildungsgeometrische als auch bewegungsgeometrische Perspektiven berücksichtigt werden. Besonders im Fokus stehen Kongruenzabbildungen als Gruppen und als Funktionen, die durch ihren Definitions- und Wertebereich spezifische mathematische Strukturen aufweisen. Während in der abbildungsgeometrischen Perspektive die gesamte Ebene als Definitionsbereich betrachtet wird, erfolgt in der bewegungsgeometrischen Perspektive die Betrachtung zunächst nur von Figuren oder Teilbereichen. Diese unterschiedlichen Ansätze beeinflussen die Sichtweise auf Kongruenzabbildungen und erfordern ein differenziertes Vorgehen in der Unterrichtsgestaltung. Am Ende wird ein Lernpfad vorgeschlagen, der die schrittweise Entwicklung der Konzepte bei den Lernenden fördern und zu einem vertieften Verständnis von Kongruenzabbildungen führen soll.
Erste Seite: 211
Letzte Seite: 226
=====================================================
Manfred Schmelzer: Kreisförmigkeit im weiteren Sinn
Abstract
Kreise können ihren Beitrag leisten zur Begriffsbildung und zum Argumentieren bzw. Herleiten in der Analysis, etwa zum Lösen einer Differentialgleichung. Darüber hinaus stellt sich die Frage, wie Kreisförmigkeit in einem weiteren Sinn – außerhalb der euklidischen Ebene – definiert werden könnte. Im Hauptteil des Artikels werden kreisförmige metrische Räume, wie z. B. ein kürzester Weg um einen See oder Berg herum untersucht. Insofern zählt diese Abhandlung überwiegend zur Abstandsgeometrie.
Erste Seite: 227
Letzte Seite: 242
=====================================================
Hans Walser: Zwei Flächensätze
Abstract
Es werden zwei dem Autor bis anhin unbekannte Flächensätze im Umfeld des rechtwinkligen Dreieckes besprochen. Dabei spielen der Inkreis und der Flächeninhalt des Dreieckes eine zentrale Rolle. Die Beweise sind weitgehend mit Methoden der Sekundarstufe 1 durchführbar. Es besteht eine Verbindung zum Goldenen Schnitt.
Erste Seite: 243
Letzte Seite: 249
=====================================================
Heinz Schumann: WürfelGEOMETRIE – ein Buchprojekt
Abstract
Es gibt einige Buchpublikationen über den Würfel, die jeweils besondere Bereiche der Würfelgeometrie abdecken. Wir nennen hier nur das 2018 erschienene aufgabenstellende Buch von Hans Walser „Der Würfel: Ansichten – Dimensionen – Modelle“ und das 1964 publizierte und als klassisch geltende Büchlein “The Cube Made Interesting“ der polnischen Mathematikerin Aniela Ehrenfeucht. Neben Buchveröffentlichungen existiert im Internet eine Vielzahl von Seiten über die Kombination von Würfel und Geometrie: Mit der Suche nach „wuerfel+geometrie“ findet man mehr als eine Million Seiten, mit „cube+geometry“ mehr als 100 Millionen Seiten. Viele dieser Seiten haben aber gar keinen Bezug zur Elementargeometrie des Würfels.
Die bestehenden Veröffentlichungen zum Thema „Würfel“ hat der Autor durch ein Buch des Titels „WürfelGEOMETRIE – Ein Zugang zur Raumgeometrie“ ergänzt, das sich an alle wendet, die an Raumgeometrie interessiert sind oder die sogar einen Zugang zur Raumgeometrie suchen.
Erste Seite: 251
Letzte Seite: 255
=====================================================