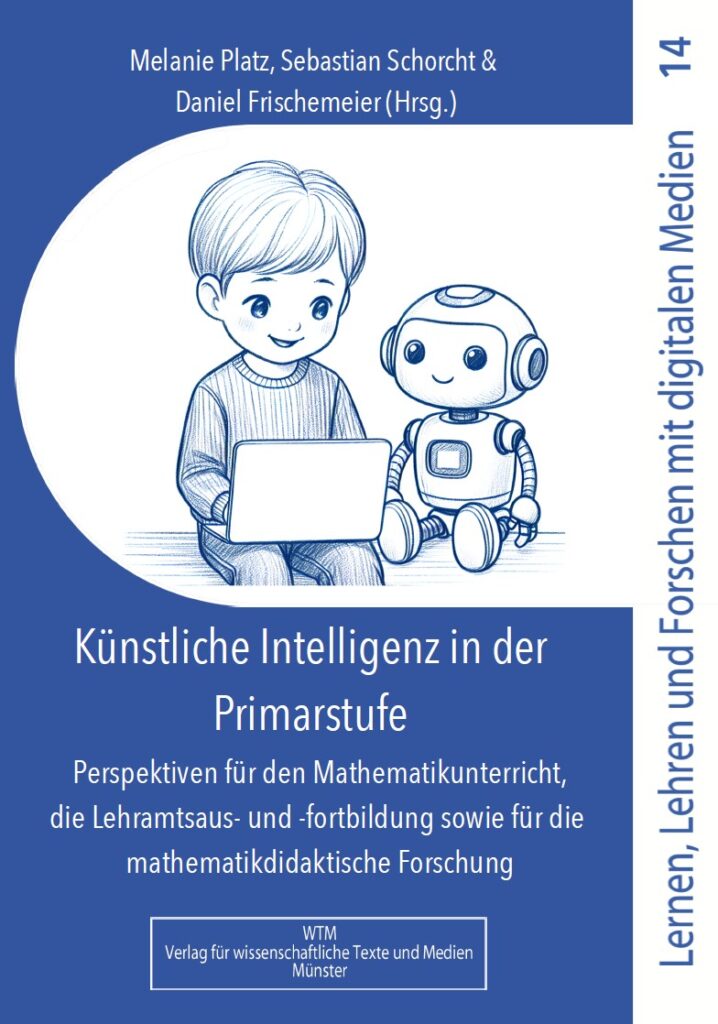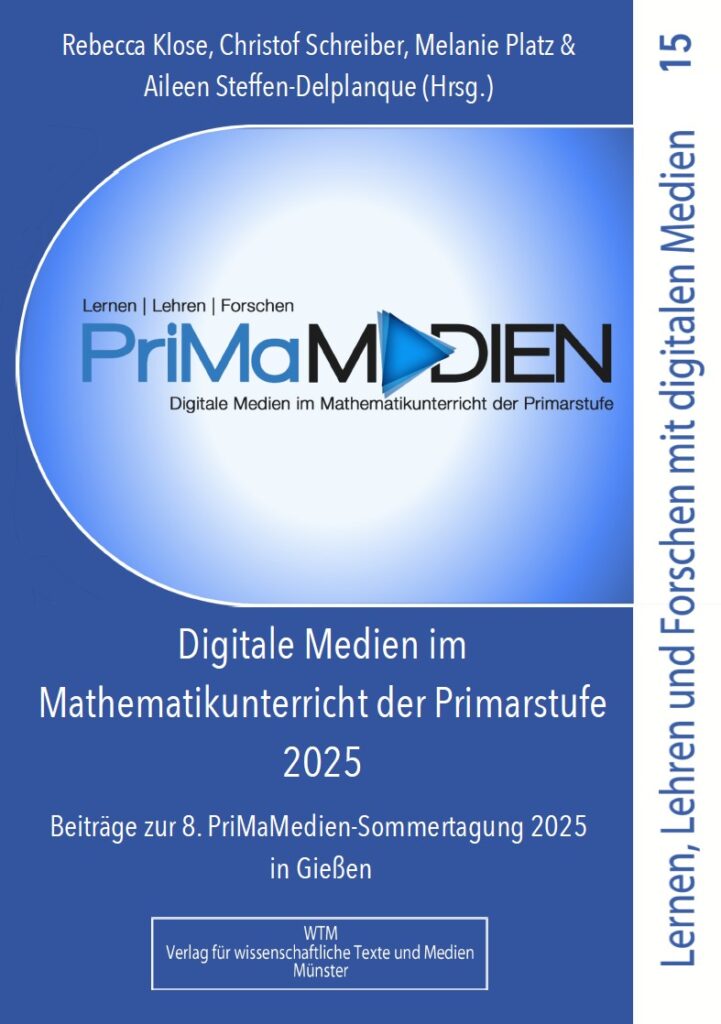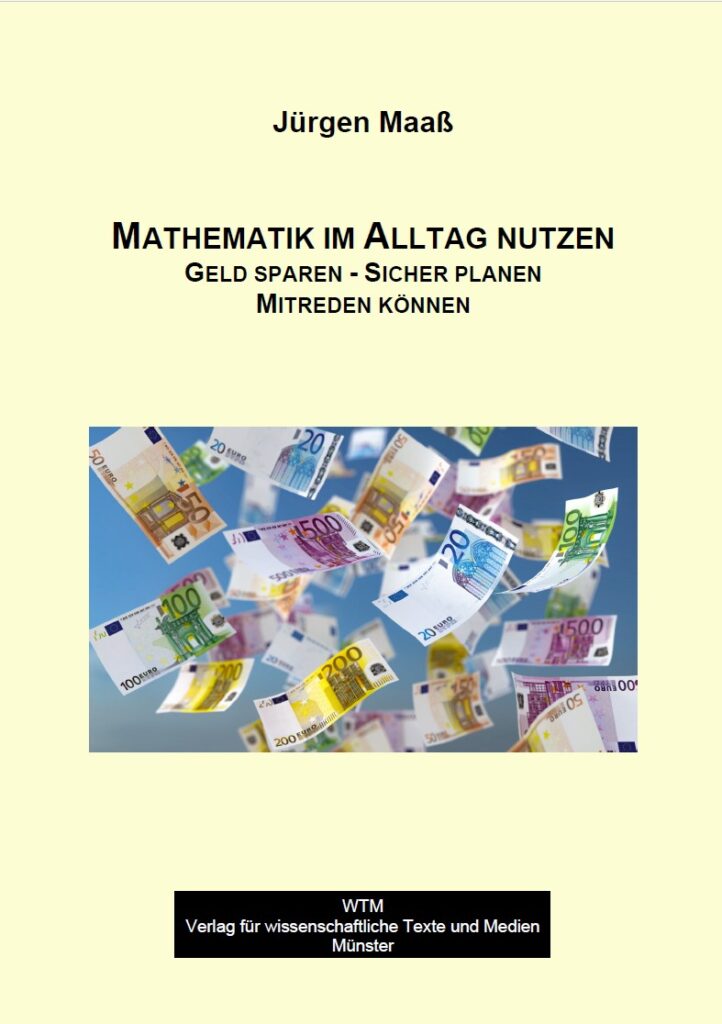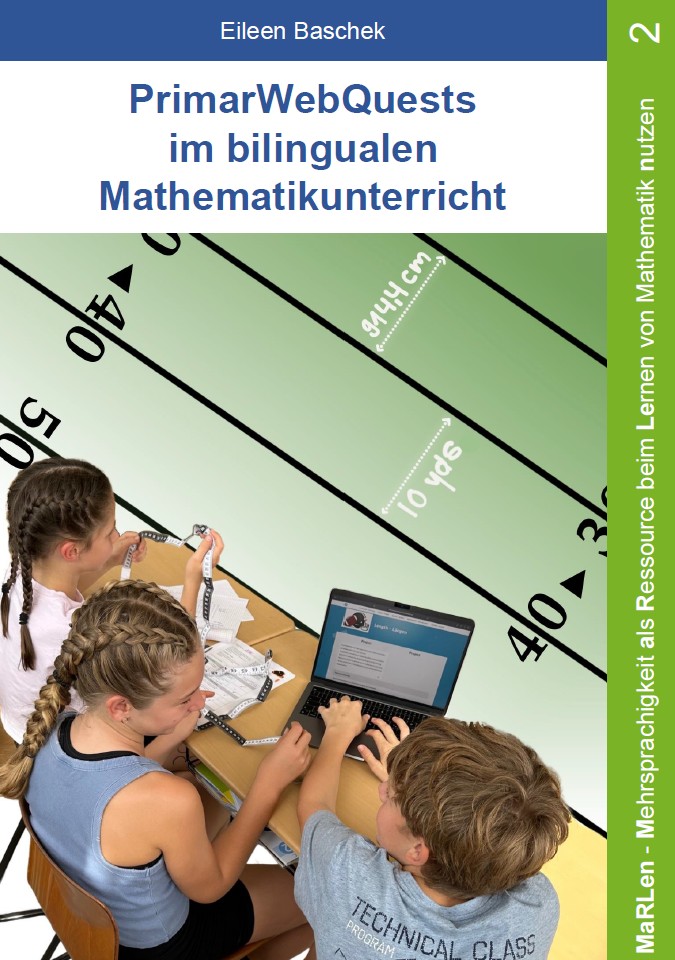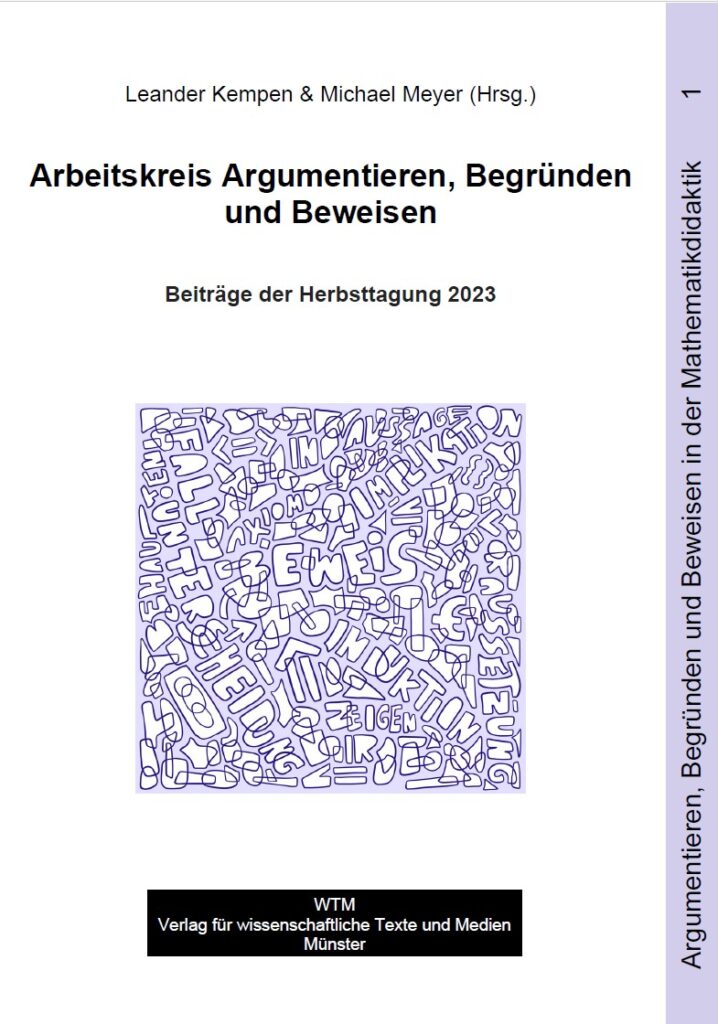Band 6 der Reihe Mathematiklehren und -lernen in Ungarn
Band 6 der Reihe Mathematiklehren und -lernen in Ungarn
Münster 2024, 265 S. DIN A5
Print: ISBN 978-3-95987-327-7, 39,90 €
Ebook: ISBN 978-3-95987-328-4, 36,90 €
https://doi.org/10.37626/GA9783959873284.0
Für Bestellungen bei edition-buchshop hier klicken
Vorschau: Zur Vorschau klicken sie auf das Bild.
Abstract
Das vorliegende Buch widmet sich traditionellen und aktuellen Themen mit Beiträgen, die einen Einblick in historische und heutige Entwicklungen der Mathematikdidaktik geben. Sie verdeutlichen den immerwährenden Wandel, der (zumeist) durch Fortschritt, aber auch (gelegentlich) durch Rückschritt geprägt ist.
Die jeweiligen Analysen sind bestimmt durch fokussierte und komparative Zugriffe sowie durch kritische und evaluative Betrachtungen. Im Zentrum stehen Fragen zur Tauglichkeit, zum Nutzen und zur Wirksamkeit dessen, was beim Lehren und Lernen von Mathematik geschieht: Was ist geeignet, was ist erprobt? Was ist verlässlich, was ist aussichtsreich? Was ist geprüft, was ist förderlich?
Die Beiträge beinhalten geschichtliche Analysen zum Mathematiklernen, vergleichende Untersuchungen von Schulbüchern im Fach Mathematik sowie auf ihre Zielsetzung hin betrachtete mathematikdidaktische Konzepte. Sie thematisieren aber auch jüngere Trends im Mathematikunterricht, die methodische, mediale und technologische Fragestellungen betreffen.
Insgesamt kommen sowohl Konzeptionen zur Ausbildung angehender Lehrkräfte in Mathematik als auch Innovationen zur Gestaltung mathematischer Lehr-Lern-Prozesse von Kindern und Jugendlichen zur Sprache. Die Beiträge bieten Aufschlüsse, abgestützte Entscheidungen für die Zukunft zu treffen.
Mathematik ist in Ungarn traditionell von hoher kultureller und wissenschaftlicher Bedeutung. Intention der Buchreihe „Mathematiklehren und -lernen in Ungarn“ ist es, die beispielgebende Rolle des Landes und den inspirativen Austausch über Grenzen hinweg zum Ausdruck zu bringen. Ganz in diesem Sinne haben sich etliche Autorinnen und Autoren aus mehreren Ländern – und vielfach im Team – an diesem Band beteiligt.
============================================
BEITRÄGE
Verfasser*innen: Barbara Drollinger-Vetter
Titel des Beitrags: Verknüpfen, Verdichten und Auffalten als zentrale Prozesse des Verstehens und ihr Zusammenhang mit Verstehenselementen
Erste Seite: 11
Letzte Seite: 24
Abstract
In Aeblis Theorie des Strukturaufbaus sind die Prozesse des Verknüpfens, Verdichtens und Auffaltens zentral für das Verstehen. Während Verknüpfen im Zusammenhang mit Verstehensprozessen in der Mathematikdidaktik seit Langem ein wichtiges Thema darstellt, sind die anderen beiden Prozesse weniger bekannt. Im vorliegenden Beitrag werden diese drei Prozesse in einer neuen Visualisierung dargestellt, die Aeblis Grundgedanken zwar beibehält, aber größere Flexibilität ermöglicht als Aeblis ursprüngliche propositionale Schemata. Des Weiteren wird aufgezeigt, welche Funktion diesen Prozessen im Verstehensmodell von Drollinger-Vetter zukommt. Das Ziel des Beitrags besteht darin, die Bedeutung dieser Prozesse für das Nachdenken über Verstehensprozesse herauszuarbeiten und anschaulich aufzuzeigen, wie das Konzept der sogenannten „Verstehenselemente“ darauf aufbaut.
============================================
Verfasser*innen: Karl Josef Fuchs & Ján Gunčaga & Simon Plangg & Wolfgang Schöpf
Titel des Beitrags: Mathematikdidaktische Impulse im Kontext der Geschichte und Gegenwart
Erste Seite: 25
Letzte Seite: 50
Abstract
Im ersten Kapitel werden in Längsschnittanalysen die zahlreichen mathematikdidaktischen Impulse relevanter Bezugswissenschaften nach dem Bezugswissenschaftlichen Prinzip betrachtet. Im zweiten Kapitel werden die Impulse aus historischen mathematischen Lehrbüchern von verschiedenen Autoren wie Franz Močnik vorgestellt. Die rasche Informatisierung in der Gesellschaft und im Schulwesen legt die reflektierte Auseinandersetzung mit Algorithmen im Unterricht nahe. In einem dritten Kapitel wird der Fokus auf dieses Thema im Kontext der Mathematik- und Informatikdidaktik als eine wesentliche Bezugswissenschaft gelegt.
============================================
Verfasser*innen: Stefan Götz & Antonia Spannagl & Roland Steinbauer
Titel des Beitrags: Grundvorstellungen zum Konzept der Differenzierbarkeit von angehenden Mathematiklehrer*innen
Erste Seite: 51
Letzte Seite: 66
Abstract
Im Beitrag wird eine empirische Studie vorgestellt, in der die vor und nach einer Intervention (Besuch einer didaktisch ausgerichteten Analysislehrveranstaltung) schriftlich geäußerten Vorstellungen von Mathematiklehramtsstudierenden zu einer differenzierbaren Funktion erhoben und klassifiziert werden (Prätest-Posttest-Design). Dazu werden sie Grundvorstellungen zugeordnet und die Qualität ihrer Passung beurteilt. Anschließend werden Zusammenhänge mit individuellen Merkmalen der Studierenden analysiert und die Antworten von Prä- und Posttest miteinander verglichen. Eine Steigerung der Anzahl der zuordenbaren Antworten kann festgestellt werden, allerdings müssen auch Defizite bei deren Qualität konstatiert werden. Folgerungen daraus für die Ausbildung der Mathematiklehramtsstudierenden werden abgeleitet.
============================================
Verfasser*innen: Tünde Kántor
Titel des Beitrags: Altes oder neues Thema? Ergänzungen zur Geschichte der Fehlererkennung und ‑behebung in Ungarn
Erste Seite: 67
Letzte Seite: 86
Abstract
Wir skizzieren die Hauptetappen der Forschung zu typischen Denkfehlern im Mathematikunterricht in Ungarn vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts. Grundlage unserer Forschung zur Geschichte der Didaktik sind die veröffentlichten Studien und Dissertationen zum Thema Problemlösen und mathematisches Denken, die auch einen Bezug zur Psychologie haben. Wir haben den Artikel von Manó Beke (1900), die Dissertationen von Ferenc Szeliánszky (1938) und Kálmán Mosonyi (1967), das Buch und die Experimente von Ferenc Lénárd (1978) im Detail analysiert, uns aber auch mit dem Buch von Mária Majoros (1992) und der Dissertation von András Kovács (1995) befasst. Die abschließenden Gedanken beziehen sich auf die Herausforderungen und Aufgaben der Zukunft.
============================================
Verfasser*innen: András Ambrus & Krisztina Barczi-Veres & Laurinda Brown
Titel des Beitrags: Mathematikunterricht in englischen und ungarischen Schulen – Betrachtungen von zwei Seiten
Erste Seite: 89
Letzte Seite: 102
Abstract
Seit den 1990er Jahren sind Studienreisen, gegenseitige Besuche und Erfahrungsaustausche für Lehrende und Studierende aus mitteleuropäischen Ländern möglich. In diesem Artikel beschäftigen wir uns mit Beobachtungen im Mathematikunterricht bei englisch-ungarischen Studienbesuchen und Austauschprogrammen. Eine praktizierende Mathematiklehrerin aus Ungarn und eine englische Expertin für Mathematiklehrerausbildung und -forschung äußern ihre Erfahrungen und Meinungen.
============================================
Verfasser*innen: Ferenc József Barkó & Gabriella Ambrus
Titel des Beitrags: Das Wurzelziehen in einigen Lehrbüchern des 18. Jahrhunderts – eine historisch-didaktische Analyse mit Folgerungen für den Mathematikunterricht
Erste Seite: 103
Letzte Seite: 120
Abstract
Auf manche schwer zu vermittelnde Inhalte und eintönige Berechnungen kann man im schulischen Mathematikunterricht verzichten, wenn man sie durch neue Methoden oder neue Werkzeuge ersetzt: zum Beispiel durch den Taschenrechner, der die Suche nach Werten aus der Tabelle übernehmen kann. Auf neuartige Weise versuchten schon vor mehr als zweihundert Jahren einige Wissenschaftler und Universitätsprofessoren, die nicht immer einfachen Berechnungen für die Lernenden in Mittelschulen und für die Studierenden verständlich zu machen und vor allem den Nachweis von Verfahren mittels einer induktiven Methode zu erbringen. Solche Persönlichkeiten waren beispielsweise der berühmte ungarische Wissenschaftler Pál Kerekgedei Makó mit seinen großen Verdiensten in Mathematik und Physik und Leonhard Euler, der als einer der größten und schöpferischsten Mathematiker aller Zeiten gilt.
Besonders geeignet, ihre vorbildliche Lehrbuchtätigkeit zu demonstrieren, ist unserer Meinung nach das schriftliche Wurzelziehen. Neben der Vorstellung des Verfahrens des Wurzelziehens und einer zugehörigen Analyse wird auch die Frage nach Folgerungen für den Mathematikunterricht erörtert.
============================================
Verfasser*innen: Sebastian Bauer & Andreas Büchter
Titel des Beitrags: Zur stetigen Diskussion über Analysis im Schulunterricht – Blicke zurück, nach vorn und auf Alternativen
Erste Seite: 121
Letzte Seite: 140
Abstract
Der Beitrag entwickelt vor dem Hintergrund der historischen Diskussion um die Einführung der Analysis in den Mathematikunterricht im Zuge der Meraner Reformvorschläge zwei curriculare Entwicklungsszenarien, (i) eine Ausweitung des Analysisunterrichts mit dem Ziel eines ausgewogenen Verhältnisses von Anschauung und Strenge, Anwendungsbezogenheit und Studierfähigkeit und – alternativ – (ii) einen Verzicht auf Analysis zugunsten eines neuen Stoffgebiets Elementare Zahlentheorie mit einem vertieften Hintergrund zur Arithmetik, strukturellen Betrachtungen und Anwendungen.
============================================
Verfasser*innen: Andreas Büchter & Lukas Donner
Titel des Beitrags: Die Herleitung der Regel zur Bruchdivision im didaktischen Diskurs und in ausgewählten Schulbuchreihen – eine Geschichte mit Spannungsverhältnissen und Verwerfungen
Erste Seite: 141
Letzte Seite: 158
Abstract
Ausgehend von einem umfangreicheren Projekt zum Thema Bruchdivision, das auch empirische Teile enthält, möchten wir die Analyse der Entwicklung von zwei deutschsprachigen Schulbuchreihen seit den 1960er Jahren bis heute vor dem Hintergrund der einschlägigen mathematikdidaktischen Diskussion im deutschsprachigen Raum darstellen. Neben der Entwicklung der Schulbuchreihen selbst, die u. a. mit Blick auf das Entstehen von Inkonsistenzen interessant ist, wird auch ein wahrnehmbares Spannungsverhältnis zwischen Schulbüchern und mathematikdidaktischem Diskursstand dargestellt und reflektiert. Der Beitrag beginnt mit einer Klassifikation unterschiedlicher Wege zur Herleitung der Regel zur Bruchdivision, um unter dieser Perspektive relevante Ausschnitte des mathematikdidaktischen Diskurses und die Entwicklung von Schulbuchreihen zu betrachten.
============================================
Verfasser*innen: Ágota Figula & Emese Kása
Titel des Beitrags: Der Unterricht der Analysis in Ungarn in der Sekundarschule und an der Universität im 20. Jahrhundert und heutzutage
Erste Seite: 159
Letzte Seite: 180
Abstract
In unserem Beitrag stellen wir die Entwicklung des Unterrichts der Analysis in Ungarn vom Anfang des 20. Jahrhunderts bis heutzutage dar. Wir führen die Bestrebungen der Reformbewegungen der 1900-er Jahre im Analysisunterricht in den Gymnasien aus, welche Ideen unter anderen Manó Beke, László Rátz oder Tamás Varga hatten, eine an Funktionen orientierte Mathematik zu verstärken. Wir haben ihre Initiativen mit dem heutigen Lehrstoff in den Gymnasien und an der Universität von Debrecen verglichen und wir haben ein Experiment mit Universitätsstudenten im ersten Jahr durchgeführt. Hier haben wir ihre Vorkenntnisse zum Thema Funktionen erhoben, dann versuchten wir in den Seminaren des Kurses Mathematik 1 die Methoden der schon erwähnten Mathematiker zu verwenden. Wir wollten erfahren, ob die Studenten, die mit der Orientierung an Funktionen Mathematik gelernt haben, am Ende des Semesters das Gelernte besser anwenden können. Nach unseren Erfahrungen konnten die Teilnehmenden gegenüber ihren Kommilitonen bessere Leistungen bieten. Deswegen denken wir, dass das Nacherleben von früheren Methoden auf die Studenten positiv wirkt und es den heutigen Unterricht reformieren und effektiver machen kann.
============================================
Verfasser*innen: Klára Pintér & András Ambrus
Titel des Beitrags: Theorie und Praxis des Unterrichts zum mathematischen Problemlösen – Implementation der Pólya-Prinzipien in den Mathematikunterricht
Erste Seite: 181
Letzte Seite: 192
Abstract
Trotz vieler Bemühungen ist die Lücke zwischen Theorie und Praxis im Mathematikunterricht sehr groß. In unserem Artikel stellen wir zunächst die Prinzipien und Ideen von György Pólya kurz dar. Anhand des Kapitels Wie löst man Probleme? aus dem Lehrbuch Vielfalt der Mathematik 6 analysieren wir, wie die Prinzipien und Ideen in die Praxis des ungarischen Mathematikunterrichts erfolgreich implementiert werden können.
============================================
Verfasser*innen: Sabine Apfler
Titel des Beitrags: Einsatz von ChatGPT in der Planung einer Unterrichtseinheit Mathematik und Robotik von Studierenden der PH Niederösterreich
Erste Seite: 195
Letzte Seite: 204
Abstract
Der Artikel wirft einen Blick auf die gegenwärtige Auseinandersetzung mit künstlicher Intelligenz in Österreich. Zur Sprache kommen dabei die Vorzüge und Grenzen von ChatGPT hinsichtlich der Unterrichtsvorbereitung zukünftiger Lehrpersonen. Vorgestellt wird ein internationales Forschungsprojekt, das untersucht, welchen zusätzlichen Nutzen ChatGPT angehenden Lehrpersonen für die Unterrichtsplanung bietet, insbesondere wenn es um den Einsatz von Robotern (Beebots) im Mathematikunterricht geht.
============================================
Verfasser*innen: Christine Bescherer & Andrea Hoffkamp
Titel des Beitrags: Wie digitale Werkzeuge das Argumentieren und Beweisen verändern (können)
Erste Seite: 205
Letzte Seite: 218
Abstract
Digitale Lernumgebungen bieten aussichtsreiche Möglichkeiten, das aktive Argumentieren und Beweisen im Mathematikunterricht anzuregen und zu unterstützen. Zugleich lassen sich die damit verbundenen kognitiven Prozesse externalisieren und deren Entwicklungsstufen so deutlich werden. Dabei bleibt es die notwendige Aufgabe der Lehrkräfte, den unterrichtlichen Einsatz digitaler Hilfsmittel zu moderieren sowie die Korrektheit und die Vollständigkeit der Argumentation einzufordern und zu überprüfen.
============================================
Verfasser*innen: Johann Sjuts
Titel des Beitrags: Sprachlogische Komplexität als Schwierigkeitsmerkmal von Aufgaben in Mathematik und die erratischen Eigentümlichkeiten der generativen Künstlichen Intelligenz
Erste Seite: 219
Letzte Seite: 242
Abstract
Die Schwierigkeit einer mathematischen Aufgabe wird zu einem nicht unerheblichen Teil durch die sprachlogische Komplexität des Aufgabentextes bestimmt. Dies ist von Bedeutung, wenn man zur Lösung der Aufgabe einen generativen KI-Chatbot zu Rate zieht. Der vorliegende Beitrag befasst sich mit einer Analyse mehrerer Aufgabenbearbeitungen des Chatbots GPT-4. Dessen erratische Eigentümlichkeiten machen deutlich, dass ein verantwortungsbewusster Einsatz von GPT-4 nicht voraussetzungsfrei ist. Daraus ergeben sich Schlussfolgerungen für das Lehren und Lernen von Mathematik.
============================================
Verfasser*innen: Kinga Szűcs
Titel des Beitrags: Bolyais Idee zur Winkeldreiteilung an einer Hyperbel in einer Unterrichtseinheit mit GeoGebra – gegliedert im Sinne Pólyas
Erste Seite: 243
Letzte Seite: 264
Abstract
Der Beitrag ist dem – unlösbaren – klassischen mathematischen Problem der Winkeldreiteilung gewidmet. Er enthält zunächst die Lösung von János Bolyai für das Problem der Winkeldreiteilung unter Verwendung der Eigenschaften einer gleichseitigen Hyperbel, also einer Sonderbedingung, die den Forderungen der euklidischen Konstruktion nicht entspricht. Es folgt die Präsentation einer entlang der Phasen des Problemlösens nach Pólya (1995) gegliederten Unterrichtseinheit. Diese umfasst
▪ die Problematik der euklidischen Konstruktion sowie der Winkeldreiteilung,
▪ eine Nachkonstruktion der Abbildung von Bolyai mit GeoGebra,
▪ eine mit digitalen Mitteln unterstützte Begründung, dass die Abbildung von Bolyai eine Lösung für das Problem der Winkeldreiteilung liefert, und
▪ die Überprüfung der Konstruktionsschritte von Bolyai aus dem Blickwinkel der euklidischen Konstruktion.
Das Besondere an der Winkeldreiteilung von Bolyai ist, dass sie verschiedene mathematische Gebiete (Geometrie, Trigonometrie und Funktionen) im Rahmen eines Problemlöseprozesses miteinander verbindet.