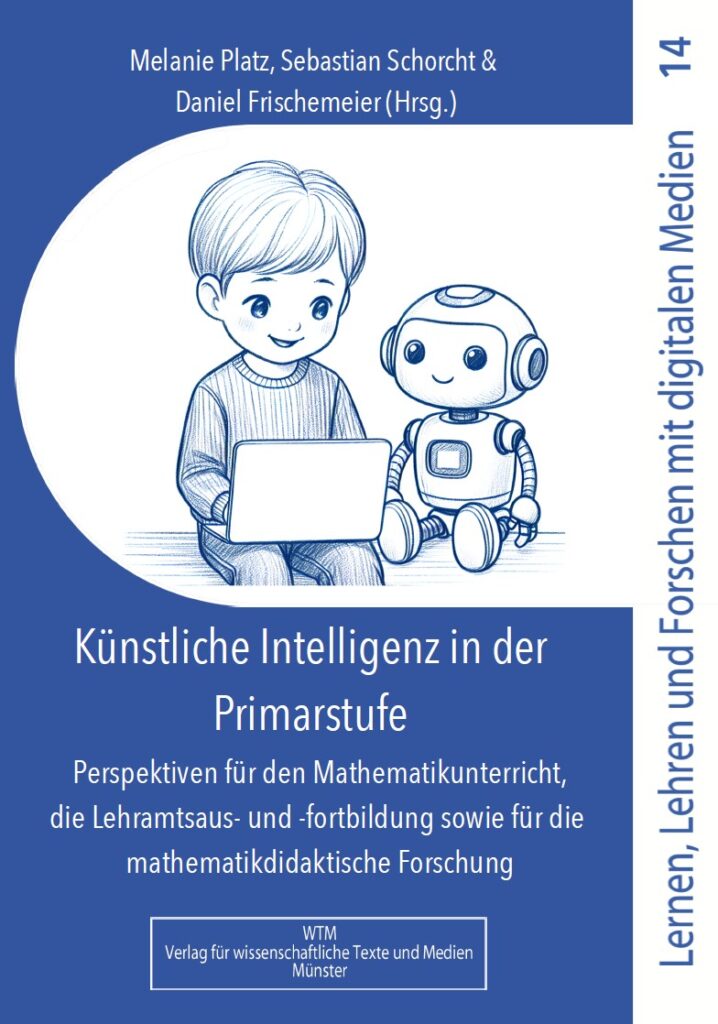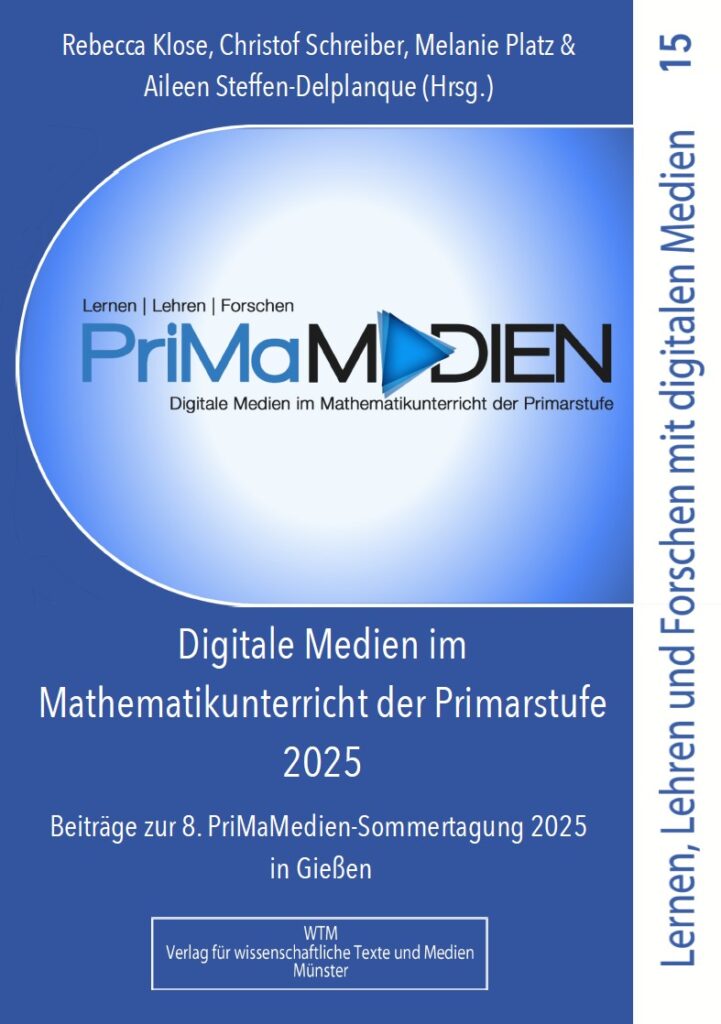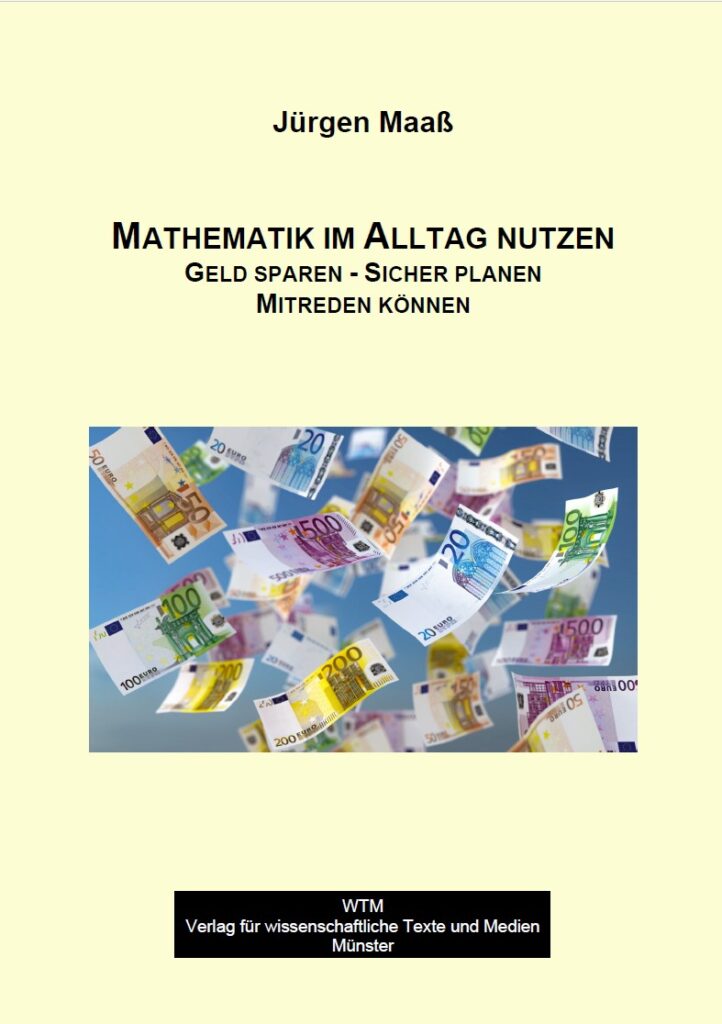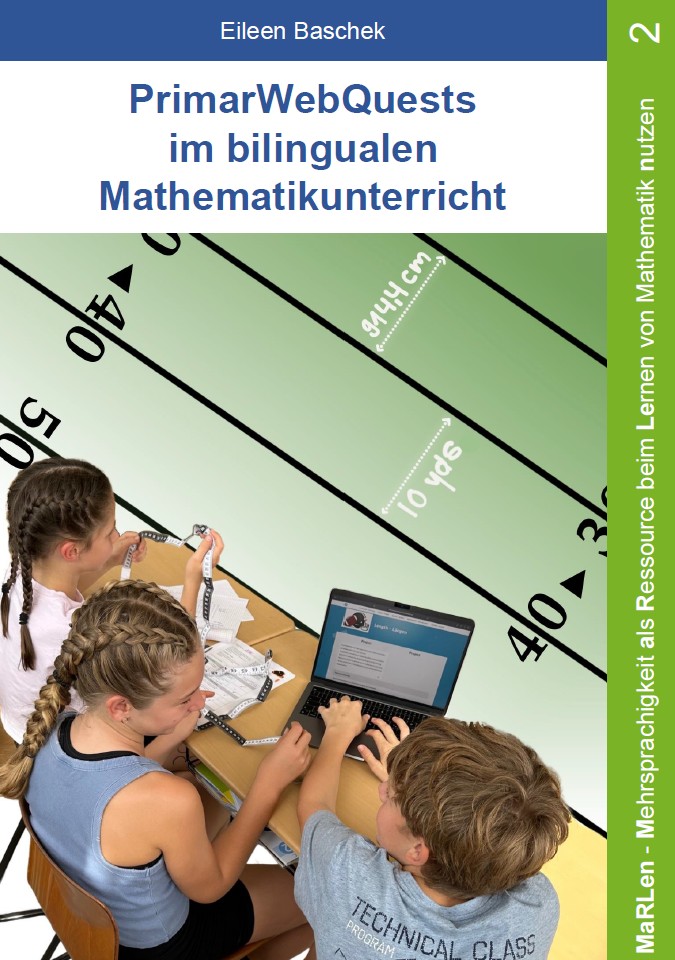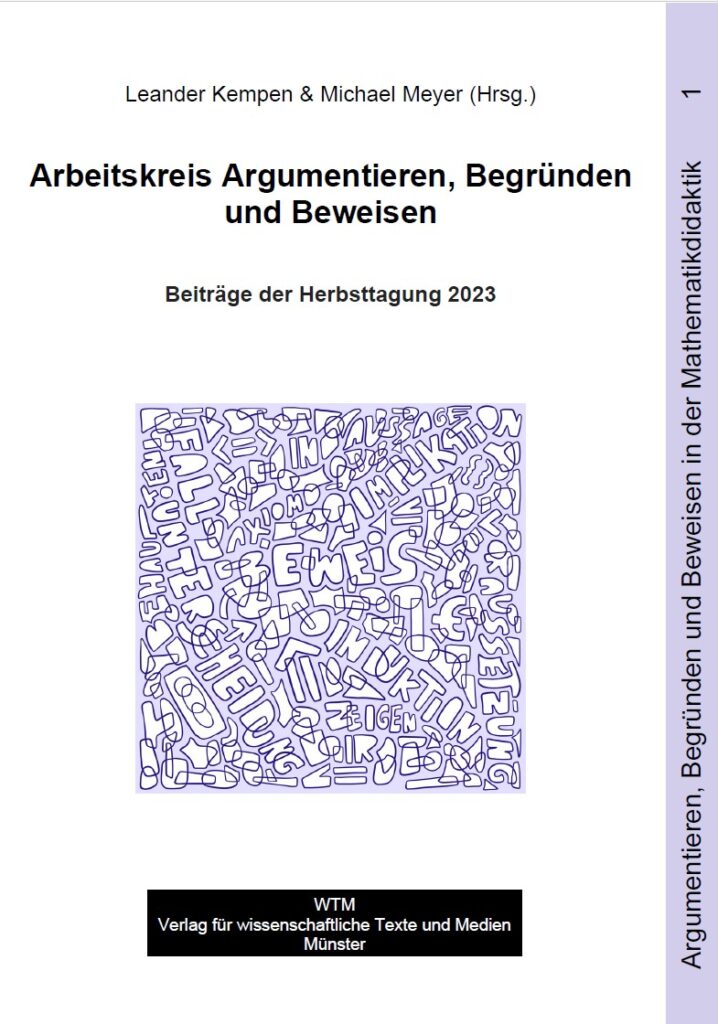Festschrift für Günter Krauthausen
Festschrift für Günter Krauthausen
Band 7 der Reihe Festschriften der Mathematikdidaktik
Münster: WTM-Verlag 2021
Ca. 250 S., DIN A5
978-3-95987-161-7 Print 34,90 €
978-3-95987-162-4 E-Book 31,90 €
https://doi.org/10.37626/GA9783959871624.0
Für Bestellungen bei edition-buchshop hier klicken
Abstract
Diese Festschrift ist Herrn Professor Dr. Günter Krauthausen zum Eintritt in den Ruhestand gewidmet.
Günter Krauthausen hebt in seinen Arbeiten das lebendige und aktive Mathematiktreiben mit Grundschulkindern als wesentliches Gestaltungsmerkmal eines zeitgemäßen Mathematikunterrichts hervor. Dessen Umsetzung kommt nicht mit einfachen Rezepten aus, vielmehr bedarf es der Entwicklung erprobter, nachhaltig tragfähiger Konzepte. Unter diesem Blickwinkel bringen die Autoren des Bandes, enge Weggefährten Günter Krauthausens während seiner akademischen Schaffenszeit, in ihren Beiträgen Ideen und Erkenntnisse mit unterschiedlichsten praxisorientierten Schwerpunksetzungen hervor. Diese umfassen den Bereich der Lehrerbildung sowie –professionalisierung, inhaltsbezogene Bereiche, allgemeine mathematische Kompetenzbereiche, den Bereich digitaler wie analoger Medien und Forschermittel, die Differenzierung, sie betrachten Lernprozesse, sie führen von fachlichen Strukturen zu didaktischen Einsichten und stellen Bezüge zur Forschung her.
BEITRÄGE
Verfasser*innen: Dagmar BÖNIG & Bernadette THÖNE
Titel des Beitrags: Potentiale des virtuellen Zwanzigerfeldes für den Einsatz in der Grundschule und Lehramtsausbildung
Erste Seite: 5
Letzte Seite: 16
Abstract
Das Zwanzigerfeld ist als Arbeitsmittel im mathematischen Anfangsunterricht weit verbreitet. Der Umgang mit diesem Arbeitsmittel spielt eine zentrale Rolle im arithmetischen Lernprozess von Kindern. Mit Blick auf die Überwindung zählenden Rechnens stellen gerade die dazu im Unterricht angebotenen Aufgaben und die Diskussion ihrer Bearbeitung im Unterrichtsgespräch ein entscheidendes Qualitätskriterium dar (Schipper 2009; Röhr 2002). Aufgrund der Vielfalt möglicher Aktivitäten gehaltvoller Aufgabenstellungen postuliert Krauthausen bereits 2012 einen evtl. Nutzen der virtuellen Variante. Im vorliegenden Beitrag skizzieren wir ausgehend von den theoretischen Potentialen des virtuellen Zwanzigerfeldes Ergebnisse aus empirischen Erprobungen der App mit Grundschulkindern, um am Ende einen kurzen Ausblick auf den Einsatz im Rahmen der Lehramtsausbildung zu werfen.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871624.0.01
Verfasser*innen: Lena FLORIAN & Heiko ETZOLD
Titel des Beitrags: Würfel mit digitalen Medien – Wo führt das noch hin? Ein tätigkeitstheoretischer Blick auf Würfelhandlungen
Erste Seite: 17
Letzte Seite: 29
Abstract
Dieser Beitrag wird ein Spagat – zwischen alt und neu, zwischen virtuell und real, zwischen Theorie und Praxis. Als Fundament dieses Beitrags dienen Holzwürfel, die zu kleinen Bauwerken werden und so ein bedeutsamer Bestandteil des Geometrieunterrichts sind. Kontakt zwischen Günter Krauthausen und uns entstand im Rahmen des Verbundprojektes „Digitales Lernen Grundschule“, das die Deutsche Telekom Stiftung von 2017 bis 2019 für sechs Hochschulen förderte – unter anderem auch die Universitäten in Hamburg und Potsdam. Dabei entstand (in Potsdam durch Heiko Etzold) die iPad-App „Klötzchen“, für die (u. a. in Hamburg durch Günter Krauthausen und Alexandra Pilgrim) vielfältige Unterrichtsszenarien entwickelt wurden. Die App wiederum bot (Lena Florian in Potsdam) Anlass, eine Virtual-Reality-Umgebung zu Würfelbauwerken zu entwickeln. Da stehen sie nun: Die echten Holzwürfel, die Klötzchen in der iPad-App und die Kuben im virtuellen Raum. Und stehen diese nebeneinander? Werden virtuelle Würfel bald dafür sorgen, dass wir uns keine Splitter mehr einziehen? Ist es von Bedeutung, ob ich nun raues Holz, einen glatten Bildschirm oder einen VR-Controller mit vielen Knöpfen anfasse, um meisterhafte Würfelbauwerke zu erschaffen? Derartigen Fragen möchten wir in unserem Beitrag auf den Grund gehen. Wir betrachten vor allem die Handlungen, die mit Würfeln beim Bauen in den verschiedenen Medien möglich und sinnvoll sind. Wir untersuchen, inwieweit dies geometrisches Verständnis fördern kann. Und nicht zuletzt wollen wir Lehrerinnen und Lehrern Anregungen geben, wie mathematisch wünschenswerte Handlungen von Schülerinnen und Schülern im jeweiligen Medium aufgebaut, diagnostiziert und unterstützt werden können und damit ein vielfältiger, differenzierender Unterricht ermöglicht werden kann.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871624.0.02
Verfasser*innen: Klaus HASEMANN
Titel des Beitrags: Lernhindernisse und Lernprozesse verstehen
Erste Seite: 31
Letzte Seite: 44
Abstract
Ausgangspunkt ist ein auf den ersten Blick geradezu bizarr anmutender Umgang eines 8-Jährigen mit der Aufgabe 9 + 9, über den Lorenz berichtet hat. Ähnliches Verhalten bei mathematischen Sachverhalten kommt – wenn auch meist nicht so extrem – nicht selten vor, und wir fragen nach möglichen Ursachen, aber auch, wie – und warum – bei anderen Kindern mathematische Lernprozesse erfolgreich verlaufen. Dazu betrachten wir eine Reihe von Beispielen aus unterschiedlichen mathematischen Bereichen, aus der Praxis und aus empirischen Untersuchungen, und wir versuchen das jeweilige Verhalten der Kinder nachzuvollziehen, es zu erklären und unter Verwendung von (lern-)theoretischen Modellen zu verstehen.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871624.0.03
Verfasser*innen: Tobias HUHMANN & Hartmut SPIEGEL
Titel des Beitrags: Mit merkmalsorientierten Mengenbildern das Denken in Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten entwickeln
Erste Seite: 45
Letzte Seite: 63
Abstract
„Ein spielerisch-experimenteller Zugang, den der frequentistische Wahrscheinlichkeitsbegriff erlaubt, indem über das Ermitteln und Vergleichen von Häufigkeiten eine Abschätzung für die Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Ereignisses gefunden wird, knüpft stärker an Vorerfahrungen der Kinder im Zusammenhang mit Spielen an.“ (Krauthausen 2018, S. 172)
Im vorliegenden Beitrag stellen wir dar, wie merkmalsorientierte Mengenbilder im Zusammenhang mit Positionierungen auf der Wahrscheinlichkeitsskala Lernende dabei unterstützen können, das Denken in Möglichkeiten und ausgehend davon das Denken in Wahrscheinlichkeiten zu entwickeln. https://doi.org/10.37626/GA9783959871624.0.04
Verfasser*innen: Nora KÜHME, Nikola LEUFER & Martin STEIN
Titel des Beitrags: Sensibilisierungsübungen zur „Sprache im Mathematikunterricht“ – Thematisierung kommunikativer und kognitiver sprachlicher Hürden durch Reflexion eigener sprachlicher Ressourcen
Erste Seite: 65
Letzte Seite: 78
Abstract
Im Zusammenhang mit der Thematisierung von Mehrsprachigkeit im Unterricht (Stichwort „DaZ“) lässt sich in Fortbildungen und Ausbildungsmodulen derzeit eine häufige Nutzung von „Reflexionen“ zur Sprachproblematik beobachten – insbesondere als Einstiegsszenario. Mathematikdidaktische Module stellen hier keine Ausnahme dar, im Gegenteil: Gerade für den vermeintlich „spracharmen“ Mathematikunterricht schaffen solche Sensibilisierungsübungen ein Problembewusstsein und haben insofern eine wichtige fortbildungsdidaktische Funktion. Richtig eingesetzt motivieren sie davon ausgehend jedoch auch inhaltliche Anknüpfungspunkte z. B. zur Thematisierung der Rolle von Sprache im Mathematikunterricht und von konzeptuellen Ansätzen, mit den sprachlichen Anforderungen umzugehen. Um Sensibilisierungsübungen optimal zu nutzen, sind sowohl inhaltliche Passung der Übung, methodische Eignung als auch Kriterien für eine gelungene Reflexionsphase in der Planung abzuklären. Im Kontext „Sprache und Mathematikunterricht“ fällt auf, dass viele Sensibilisierungsübungen vorwiegend auf die kommunikative Funktion von Sprache (Sprache zur „Verständigung“, vgl. Klix 1995, nach Maier & Schweiger 1999, S. 11) abstellen, während die kognitive Funktion von Sprache (Sprache zum „Erkenntnisgewinn“, vgl. ebd.) sich offensichtlich schwieriger auf diese Weise „erfahren“ lässt. Im Folgenden werden Sensibilisierungsübungen aus einem Seminar im LA-Masterstudiengang zum Thema „Sprache im Mathematikunterricht“ an der WWU Münster zu beiden Funktionen vorgestellt und Gelingensbedingungen diskutiert.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871624.0.05
Verfasser*innen: Silke LADEL
Titel des Beitrags: Die Schönheit der Mathematik digital und analog entdecken
Erste Seite: 79
Letzte Seite: 91
Abstract
Die Mathematik ist wunderschön! Oder ist es die Natur, die wunderschön ist? Beides stimmt, denn die Mathematik ist ein Werkzeug, die Schönheit der Natur zu beschreiben und diese Schönheit in Worte zu fassen und mit Symbolen zu notieren. Und weil die Natur so schön ist, ist es gleichsam auch die Mathematik. Diese Erfahrung können Schüler*innen bereits in der Primarstufe machen. In diesem Beitrag wird näher darauf eingegangen, was die Schönheit von Figuren oder Objekten in der Natur ausmacht und wie diese im Mathematikunterricht der Primarstufe aufgegriffen werden kann. Dabei werden Möglichkeiten beschrieben die analoge mit der digitalen Welt zu verknüpfen.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871624.0.06
Verfasser*innen: Jens Holger LORENZ
Titel des Beitrags: Geometrische Aktivitäten in der Grundschule und ihre Weiterentwicklung und Vernetzung am Beispiel der Symmetrie
Erste Seite: 93
Letzte Seite: 104
Abstract
Die Grundschulmathematik lässt die Spannung erleben, einerseits die Inhalte kindgerecht zu vermitteln, und das heißt in der Praxis leider meist schlicht, andererseits die kraftvollen Ideen der Mathematik in nuce anzulegen und sie in solcher Breite darzustellen, dass sie Öffnungen in diverse Richtungen ermöglichen. Die Geometrie wird häufig als das Stiefkind der Grundschulmathematik vernachlässigt, sie wird im Vergleich zur Arithmetik als unbedeutender abgetan. Aber sie stellt mit ihren Bezügen zur Alltagswirklichkeit ein kraftvolles Mittel dar, um vielfältige Beziehungen erleben zu lassen, die anschließend in den höheren Klassen angereichert und begrifflich ausdifferenziert werden. Im Folgenden soll daher an einigen, wenigen Beispielen aus der Geometrie verdeutlicht werden, wie sich aus den Grundschulaktivitäten kraftvolle mathematische Gedanken entwickeln lassen, oder mehr noch, wie diese weiterführenden Ideen bereits in der Grundschule mitthematisiert werden können.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871624.0.07
Verfasser*innen: Katharina MROS & Heinz STEINBRING
Titel des Beitrags: Zur Metamorphose mathematischer Arbeits- und Anschauungsmittel – Grundschulkinder verwandeln Dinge in Symbole
Erste Seite: 105
Letzte Seite: 114
Abstract
Wie entwickelt sich aus einem spontan vertrauten und dem Alltag verhafteten Symbolgebrauch ein spezifischer mathematischer Symbolgebrauch? Wie selbstverständlich nutzen Grundschulkinder schon vor und bei Schulbeginn (geschriebene, gemalte und an Materialien und Dinge gebundene) Zeichen, die nicht einfach für sich selbst, sondern für etwas anderes stehen. Sie handeln und rechnen mit den Zeichen, an Stelle mit dem wofür sie stehen. In diesem Beitrag wird die ganz besondere, epistemologische Natur der im Mathematikunterricht benutzten Zeichen charakterisiert: In gewisser Grundsätzlichkeit referieren mathematische Symbole nicht auf andere (pseudo-) dingliche Objekte. Mathematische Symbole erhalten ihre Bedeutung als Elemente in einem System. Im Theoriekonstrukt »Didaktische Theorie mathematischer Symbole (ThomaS)« wird diese epistemologische Besonderheit mathematischer Symbole in ihren Grundaspekten dargestellt.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871624.0.08
Verfasser*innen: Marianne NOLTE & Kirsten PAMPERIEN
Titel des Beitrags: Ein guter Unterricht braucht gute Lehrkräfte – Beobachten lernen als Teil des Lehrerprofessionswissens
Erste Seite: 115
Letzte Seite: 126
Abstract
Wahrnehmen, interpretieren und das Treffen von Entscheidungen im Unterricht gehören zu den professionellen Tätigkeiten von Lehrkräften. Insbesondere die Anforderungen, die mit einem konstruktivistischen Lehr-Lernverständnis einhergehen, sind hoch. Sie verlangen ein gutes und wertschätzendes Beobachten im Unterricht. Ausgehend von Ausführungen zu den Anforderungen eines „guten“ Unterrichts und den professionellen Kompetenzen von Lehrkräften wird ein Instrument vorgestellt, das für die Talentsuche mathematisch besonders begabter Schüler*innen entwickelt und in verschiedenen Settings erprobt wurde. Das Instrument eignet sich für die Fokussierung auf bestimmte Fragen, die im Unterricht im Zusammenhang mit der Professionellen Unterrichtswahrnehmung gestellt werden können.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871624.0.09
Verfasser*innen: Marcus NÜHRENBÖRGER & Ralph SCHWARZKOPF
Titel des Beitrags: Wieso, weshalb, warum? Vom Beschreiben und Begründen im Mathematikunterricht der Grundschule
Erste Seite: 127
Letzte Seite: 136
Abstract
Wenn Kinder in der Grundschule mathematisches Beweisen kennenlernen, ohne dass sie das Beweisen beim Namen kennen, dann ist zweierlei vonnöten: Erstens sollte der Mathematikunterricht stets mathematische Prozesse und Inhalte reichhaltig miteinander verweben, so dass die Kinder vom ersten Schultag an Routinen entwickeln, eigenständig mathematische Zusammenhänge verbal und materiell zu beschreiben und zu begründen. Zweitens sollten die Aufgabenstellungen den Lernenden stets auch Anlässe zur produktiven Irritation bieten, um von gewohnten Routinen des mathematischen Arbeitens abzuweichen und immer wieder auf neue Weise nach dem Warum zu fragen. In dem Beitrag diskutieren wir am Beispiel des bekannten Aufgabenformats Zahlenmauern die Bedeutung des Argumentierens und Darstellens für das mathematische Lernen der Grundschüler*innen.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871624.0.10
Verfasser*innen: Alexandra PILGRIM & Bastian SCHMITT
Titel des Beitrags: Organisation von digital unterstützten Lernprozessen – Erprobung einer substanziellen Lernumgebung zum Aufgabenformat Rechendreieck
Erste Seite: 137
Letzte Seite: 151
Abstract
Im Rahmen des Digitalpakts, im Zuge von Corona durch weitere Fördergelder ergänzt, erhalten alle Schulen auf Antrag Anschubfinanzierungen für digitale Ausstattung, dazu gehören z.B. mobile Endgeräte, WLAN und Administration. Neben den offenen Fragen zur Bereitstellung von dauerhaften Ressourcen für technischen Betrieb, Support und Wartung besteht die dringende Notwendigkeit pädagogischer, aber auch fachdidaktischer Konzepte für einen sinnvollen Einsatz der digitalen Medien im Unterricht. Die Entwicklung tragfähiger und nachhaltiger, fachdidaktischer Konzepte braucht allerdings Zeit und läuft nicht konform mit technischen und politischen Entwicklungen (vgl. Krauthausen 2020b). Die Planung und Erprobung von Good Practice Beispielen unter Einbezug qualitativ vielversprechender digitaler Anwendungen (z.B. Apps), die Entwicklung ebensolcher sowie die wissenschaftliche theoretische Untermauerung stehen noch am Anfang, wenn auch bereits seitens fachdidaktischer Expertise einige gehaltvolle Arbeiten zum Mathematikunterricht mit digitalen Medien in der Grundschule vorliegen. Dieser Beitrag stellt anhand von erprobten Unterrichtsbeispielen erste Eindrücke zu Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes der App DAS INTERAKTIVE RECHENDREIECK von Christian Urff (2017) bei der Organisation von Lernprozessen dar und zieht daraus konzeptionelle Schlüsse für das digitalunterstützte Mathematiklernen in der Grundschule.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871624.0.11
Verfasser*innen: Christof SCHREIBER
Titel des Beitrags: Lehrerbildung mit der Praxis – Lehrerbildung für die Praxis
Erste Seite: 153
Letzte Seite: 162
Abstract
Vorgestellt wird die Konzeption eines Seminars im Rahmen der Lehrerbildung für die Primarstufe, an dem neben den Studierenden auch Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst und Lehrkräfte aus Schulen teilnehmen. Die Studierenden planen gemeinsam mit den Beteiligten aus der Praxis Mathematikunterricht, führen diesen durch und reflektieren die Durchführung im gemeinsamen Seminar. Dabei finden die Unterrichtsszenarien mit digitalen Medien statt. Einzelne Szenarien werden im Beitrag beispielhaft beschrieben.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871624.0.12
Verfasser*innen: Christoph SELTER
Titel des Beitrags: Forschermittel im Arithmetikunterricht der Primarstufe
Erste Seite: 163
Letzte Seite: 174
Abstract
„Es wäre „eine Illusion zu glauben oder zu hoffen, dass es nur einer entsprechend ›guten Aufgabe‹ oder Fragestellung bedürfe, und schon würde sich aus dieser Sache heraus natürliche Differenzierung naturgemäß ereignen.“
(Krauthausen, 2018, S. 299)
Der vorliegende Beitrag beschreibt am Beispiel einer Unterrichtsreihe zu den Entdeckerpäckchen, wie Forschermittel die Lernenden im Sinne der Natürlichen Differenzierung dabei unterstützen können, Entdeckungen zu machen, zu beschreiben und zu begründen.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871624.0.13
Verfasser*innen: Thomas TRAUTMANN
Titel des Beitrags: Differenzieren müsste man können… Anmerkungen zu einem immer neuen Thema
Erste Seite: 175
Letzte Seite: 182
Abstract
Maria Montessori hat sich – ebenso wie Günter Krauthausen, aber von anderer Warte her – eine große Zeit ihres Lebens mit Selbsterziehungsprozessen des Kindes auseinandergesetzt. Scheinbar fassungslos macht uns ein Abschnitt aus einem ihrer Werke:
„Wenn man bisher von der individuellen Entwicklung in der Schule sprach, stellte man sich immer einen Lehrer vor, der, anstatt eine ganze Klasse zu unterrichten, jedem einzelnen Kind sich widmete. Wenn das geschähe, würde das arme Kind ja noch geknechteter werden, als es in der früheren Schule war.“ (Montessori 1923, S. 12)
Das klingt zunächst dramatisch und wirft die Frage auf, was differenzieren eigentlich ist und was es im Idealfall bewirken sollte.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871624.0.14
Verfasser*innen: Daniel WALTER & Roland RINK
Titel des Beitrags: Tablet-Apps zwischen K.O. und O.K.
Erste Seite: 183
Letzte Seite: 195
Abstract
Das Thema Digitalisierung erfährt sowohl in formellen als auch informellen Settings seit einigen Jahren immer größere Aufmerksamkeit. Dabei sind es vor allem Tablet-Apps, denen vor allem im Grundschulbereich besondere Lernchancen für das Lernen im Fach Mathematik beigemessen werden. Die Auswahl passender Apps ist dabei zumeist eine erste Herausforderung für die Planung digital gestützten Unterrichts. Daher werden im Beitrag zunächst Kriterien zur Analyse von Apps vorgestellt, bevor einerseits marktführende und andererseits weniger stark verbreitete Apps entlang der beschriebenen Kriterien analysiert werden.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871624.0.15
Verfasser*innen: Nicole WELLENSIEK
Titel des Beitrags: Mathematik aus der Sache heraus – Wie viel Mathematik steckt im Kräuterbeet?
Erste Seite: 197
Letzte Seite: 209
Abstract
In diesem Beitrag wird die Mathematik von der Sache her betrachtet. Es soll aufgezeigt werden, wie Situationen und Themen aus dem Alltag von Grundschulkindern zu sinnvollen und motivationsfördernden Lernanlässen im Mathematikunterricht werden können. Einerseits lässt sich mathematisches Interesse über Realsituationen leicht wecken, andererseits ergeben sich aus der Komplexität der Themen besondere Schwierigkeiten im Unterricht. Dieser Problematik wird häufig durch eine Reduktion und Vereinfachung der Sachinhalte begegnet, was Sachinformationen verfälschen kann und ggf. zum „Sinnverlust“ der Sache führt. Dieser Artikel möchte aufzeigen, wie ein realitätsnaher, sinnstiftender Mathematikunterricht durch Methoden wie Handlungsorientierung und Natürlicher Differenzierung auch in heterogenen Lerngruppen gelingen kann. Im zweiten Teil des Beitrags werden diese Überlegungen an einem Beispiel im Kontext „Eigene Kräuter pflanzen“ weiter konkretisiert und veranschaulicht.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871624.0.16
Verfasser*innen: Erich Ch. WITTMANN
Titel des Beitrags: Strichrechnungen und Punktrechnungen in der Grundschule. Eine strukturgenetische didaktische Analyse
Erste Seite: 211
Letzte Seite: 227
Abstract
In diesem Beitrag werden aus einer genetischen Sicht des Faches Mathematik Vorschläge zur Didaktik des Rechenunterrichts der Grundschule gemacht, die zu einem auf das Wesentliche konzentrierten Curriculum führen. Es wird aufgezeigt, dass mit einem solchen Curriculum die kognitive Belastung der Kinder reduziert und gleichzeitig ein höheres fachliches Niveau über die Grundschule hinaus erreicht werden kann. Insofern erscheint der Beitrag auch für die Didaktik der Sekundarstufen relevant.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871624.0.17