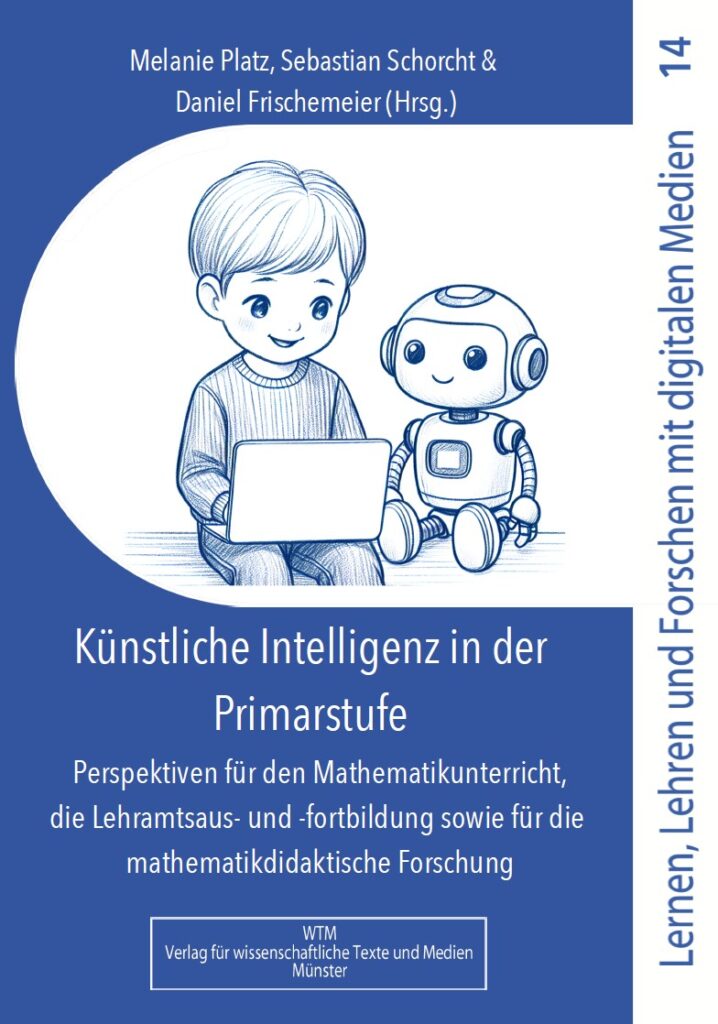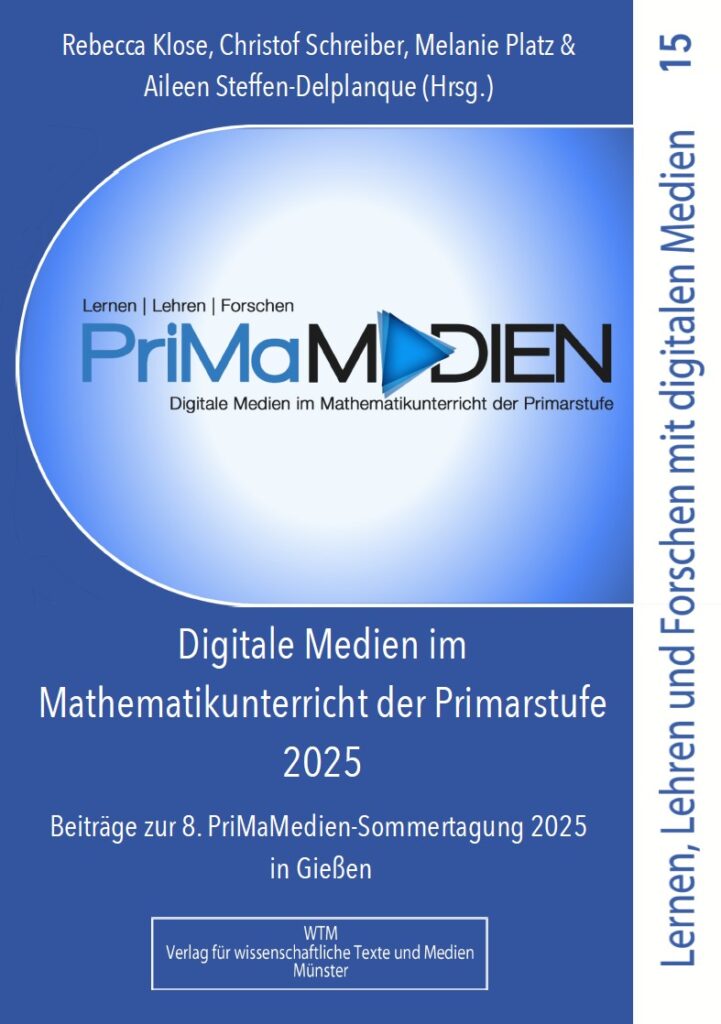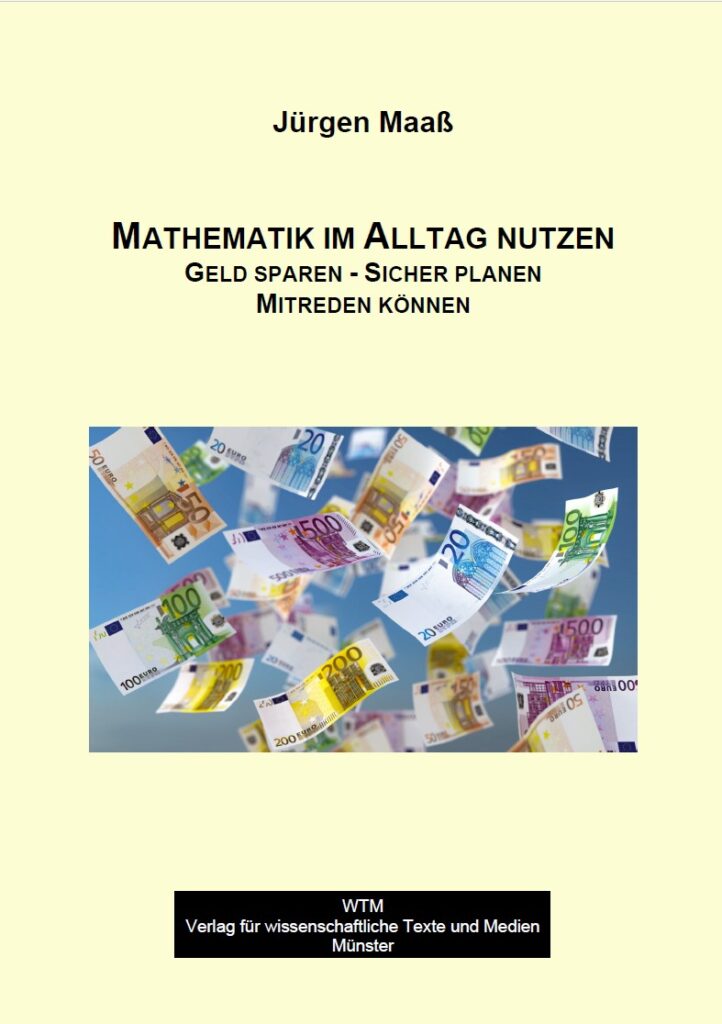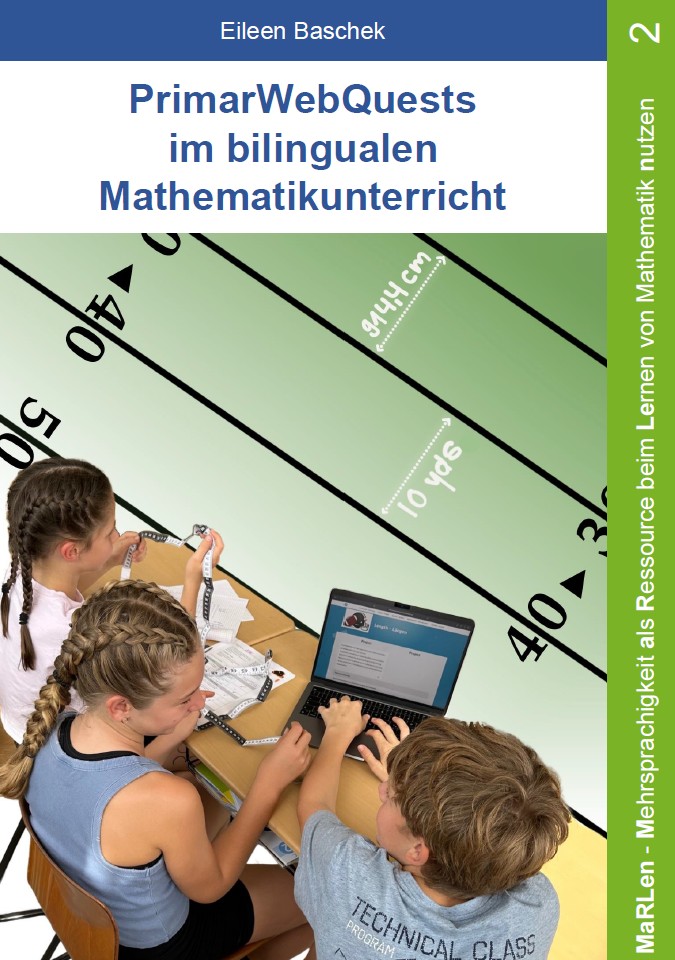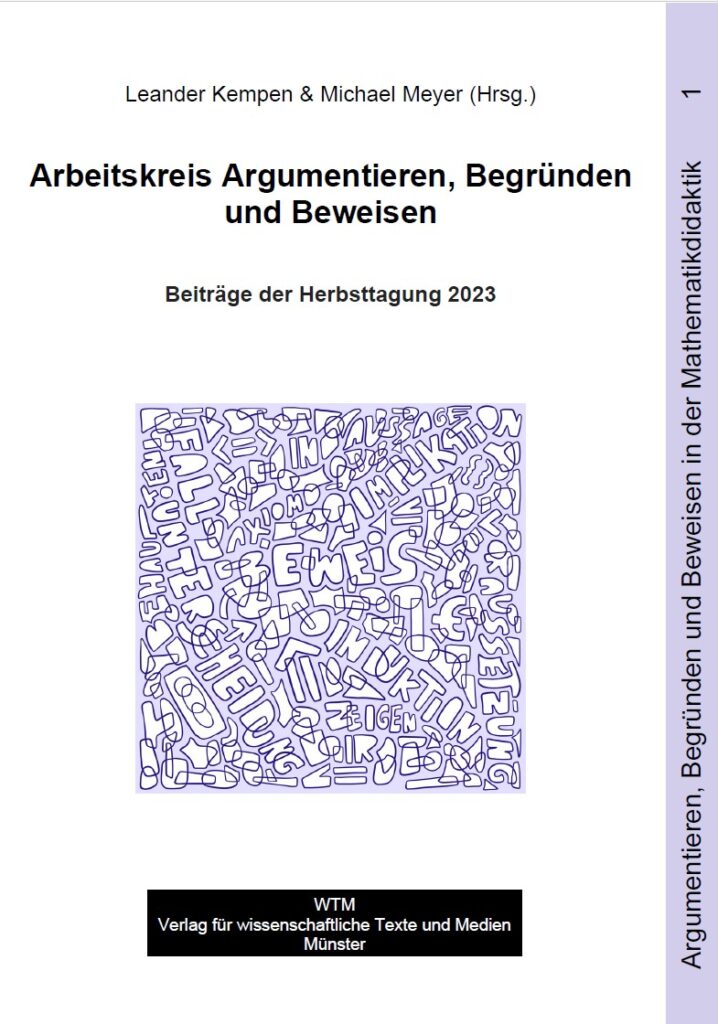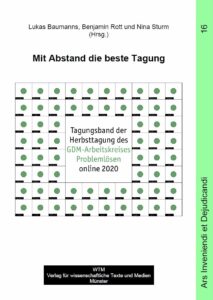
Tagungsband der Herbsttagung des GDM-Arbeitskreises Problemlösen online 2020
Band 16 der Reihe Ars inveniendi et dejudicandi
Münster: WTM-Verlag 2021.
Ca. 140 Seiten, DIN A5
978-3-95987-193-8 Print 19,90 €
978-3-95987-194-5 E-Book 18,90 €
https://doi.org/10.37626/GA9783959871945.0
Für Bestellungen bei edition-buchshop hier klicken
ABSTRACT
Auch im Herbst 2020 hat sich der GDM-Arbeitskreis Problemlösen – trotz oder gerade wegen der im Hinblick auf Treffen im Allgemeinen und Tagungen im Speziellen schwierigen Situation aufgrund der Corona-Pandemie – zusammengefunden, um sich über aktuelle Erkenntnisse und Überlegungen aus dem Themenfeld des Problemlösens und -stellens auszutauschen.
Aufgrund der Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie wurde diese Herbsttagung – anders als sonst – nicht in Präsenz, sondern auf Distanz abgehalten: Am 7. und 8. Oktober 2020 haben sich Interessierte des mathematischen Problemlösens online zusammengefunden. Diese Umstände haben aber keineswegs die Qualität der Inhalte und Diskussionen beeinträchtigt.
Aus den Vorträgen und Diskussionen während der Herbsttagung haben acht Beiträge ihren Weg in den vorliegenden Tagungsband gefunden:
Neben Überlegungen zum Rückwärtsarbeiten, dem Verständnis problemhaltiger Aufgaben in zentralen Abschlussprüfungen und Überlegungen im Hinblick auf Heurismen, sind in diesem Band auch Praxisbeträge enthalten, in denen das Problemlösen mittels digitaler Werkzeuge beleuchtet wird.
BEITRÄGE
Verfasser*innen: Isabelle Gretzschel, Daniela Aßmus und Torsten Fritzlar
Titel des Beitrags: Zum flexiblen Umgang mit variierten mathematischen Anforderungen – Eine Interviewstudie zu einer Problemserie zum Rückwärtsarbeiten
Erste Seite: 3
Letzte Seite: 18
Abstract
In der Auseinandersetzung mit mathematischen Problemstellungen werden Schülerinnen und Schüler immer wieder mit unterschiedlichen und auch für sie neuen Anforderungen konfrontiert. Für deren erfolgreiche und effiziente Bearbeitungen, abseits oft langwieriger willkürlich probierender Vorgehensweisen, sind Anpassungen an die jeweils vorliegenden Bedingungen erforderlich. Diese Fähigkeit wird nicht nur im alltäglichen Sprachgebrauch als Flexibilität bezeichnet. Vor diesem Hintergrund interessieren wir uns für den Umgang mit geringfügig variierten mathematischen Problemstellungen, bei deren Bearbeitungen zuvor verwendete Vorgehensweisen unter Anpassung an die veränderten Bedingungen erneut genutzt werden können. Im Rahmen einer Interviewstudie wurde dafür eine Problemserie zu unterschiedlichen Anforderungen zum Rückwärtsarbeiten entwickelt. Aus den Variationen der Probleme resultierte die Notwendigkeit, nicht probierend angelegte Vorgehensweisen zu verändern. Der Beitrag soll einen ersten Einblick in den Umgang von Schülerinnen und Schülern der sechsten Klassenstufe mit dieser Problemserie bieten. Die Bearbeitungen wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse kategoriebasiert ausgewertet und mit dem Verständnis von Flexibilität als Handlungsmerkmal in einem neu entwickelten Synthesemodell zusammengeführt, welches flexibles Handeln beim Bearbeiten mathematischer Probleme veranschaulichen soll.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959871945.0.01
Verfasser*innen: Lukas Baumanns und Benjamin Rott
Titel des Beitrags: Revisiting Problem Posing: Versuch einer konzeptuellen Ordnung
Erste Seite: 19
Letzte Seite: 34
Abstract
Im vorliegenden Beitrag wird der Versuch einer konzeptuellen Ordnung unterschiedlicher Problem-Posing-Tätigkeiten vorgenommen. Dieses Konzept verbindet drei Konstrukte aus der Forschung zum Problem Posing, Problemlösen und der Psychologie: (1) Problemstellen als Generieren neuer oder Reformulieren gegebener Probleme, (2) das Aufwerfen von Aufgaben auf dem Spektrum zwischen Routineaufgaben und Problemen und (3) metakognitives Verhalten beim Problem Posing. Diese Dimensionen werden zunächst theoretisch konzeptualisiert und schließlich operationalisiert. Anschließend wird die Anwendung dieser Dimensionen qualitativ anhand empirischer Studien zum Problem Posing demonstriert.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959871945.0.02
Verfasser*innen: Thomas Gawlick
Titel des Beitrags: „Man muss rückwärts rechnen“ – Zur Arbeitsrichtung bei der 7-Tore-Aufgabe
Erste Seite: 35
Letzte Seite: 50
Abstract
Die 7-Tore-Aufgabe wird oft als Beispiel für Rückwärtsarbeiten genannt. Bereits Fünftklässler kommen bei der Bearbeitung schnell zu der Einschätzung: „Man muss rückwärts rechnen“. Aber bedeutet Rückwärtsrechnen dasselbe wie Rückwärtsarbeiten? Und woher kennen bzw. können die Kinder das? Auf Grundlage der Konzepte Aufgabe-Kehraufgabe-Umkehraufgabe aus dem Bereich des Operativen Übens im Mathematikunterricht der Grundschule wird Königs Operationalisierung des Vorwärts- und Rückwärtsarbeitens mittels Lösungsgraphen genutzt, um die Situation zu klären: Das Rückwärtsrechnen der Kinder erweist sich hier tatsächlich Vorwärtsarbeiten. Diese Vorgehensweise wird in der Grundschule eingeübt, muss hier aber akkommodiert werden für die iterierte Umkehrung der Verkettung zweier Operationen – dass hierbei die Reihenfolge zu vertauschen ist, wird leicht übersehen. Dieses Problem kann mittels Probe erkannt oder durch geeignete symbolische und/oder ikonische Notation der Zwischenschritte vermieden werden.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959871945.0.03
Verfasser*innen: Wilfried Dutkowski
Titel des Beitrags: Vom Schattenbild zur Abbildung
Erste Seite: 51
Letzte Seite: 64
Abstract
Ausgehend von Beispielen zur Optik (Schatten und Lochkamera) stehen Anwendungen des Strahlensatzes im Fokus einer stoffdidaktischen Analyse. In Vernetzung mit dem Fach Physik werden sowohl die mathematischen Grundlagen in interaktiven Dateien aufbereitet als auch exemplarisch gezeigt, wie man digital unterstützt, Problemlösen für Schülerinnen und Schüler initiieren und durchführen kann. Die Beispiele bauen auf aktueller Literatur auf und werden mit einer 25-jährigen Berufserfahrung verknüpft, so dass dem Betrachter eine Mischung aus Unterrichtsanekdoten und bewährten Applets angeboten wird. Der beispielhafte Einblick in die Möglichkeit, ein digitales Lernarrangement zu einem problemlösenden Unterricht zu entwickeln, beleuchtet auch die Schwierigkeiten, dieser Idee im Rahmen der outputorientierten Unterrichtserwartungen gerecht zu werden. Alle Dateien sind in einem GeoGebra-Book unter https://www.geogebra.org/m/upjwgset abrufbar (siehe QR-Code rechts), und können selbstständig ausprobiert und untersucht werden.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959871945.0.04
Verfasser*innen: Heike Hagelgans
Titel des Beitrags: „Teil B – Das sind doch alles problemhaltige Aufgaben.“ Zum Verständnis von problemhaltigen Aufgaben im Prüfungsformat der besonderen Leistungsfeststellung
Erste Seite: 65
Letzte Seite: 79
Abstract
Die Besondere Leistungsfeststellung (BLF) wurde 2006 im Freistaat Sachsen als Format einer zentralen Prüfung an den allgemeinbildenden Gymnasien mit dem Ziel eingeführt, dass alle Schüler*innen nach der Klassenstufe 10 einen Realschulabschluss erhalten können. Schaut man in das Erwartungsbild dieser Prüfung, so sind der überwiegende Teil der Aufgaben als problemhaltige Aufgaben gekennzeichnet. Am Beispiel der Besonderen Leistungsfeststellung des Jahres 2020 wird genauer untersucht, welche Aufgaben als problemhaltig vom Kultusministerium gekennzeichnet werden und wie eine zehnte Klasse die Aufgaben exemplarisch bewältigt. Es zeigt sich, dass die Zuschreibung von Aufgaben als problemhaltige Aufgaben sehr breit ist und dass die Aufgaben der BLF insgesamt für die Schüler*innen dieser Klasse sehr herausfordernd waren.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959871945.0.05
Verfasser*innen: Karl Heuer, Benjamin Rott und Deniz Sarikaya
Titel des Beitrags: Eine Adaption von Polymath für mathematisch begabte Schüler:innen: Ein Vorschlag (auch) für Distanzphasen
Erste Seite: 81
Letzte Seite: 95
Abstract
In diesem Artikel präsentieren wir eine Adaption des Polymath-Formats für mathematisch begabte Schüler:innen, d. h. eine textbasierte Art, gemeinsam an mathematischen Problemen zu arbeiten – beispielsweise in Distanzphasen. Dies funktioniert potentiell asynchron, wobei oft Teilnehmende gleichzeitig arbeiteten. Wir argumentieren, dass das Format reguläres Arbeiten im Klassenraum ergänzen kann und – im Gegensatz zu Videokonferenzen – zudem auch in Gebieten mit schlechter Netzanbindung verwendet werden kann. Im hier vorgestellten Projekt hat „echte mathematische Forschung“ stattgefunden, d. h. die Schüler:innen haben ein sehr anspruchsvolles Problem bearbeitet, gemeinsam gelöst und darüber hinausgehende Kenntnisse erworben. Hierfür stellen wir einen Probedurchgang mit Schüler:innen der William-Stern-Gesellschaft vor. Es bleibt abzuwarten, ob das Format auch auf breitere Populationen von Lernenden angewendet werden kann.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959871945.0.06
Verfasser*innen: Inge Schwank
Titel des Beitrags: Gesucht: 4 spezielle Zahlen mit 45 in Summe – Graphische Darstellungen als Erkenntnismittel
Erste Seite: 97
Letzte Seite: 114
Abstract
Schülerinnen und Schüler sollen in ihrer Fähigkeit zum mathematischen Problemlösen gestärkt werden. Dazu müssen ihnen Zugänge zu mathematischen Problemen geschaffen werden. Bekannt sind die nützlichen Hinweise von Pólya zur Problembearbeitung. Zeichnungen (figures) spielen dabei eine wichtige Rolle. Junge Schülerinnen und Schüler, denen die nützliche Symbolsprache der Algebra noch nicht zur Verfügung steht, könnten in besonderer Weise vom Einsatz von Bildern, Skizzen, allgemein graphischen Darstellungen, profitieren, da sie anhand dieser Repräsentationsformen komplexere mathematische Zusammenhänge gleichwohl durchdenken und sich erschließen können. Dies würde eine besondere Förderung der Entwicklung ihres mathematischen Denkens bedeuten. Solange die Auffassung verbreitet ist, formale Mathematik sei die ‚richtige‘ Mathematik, besteht noch Aufklärungsbedarf. Auch am Beispiel einer Problembearbeitung, entnommen einer Mathematik-Olympiade für Drittklässlerinnen und Drittklässler mit unzureichendem Einsatz graphischer Darstellungen, zeigt sich, dass noch weitere Anstrengungen unternommen werden müssen. Zur Übung – gerade auch für Erwachsene – und Veränderung ihres Blicks können Beispiele, die in nicht-mathematikdidaktischer Literatur zu finden sind und bei denen auf erhellende graphische Darstellungen verzichtet wird, dienen. Die Beschäftigung mit dem Themenkomplex reicht in der Mathematikdidaktik weit zurück.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959871945.0.07
Verfasser*innen: Annika Bachmann und Eva Müller-Hill
Titel des Beitrags: Problembearbeitungen unterstützen – Potential heuristischer Lösungsbeispiele als Lernangebotsformat im Mathematikunterricht
Erste Seite: 115
Letzte Seite: 133
Abstract
In diesem Beitrag untersuchen wir heuristische Lösungsbeispiele und deren Potential als ein vorstrukturiertes, vorstrukturierendes und auf medial schriftlichem Text basiertes Lernangebotsformat mit Blick auf das mathematische Problemlösen. Dazu erarbeiten wir eine Konzeptualisierung des Konstruktes „heuristische Strategie“ und darauf aufbauend ein „Lernfeld zum Auf- und Ausbau einer individuellen heuristischen Strategie“. Auf dieser Basis analysieren wir theoriegeleitet einzelne bekannte, adaptierte und neue Gestaltungselemente eines heuristischen Lösungsbeispiels hinsichtlich deren theoretischen Potentials, Lernprozesse zum Auf- und Ausbau einer individuellen heuristischen Strategie zu initiieren. Die Analyse verdeutlicht, dass Lernende individuelle heuristische Strategien durch die Bearbeitung heuristischer Lösungsbeispiele auf- und ausbauen können. Diese theoretischen Ergebnisse dienen als Grundlage für weitere qualitative empirische Untersuchungen. Der Beitrag ordnet sich in das Promotionsvorhaben der Erstautorin ein und beschreibt work in progress.
DOI: https://doi.org/10.37626/GA9783959871945.0.08