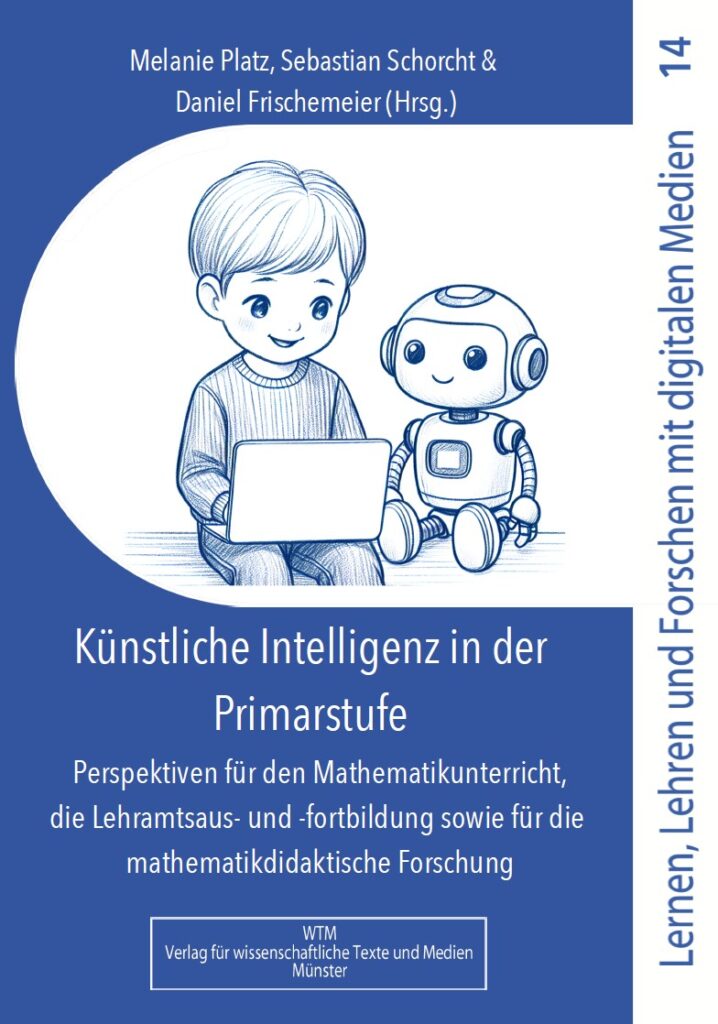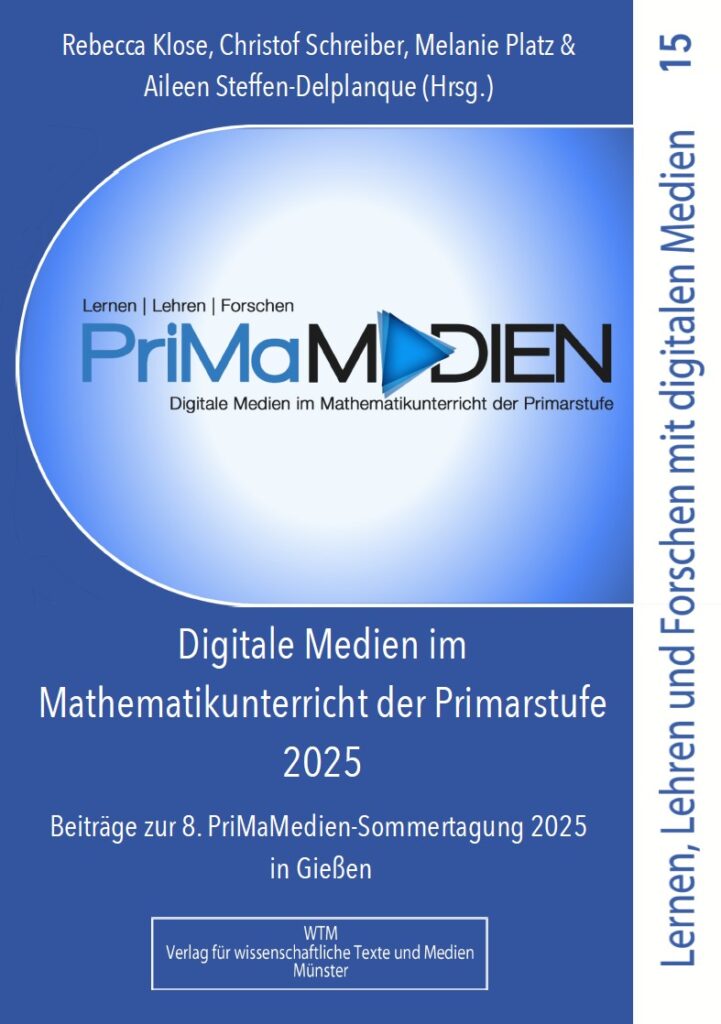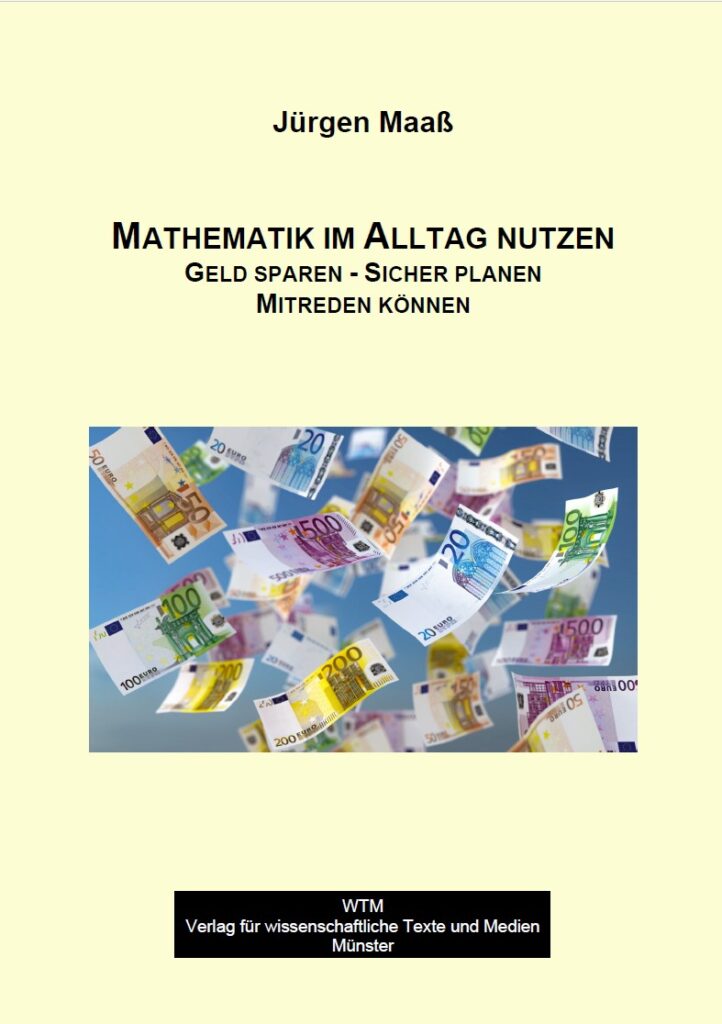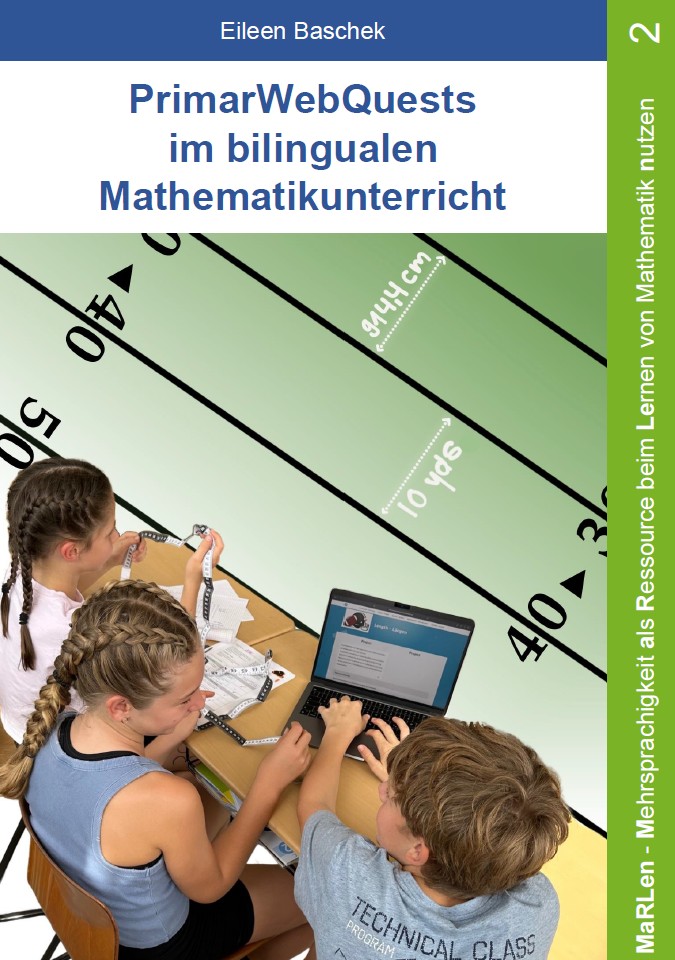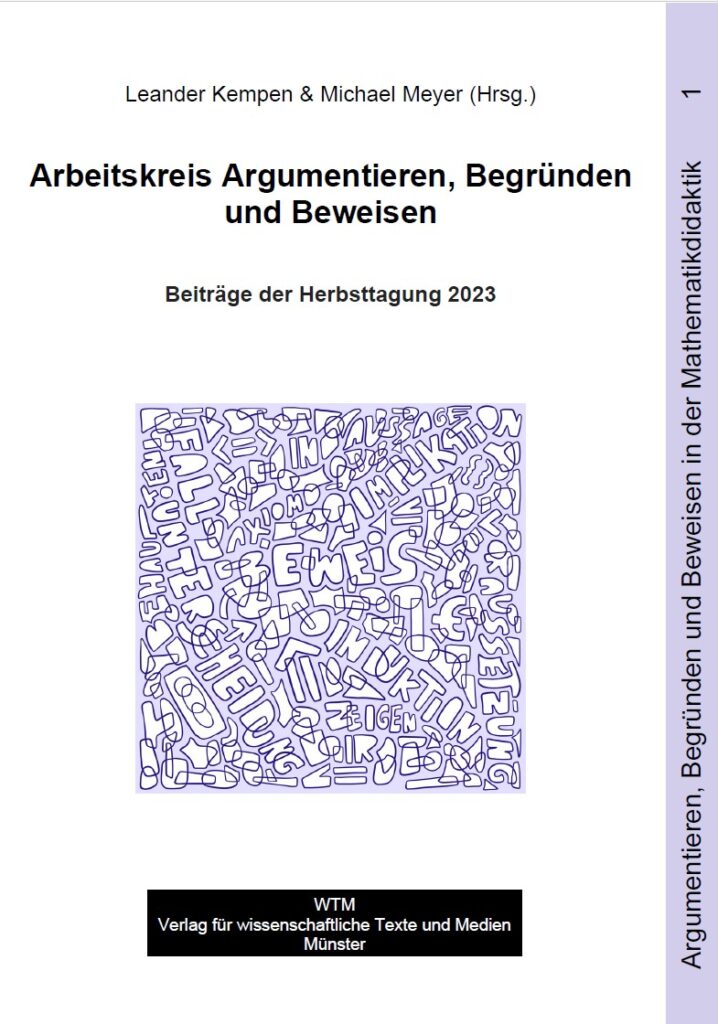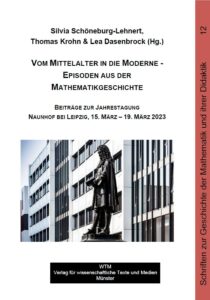 Beiträge zur Jahrestagung Naunhof bei Leipzig, 15. März – 19. März 2023
Beiträge zur Jahrestagung Naunhof bei Leipzig, 15. März – 19. März 2023
Band 12 der Reihe Schriften zur Geschichte der Mathematik und ihrer Didaktik
Münster: WTM-Verlag 2024
Ca. 220 S., DIN A5
978-3-95987-257-7 Print 37,90 €
978-3-95987-258-4 E-Book Open Access Buch herunterladen
https://doi.org/10.37626/GA9783959872584.0
Für Bestellungen bei edition-buchshop hier klicken
Abstract
“Vom Mittelalter in die Moderne” – der Titel des vorliegenden Tagungsbandes verspricht einen großen Bogen zu spannen. Ganz offensichtlich kann es sich dabei – selbst wenn man sich auf Mathematikgeschichte beschränkt – lediglich um einen episodenhaften Ausschnitt handeln. Gerade dieser Ansatz ermöglicht es, an verschiedenen Beispielen zu zeigen, wie facettenreich Geschichte der Mathematik ist und betrieben wird.
Ein besonderer Reiz dieses Themenfeldes besteht darin, dass sich hier mathematisch-naturwissenschaftliches Interesse mit geisteswissenschaftlicher Methode verbindet. Durch die Untersuchung der Mathematik unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen Kontextes der jeweiligen Zeit weitet sich der Blickwinkel und ein tieferes Verständnis von Methoden, Techniken und Konzepten wird möglich. Unter Einbeziehung der Möglichkeiten, die der mathematikgeschichtliche Ansatz für die unterrichtliche Praxis eröffnet, wird die gesellschaftliche Relevanz dieser Forschung weiter unterstrichen.
Aus diesen Gründen treffen sich die Mitglieder der DMV-Fachsektion „Mathematikgeschichte“ und des Arbeitskreises „Mathematikgeschichte und Unterricht“ der GDM im zweijährigen Turnus zu gemeinsamen Jahrestagungen. Traditionell wird auf diesen Jahrestagungen ein sehr integrativer Ansatz gewählt, der Forschenden, die sich von verschiedenen Seiten dem Gegenstand Mathematikgeschichte nähern, mannigfaltige Möglichkeiten zum sich gegenseitig befruchtenden Austausch bietet.
Zeugnis dieses Austausches gibt der vorliegende Tagungsband der Jahrestagung 2023, die vom 15. bis 19. März in Naunhof bei Leipzig von der Abteilung Didaktik der Mathematik der Universität Leipzig ausgerichtet wurde. Die Veränderungen und die Entwicklung grundlegender Algorithmen und Ideen der Mathematik, ihrer Institutionen und Persönlichkeiten als zentrale Themen dieser Tagung werden darin ebenso sichtbar wie der Wandel der Mathematik und die Möglichkeiten, die die Mathematikgeschichte dem Schulunterricht bietet.
BEITRÄGE
=====================================================
Jaques Sesiano: Betrachtung unendlicher Mengen im Mittelalter
Abstract
Unter den Betrachtungen einiger Mathematiker des 14. und anfänglichen 15. Jahrhunderts nahm die Frage der unendlichen Mengen, sowohl kontinuierlicher wie diskreter, eine besondere Stelle ein. Durch verständliche Überlegungen wurde gezeigt, wie aus einer einzigen unendlichen Menge eine beliebige Anzahl anderer unendlicher Mengen hergestellt werden könne. Weiter ließ ein nach Belieben wiederholtes Annäherungsverfahren für Quadrat- und Kubikwurzeln erkennen, wie zwischen zwei aufeinanderfolgenden natürlichen Zahlen eine unendliche Anzahl rationaler Brüche eingeschoben werden könne. Somit stellte sich die Frage, ob ein Unendliches kleiner als ein anderes Unendliches sein könnte.
Erste Seite: 1
Letzte Seite: 12
https://doi.org/10.37626/GA9783959872584.0.01
=====================================================
Rainer Gebhardt: Mischungsaufgaben in Coß 1 von Adam Ries
Abstract
Mischungsaufgaben begegnen uns im täglichen Leben. Dabei sollen mehrere Stoffe mit unterschiedlichen Eigenschaften (Größe, Preis, Qualität, prozentualer Gehalt, …) gemischt werden, um einen Stoff mit neuen Eigenschaften zu erhalten. Diese Aufgaben haben eine lange Tradition und werden in den Rechenbüchern der frühen Neuzeit mit der sogenannten „Regula alligationis“ gelöst. Im Manuskript der 1524 abgeschlossenen Coß 1, dem Teil 1 seiner Algebra-Handschrift, behandelt Adam Ries (1492–1559) ebenfalls Mischungsaufgaben. Dabei geht es im Besonderen um das Verschmelzen von Metallen, wie Gold und Silber, mit unterschiedlichen Feingehalten. Ries löst die Aufgaben mit Hilfe der „Regula alligationis“ und stellt diese Vorgehensweise der Lösung mit den Methoden der Coß gegenüber. Dabei wählt er die Formulierung: „nach der Underrichtung Algebre“ [Rie92, S.312]. Neben den Lösungen von Ries wird auch ein heutiger möglicher Lösungsweg angegeben.
Erste Seite: 13
Letzte Seite: 24
https://doi.org/10.37626/GA9783959872584.0.02
=====================================================
Lea Dasenbrock: Annäherung irrationaler Wurzelwerte – Das Verfahren des Johannes Volmars
Abstract
Der Wittenberger Mathematiker Johannes Volmar thematisiert in seiner mathematischen Sammelhandschrift die Berechnung irrationaler Wurzelwerte. In diesem Beitrag wird sein mathematisches und methodisches Vorgehen untersucht und mit bekannten Verfahren zu Beginn des 16. Jahrhunderts verglichen. Durch die Betrachtung einer geometrischen Interpretation Volmars wird ein Bezug zu den Sinustafeln aufgezeigt. Neben dieser Betrachtung wird auf den Zusammenhang zwischen der Auflösung quadratischer Gleichungen und der Irrationalität sowie eine Annäherung in Sexagesimalbrüchen eingegangen. Zum Abschluss wird die Einbeziehung eines praktischen Beispiels betrachtet.
Erste Seite: 25
Letzte Seite: 37
https://doi.org/10.37626/GA9783959872584.0.03
=====================================================
Silvia Schöneburg-Lehnert, Thomas Krohn: Organum mathematicum: Quadratwurzelziehen nach historischem Vorbild
Abstract
Das Organum mathematicum – ein mathematischer Schrein, der zum Entdecken und Erkunden mathematischer Inhalte aus dem 17. Jahrhundert einlädt – ist nicht nur aus mathematikhistorischer, sondern auch aus mathematikdidaktischer Perspektive von großem Interesse. Anhand von historischen Materialien aus dem Arithmetikfach des Organum mathematicum soll exemplarisch aufgezeigt werden, wie Mathematikgeschichte in den modernen Mathematikunterricht einbezogen werden kann: Quadratwurzelziehen ohne Taschenrechner? Im heutigen Mathematikunterricht kaum denkbar, und doch ist dieses Unterfangen ohne größeren Aufwand möglich. Dies hat nicht nur einen motivationalen Aspekt, sondern dient auch dem mathematischen Erkenntnisgewinn.
Erste Seite: 39
Letzte Seite: 49
https://doi.org/10.37626/GA9783959872584.0.04
=====================================================
Barbara Schmidt-Thieme: Tobias Beutel Arithmetica – ein Lehrwerk des späten 17. Jahrhunderts
Abstract
Tobias Beutel hinterließ eine umfangreiche Sammlung an Schriften zu verschiedenen Themen und für verschiedene Adressatenkreise. Während erstere sich schnell bestimmen lassen (Astronomie-Astrologie, Geometrie, Arithmetik, Landeskunde u.a.), bedarf es zur Bestimmung von Adressaten und tatsächlichen Nutzern, von intendiertem Zweck und tatsächlichen Nutzungsszenarien der Analyse der Werke sowie der vorhandenen Drucke. Am Beispiel der arithmetischen Werke soll dies in einer ersten Näherung vorgestellt werden.
Erste Seite: 51
Letzte Seite: 60
https://doi.org/10.37626/GA9783959872584.0.05
=====================================================
Tanja Hamann: Die Elementa Euclidis der Hildesheimer Jesuiten
Abstract
In der alten Bibliothek des ehemaligen Jesuitengymnasiums Josephinum in Hildesheim finden sich u. a. zwei Mathematikbücher, die um 1700 von den Hildesheimer Jesuiten selbst geschrieben wurden. Wir dürfen annehmen, dass diese für den Unterricht genutzt wurden und wir daher aus ihnen etwas über den mathematischen Unterricht bei den Jesuiten erfahren können. Der Schwerpunkt des Beitrags wird auf einer Analyse der Elementa Euclidis, einer an den Unterricht angepassten Ausgabe der euklidischen Elemente, liegen, in der im Zuge der Bearbeitung die Beweise weggelassen wurden. Es stellen sich u. a. die Fragen, welche möglichen Ziele des jesuitischen Unterrichts sich aus dem Werk ableiten lassen und wie sich das Buch in die Vorgaben für den Unterricht einordnen lässt.
Erste Seite: 61
Letzte Seite: 72
https://doi.org/10.37626/GA9783959872584.0.06
=====================================================
Toni Reimers: Wesentliche Schritte auf dem Weg zur Mathematik des Marktscheidewesens: Heron, Reinholdus, Weidler
Abstract
Die markscheiderische Lehr- und Lernliteratur wird bis zur Gründung der Bergakademie Freiberg von Praktikern dominiert, obgleich sie punktuell von Gelehrten fundiert wird. Im Beitrag wird anhand ausgewählter Probleme die Mathematisierung dieser – zwischen Geologie und Vermessungsingenieurwesen zu verortenden – Disziplin analysiert. Dabei stechen der antike Mechanicus Heron sowie die beiden Wittenberger Mathematiker Erasmus Reinholdus und Johann Friedrich Weidler besonders hervor.
Erste Seite: 73
Letzte Seite: 88
https://doi.org/10.37626/GA9783959872584.0.07
=====================================================
Elisabeth Rinner: Die Zerfällungsschemata der Regula discerptionum et triscerptionum universalis von Gottfried Wilhelm Leibniz
Abstract
Zur Herleitung einer Regel über Zerfällungen nutzt G. W. Leibniz in seinem Konzeptpapier Regula discerptionum et triscerptionum universalis in insgesamt drei Ansätzen tabellenartige Schemata als Bestandteil seiner Argumentation. Zwei der Schemata unterscheiden sich auf den ersten Blick nur unwesentlich voneinander. Sogar die formale Gestaltung mit Trennlinien stimmt großteils überein. Eine Analyse der Schemata und ihrer Einbettung in die Argumentation verdeutlicht jedoch, dass sich beide in ihrer Bedeutung wesentlich unterscheiden. In einem Ausblick werden Konsequenzen des Befunds zur Rolle der Schemata für eine Behandlung solcher Strukturelemente in Digitalen Editionen mathematischer Texte aufgezeigt.
Erste Seite: 89
Letzte Seite: 102
https://doi.org/10.37626/GA9783959872584.0.08
=====================================================
Christoph Kirfel: Geometrische Umkehrung der Resektenmethode von Leibniz
Abstract
In seinem Manuskript De quadratura arthmetica circuli ellipseos et hyperbolae von 1676 beschreibt Leibniz [Lei16, S. 33] die Resektenmethode zur Bestimmung von Flächen unter Kurven. Obwohl die Methode auf Tangenten aufbaut, ist sie nicht identisch mit dem Hauptsatz der Integral- und Differentialrechnung, folgt aber aus diesem als Spezialfall. Mit dieser Methode stellt Leibniz einen Zusammenhang zwischen der Fläche unter gegebenen Kurven und anderen Kurven, die oftmals einfacher zu bestimmen sind, her. So kann er Flächen unter vielen bekannten Kurven bestimmen. Nach einer Vorstellung der Resektenmethode wird in dem Beitrag zu deren geometrisch beschriebener Umkehrung, der sogenannten Fransenmethode, übergegangen. Diese stellt ebenfalls einen Zusammenhang zwischen Flächen unter verschiedenen Kurven her und es zeigt sich, dass sie gerade die Resektenmethode invertiert. Vor allem wird auf die geometrische Deutung der Fransenmethode Wert gelegt, die dadurch auch die Resektenmethode in neuem Licht erscheinen lässt. Einige Beispiele dienen zur Erläuterung der Methode.
Erste Seite: 103
Letzte Seite: 116
https://doi.org/10.37626/GA9783959872584.0.09
=====================================================
Siegmund Probst: Überlegungen zur Edition mathematischer Zeichnungen in den Handschriften von Leibniz
Abstract
Die Figuren, Abbildungen und Zeichnungen in den mathematischen Handschriften von Gottfried Wilhelm Leibniz bieten vielfältige mathematische, technische und philologische Problemstellungen für eine kritische Edition, die soweit wie möglich auf die Verwendung von Faksimiles verzichtet: Authentische Wiedergabe der Vorlage und Erstellung einer mathematisch korrekten Abbildung lassen sich nicht immer vereinen, flüchtige Skizzen erfordern manchmal weitgehende Interpretationen, um eine Visualisierung zu ermöglichen. Anhand einiger Beispiele aus der Praxis der Akademieausgabe der Sämtlichen Schriften und Briefe von Leibniz wird diese Problematik vorgestellt, wobei auch auf Zusammenhänge zwischen verschiedenen Fassungen von Zeichnungen mit der Genese des mathematischen Textes eingegangen wird.
Erste Seite: 117
Letzte Seite: 126
https://doi.org/10.37626/GA9783959872584.0.10
=====================================================
Wilhelm Sternemann: Zur frühesten Berechnung der Exponentialreihe durch Isaac Newton 1665
Abstract
Als 22-jähriger floh Isaac Newton 1665 vor der Pest auf den Hof seiner Mutter – ein Glücksfall für die Wissenschaft! In der kreativsten Lebensphase notierte er u. a. auch eine Rechnung zur unbekannten „Exponentialreihe“. Nikolaus Mercator legte 1668 erstmalig eine Logarithmusreihe zur Fläche unter der Hyperbel y=1/(x+1) vor. Newton hatte sie 1665 schon notiert, aber zusätzlich noch die Exponentialreihe. Zum Veröffentlichen gedrängt, legte Newton seinem Lehrer Isaac Barrow aus den mathematischen Notizen die druckreife Handschrift De Analysi [New69] vor, die dann Barrow wegen der vielen Innovationen in der Royal Society in London öffentlich auslegen ließ. Jakob Bernoulli und Leibniz haben sie dort gelesen. In diesem Beitrag wird daraus nur das unbequem zu lesende Blatt zur Berechnung der Exponentialreihe untersucht. Im Prinzip ist es für einen Grundkursschüler verstehbar.
Erste Seite: 127
Letzte Seite: 139
https://doi.org/10.37626/GA9783959872584.0.11
=====================================================
Alexander Odefey: „…kann man nicht mit mehr Verständniß Musik hören“ Carl Gustav Jacob Jacobi und die Musik
Abstract
Carl Gustav Jacob Jacobi (1804–1851) zählt unbestritten zu den herausragenden Mathematikern des 19. Jahrhunderts. Seine Arbeiten zur Theorie der elliptischen Funktionen, seine zahlentheoretischen Erkenntnisse, seine Untersuchungen zur Differentialgeometrie, zur Variationsrechnung, zu partiellen Differentialgleichungen und einer Vielzahl weiterer Gebiete haben die Entwicklung der Mathematik maßgeblich beeinflusst.
Weniger bekannt ist dagegen, dass Jacobi eine ausgeprägte Neigung zur Musik hatte und mit mehreren bedeutenden Komponisten bekannt oder sogar befreundet war. Der Beitrag beleuchtet unter anderem seine Beziehungen zu Felix Mendelssohn Bartholdy, Fanny Hensel, Franz Liszt sowie Robert und Clara Schumann.
Erste Seite: 141
Letzte Seite: 155
https://doi.org/10.37626/GA9783959872584.0.12
=====================================================
Nicola M. R. Oswald: Strukturierte Analyse eines sozial-mathematischen Netzwerks – Der Briefwechsel zwischen Hermann Minkowski, David Hilbert und Adolf Hurwitz
Abstract
In diesem Beitrag wird zunächst der Briefwechsel zwischen den Mathematikern Adolf Hurwitz (1859–1919), David Hilbert (1862–1943) und Hermann Minkowski (1864–1909) im Allgemeinen vorgestellt. Anschließend werden erste Ergebnisse einer strukturierten Analyse des Briefwechsels gebracht und anhand von zwei qualitativen Beispielen der kollaborative Austausch der drei Kollegen und Freunde in den Blick genommen. Anhand von ausgewählten Briefen rund um zwei Transzendenzbeweise der Eulerschen Zahl e von 1893 sowie durch Briefe und Postkarten mit Bezug auf die Rede, die Hilbert beim Internationalen Mathematikerkongress in Paris 1900 hielt und die später in ihrer gedruckten Version weltberühmt wurde, werden Charakteristika ihres Austausches herausgestellt. Insgesamt entsteht ein Bild von einer vielseitigen gegenseitigen Förderung und einem gemeinsamen wissenschaftlichen Diskurs, der einen Einblick in die zeitgenössische mathematische Community gewährt.
Erste Seite: 157
Letzte Seite: 174
https://doi.org/10.37626/GA9783959872584.0.13
=====================================================
Renate Tobies: Felix Klein und Geschichte der Mathematik im Unterricht
Abstract
Felix Klein (1849–1925) betrachtete Geschichte der Mathematik als einen grundlegenden Bestandteil der Allgemeinbildung von Lehramtskandidaten, damit sie eine „wissenschaftliche Unterrichtsmethode“ verwirklichen können. Seine „genetische Methode“ soll in die damalige Unterrichtsreform („Kleinsche“ Reform) eingebettet werden. Zugleich wird an einigen Beispielen demonstriert, welche mathematischen Erkenntnisse Felix Kleins Gegenstand des Unterrichts sein können.
Erste Seite: 175
Letzte Seite: 188
https://doi.org/10.37626/GA9783959872584.0.14
=====================================================
Peter Ullrich: Der Briefwechsel zwischen Friedrich Engel (1861–1941) und David Hilbert (1862–1943)
Abstract
Friedrich Engel und David Hilbert lernten einander während des Wintersemesters 1885/86 kennen, das der gerade promovierte Hilbert bei Felix Klein (1849–1925) in Leipzig verbrachte; Engel hingegen schloss damals bereits seine Habilitation ab. Zwischen den beiden bis auf genau vier Wochen gleichaltrigen jungen Herren entwickelte sich eine Freundschaft, und sie hielten den Kontakt auf schriftlichem Wege auch aufrecht, nachdem Hilbert zu einem Studienaufenthalt nach Paris gegangen war.
Der sich daraus entwickelnde Briefwechsel enthält zahlreiche Informationen aus den Anfängen der Karrieren der beiden Korrespondenzpartner: So wird Hilberts langanhaltendes Interesse an kontinuierlichen Transformationsgruppen dokumentiert sowie ein historisch motiviertes Interesse von Engel an algebraischen Invarianten. Ebenso findet sich ein Austausch zu den ersten Jahrestagungen der Deutschen Mathematiker-Vereinigung (DMV). Weiterhin belegt der Briefwechsel unter anderem den – von Klein vereitelten – Versuch Hilberts, die Liesche Geometrie nach Göttingen zu bringen durch eine Berufung von Engel auf ein dortiges Extraordinariat.
Erste Seite: 189
Letzte Seite: 201
https://doi.org/10.37626/GA9783959872584.0.15
=====================================================
Harald Gropp: De onbemindheid der wiskunde – Die Unbeliebtheit (von Teilen) der Mathematik
Abstract
Im folgenden Beitrag wird über einen Vortrag aus dem Jahre 1926 berichtet, also vor fast 100 Jahren, und auch über seine mögliche Relevanz für didaktische und pädagogische Fragestellungen. Dieser Vortrag von Johan Antonij Barrau (1873–1953) war dessen Rektoratsrede an der Rijksuniversiteit in Groningen mit dem Titel De onbemindheid der wiskunde. Barrau legt dar, dass viele Teile der Mathematik beim breiten Publikum eher unbeliebt sind, wohingegen gewisse Teile der Geometrie wie auch die Kombinatorik, endliche Geometrie oder die sogenannte Unterhaltungsmathematik beliebt sind und sich deshalb gut für „onderwijs“ eignen. Nach einem Aufenthalt in Niederländisch-Indien zwischen 1891 und 1898 war Barrau Lehrer und studierte in Amsterdam. Er schrieb seine „proefschrift“ (Dissertation) über Bijdragen tot de theorie der configuraties (Beiträge zur Theorie der Konfigurationen) im Jahre 1907. 1909 wurde er zum Professor berufen, zunächst in Delft und später in Groningen. 1928 erhielt er den Lehrstuhl für „meetkunde“ (Geometrie) in Utrecht, den er bis 1943 bzw. 1946 innehatte.
Erste Seite: 203
Letzte Seite: 208
https://doi.org/10.37626/GA9783959872584.0.16
=====================================================
Waltraud Voss: Einige frühe Promovenden der Dresdner Lehrerabteilung – Erasmus Hultzsch, Alfred Kneschke, Rudolf Wobser, Walter Thürmer – mit Karrieren als Industrieforscher, Hochschullehrer und Industrieller
Abstract
Bis 1945 erreichten an der TH Dresden etwa 1000 Studierende den Abschluss als Lehrer an höheren Schulen, fast 2000 studierten mindestens einige Semester in Dresden auf das höhere Schulamt der mathematisch-naturwissenschaftlichen Richtung. 68 von ihnen promovierten aufgrund einer mathematischen Dissertation, etliche weitere aufgrund einer mathematiknahen. Im Lexikon früher Promovenden der TU Dresden [VM19] sind alle zu finden. Hier sollen vier von ihnen – mit ganz unterschiedlichen Berufsverläufen – vorgestellt werden: Erasmus Hultzsch, Alfred Kneschke, Rudolf Wobser und Walter Thürmer. Hultzsch forschte erfolgreich bei „Carl Zeiss Jena“, Kneschke ist als angewandter Mathematiker und Hochschullehrer bekannt, Wobser baute seine eigene Firma auf, und Thürmer kam über Stationen im Familienbetrieb und als Politiker wieder zur Mathematik zurück.
Erste Seite: 209
Letzte Seite: 221
https://doi.org/10.37626/GA9783959872584.0.17