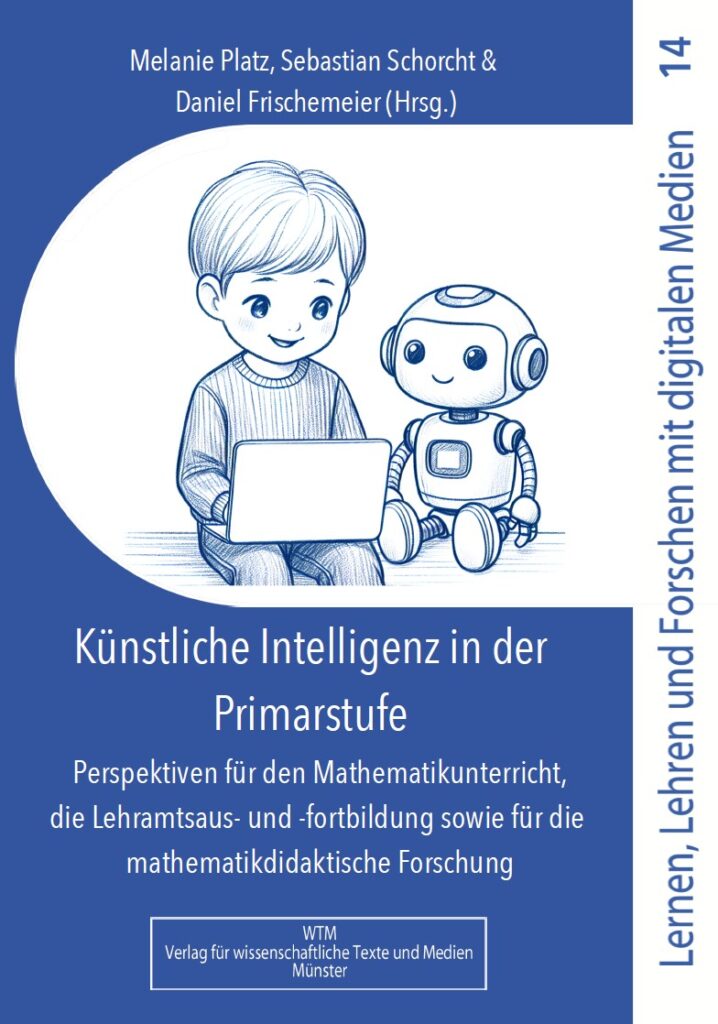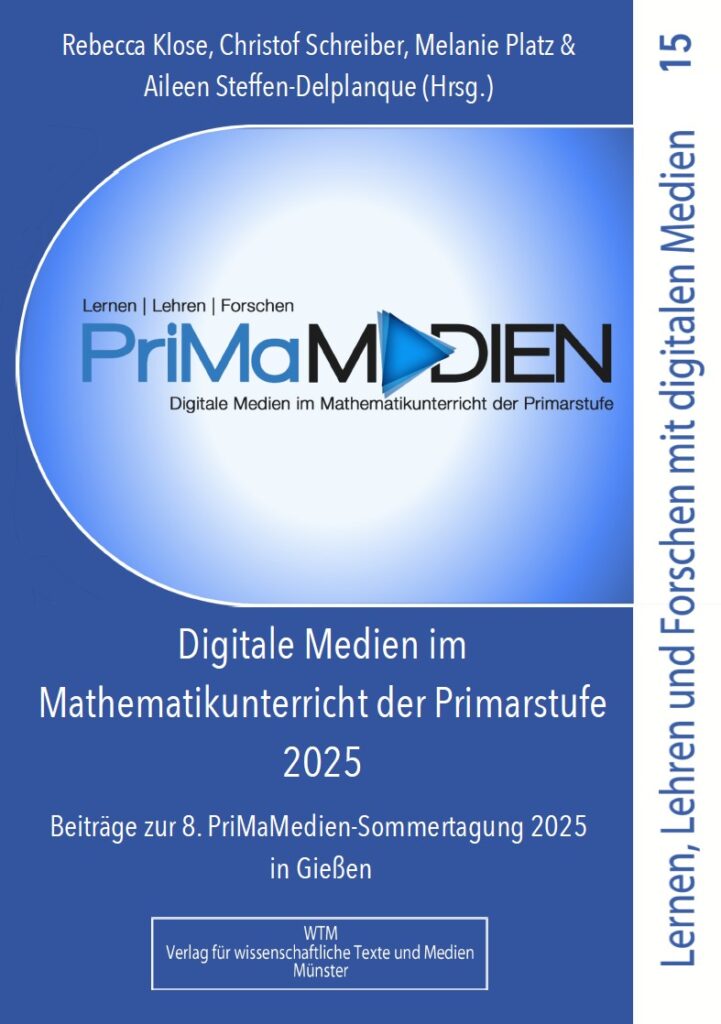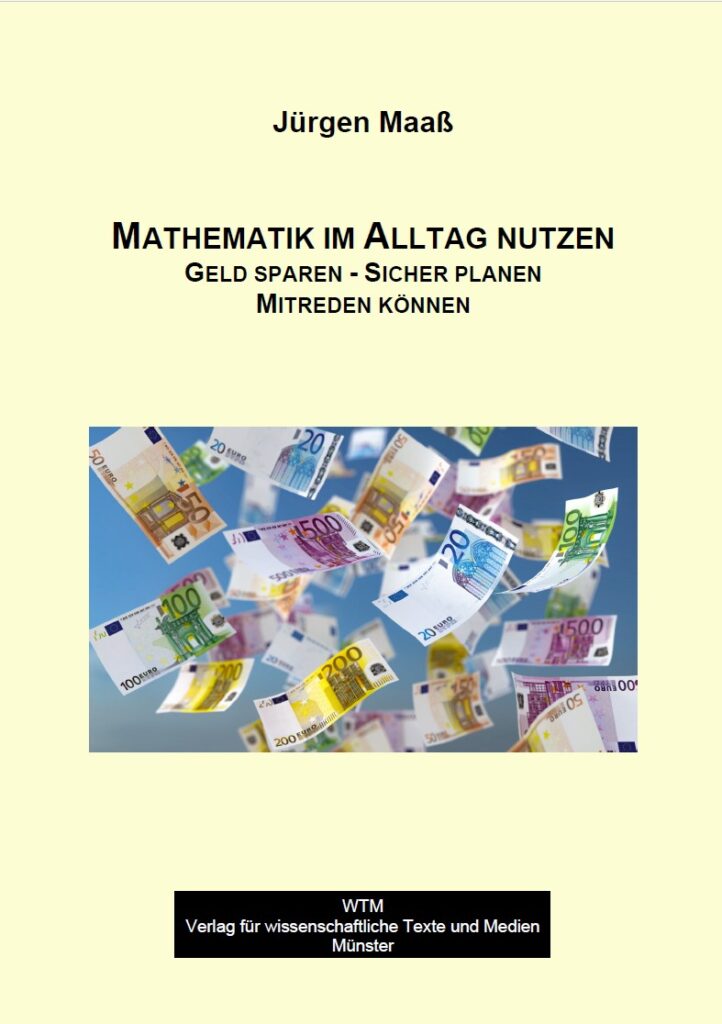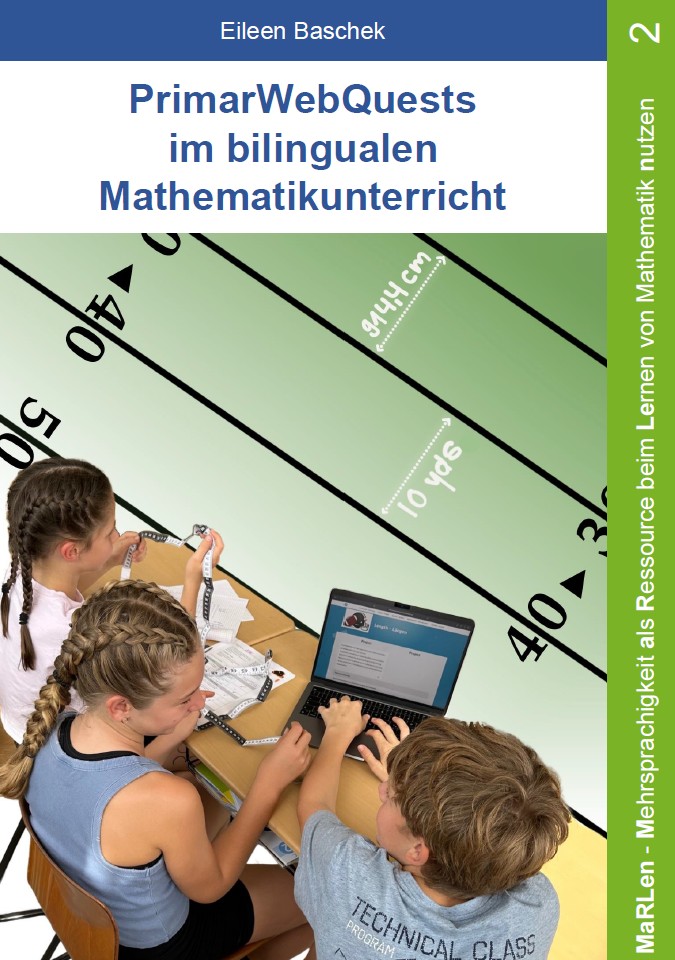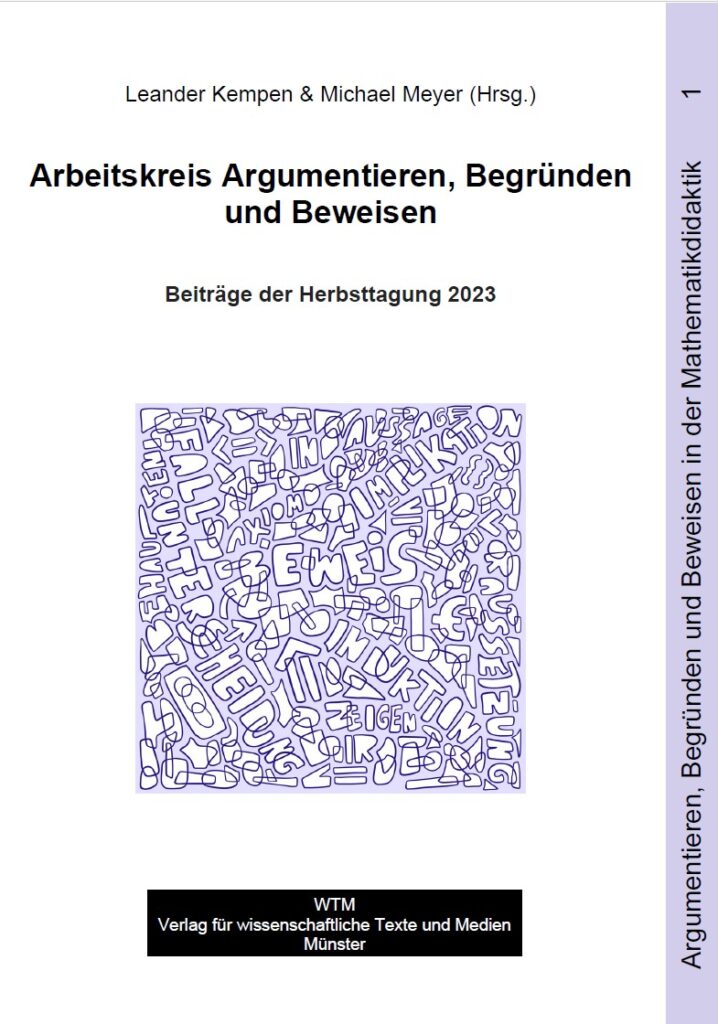Band 9 der Reihe Festschriften der Mathematikdidaktik
Münster 2024, ca. 175 S., davon viele farbig
978-3-95987-237-9 Print 34,90 €
978-3-95987-238-6 E-Book 31,90 €
https://doi.org/10.37626/GA9783959872386.0
Für Bestellungen bei edition-buchshop hier klicken
Die Kinder der Waschbären-Klasse konstatieren in ihren mathematischen Glückwünschen an „ihre“ Professorin Silke Ruwisch: „Eine Professorin wird 60. Das ist die Hälfte von 120 und das Doppelte von 30.“ Die Kinder fokussieren auf Zahlbeziehungen und schaffen damit eine hervorragende Ergänzung zu Silke Ruwischs anwendungsorientierten Forschungsschwerpunkten zum Sachrechnen und Modellieren in der Grundschule. Diese sind ebenso anerkannt wie ihr Engagement, theoriegeleitet Lernsettings für die Praxis zu entwickeln. In den Beiträgen der vorliegenden Festschrift greifen Wegbegleiter:innen, Kolleg:innen, Freund:innen und Doktorand:innen Ideen und Vorarbeiten ihrer zahlreichen Publikationen auf und liefern (fachdidaktische) Impulse für die kommenden Jahre der Zusammenarbeit.
Cathleen Heil hat von 2014 bis 2019 bei Silke Ruwisch promoviert und schätzt ihre Freude am kritischen Diskutieren neuer wie althergebrachter Konzepte zum mathematischen Lernen, ihren Sinn für Beobachtungen und Sprache sowie den humorvollen Institutsalltag mit ihr.
Dagmar Bönig hat Silke Ruwisch auf einer der ersten Tagungen des Arbeitskreises Grundschule in der GDM Anfang der 1990er Jahre kennengelernt. Sie schätzt insbesondere ihre Begeisterung für das mathematische Lernen von Kindern von der Forschung über die Lehre bis hinein in die Schulpraxis ebenso wie ihre absolute Zuverlässigkeit und ihren humorvollen Blick auf die Widrigkeiten auch des nicht-mathematischen Alltags.
BEITRÄGE
Daniela Aßmus & Torsten Fritzlar: Rechenoperationen experimentell erkunden
Erste Seite: 7
Letzte Seite: 16
Abstract
In einer Excel-Lernumgebung erhielten Kinder der dritten und vierten Klasse die Möglichkeit „neue“ Rechenoperationen zu erkunden und zu entschlüsseln, indem sie zwei selbstgewählte Zahlen eingaben und Excel nach einer vorprogrammierten Formel die Ergebniszahl anzeigte. In den Analysen von 14 Bearbeitungsprozessen konnten ganz unterschiedliche, (teilweise) mathematisch fundierte Vorgehensweisen rekonstruiert werden. Dabei zeigten sich typische Prozesse mathematischen Experimentierens wie das Generieren, Ordnen und Analysieren von Beispielen sowie das Aufstellen, Prüfen und Bewerten von Vermutungen. Die Erprobungen verdeutlichen, dass mathematisches Experimentieren beim Entschlüsseln neuer Rechenoperationen bereits im Grundschulalter möglich ist. Der Computer ist dabei ein leicht zu handhabendes Experimentiergerät, das die unbekannten Operationen bzw. entsprechende Beispiele ohne Rechen- und Zeitaufwand zur Verfügung stellt und zugleich protokolliert.
https://doi.org/10.37626/GA9783959872386.0.01
==============================================================
Dagmar Bönig, Bernadette Thöne und Kerstin Gerlach: Bilderbücher zur Unterstützung mathematischen Lernens einsetzen – vom Elternhaus bis in die Lehramtsausbildung
Erste Seite: 17
Letzte Seite: 28
Abstract
Bilderbücher sind vielfältig. Sie können Geschichten erzählen oder ganzseitige Bilder zusammenstellen, Text enthalten oder auf jegliches Wort verzichten, etc. Ihnen gemeinsam ist, dass sie einen bildlichen Zugang zur Literatur bieten und für viele Kinder selbstverständlicher Teil ihres Alltags sind.
Der vorliegende Beitrag beleuchtet am Beispiel des Bilderbuchs „Bus fahren“, wie das Potenzial dieses Mediums für die Unterstützung mathematischen Lernens genutzt werden kann. Während Familien sich auf individuellen Wegen mit dem Buch beschäftigen, wurden für Kita und Grundschule Möglichkeiten erprobt, in einer Verbindung von Bilderbuch und mathematischen Aktivitäten gezielt mathematische Betrachtungen, Überlegungen und Gespräche zu fördern. Ergänzend wird vorgestellt, welchen Wert die Entwicklung von Aktivitäten zu Bilderbüchern in der Lehramtsausbildung haben können. Vor diesem Hintergrund schließt der Beitrag mit einer Liste von Kriterien, die bei der Auswahl von mathematikhaltigen Bilderbüchern helfen können.
https://doi.org/10.37626/GA9783959872386.0.02
==============================================================
Michael Gaidoschik: Umwandeln im metrischen System: Argumente und Ideen für eine systematisch(er)e Behandlung schon in der Grundschule
Erste Seite: 29
Letzte Seite: 41
Abstract
Das Umwandeln von Größenangaben – von kleineren in größere Einheiten und umgekehrt, von „mehrnamigen“ Angaben wie 3 kg 50 g in „einnamige“ wie 3050 g oder 3,05 kg … – bereitet vielen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Schwierigkeiten. Das liegt zum einen an oft unzureichenden Grundvorstellungen zum Umwandeln, zum anderen daran, dass das metrische System der Maßeinheiten häufig nicht als das erfasst wird, was es ist: die geniale Erfindung französischer Mathematiker der Revolutionszeit, die das Messen und Umwandeln durch durchgehende Anbindung von Maßeinheiten ans Dezimalsystem vereinfachen wollten. Nicht alle diese Einheiten haben sich bis heute im Alltag durchgesetzt. Im Beitrag wird das ursprüngliche System erläutert und dafür argumentiert, es bereits im Mathematikunterricht der Grundschule in seiner vollständigen Form zum Thema zu machen. Der Beitrag stellt dazu einige konkrete Vorschläge zur Diskussion.
https://doi.org/10.37626/GA9783959872386.0.03
==============================================================
Maike Hagena & Hedwig Gasteiger: „Obst aus aller Welt“ – Mathematisches Lernen im Sachunterricht
Erste Seite: 43
Letzte Seite: 58
Abstract
Die Empfehlungen zur „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ sehen vor, dass Schüler:innen im Rahmen schulischen Lernens Wissen und Handlungsmöglichkeiten für die Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft entwickeln sollen. Wie diese Empfehlungen im Sachunterricht der Grundschule unter Rückgriff auf mathematische Kompetenzen umgesetzt werden können, wird im Rahmen dieses Beitrags konkretisiert. Dazu wird eine Lernumgebung vorgestellt, die Schüler:innen motiviert, sich mit der Ausgestaltung eines nachhaltigen Konsumverhaltens auseinanderzusetzen. So werden die Schüler:innen im Rahmen der Bearbeitung der Lernumgebung dazu angeregt, die Länge der Transportstrecken beim Lebensmitteltransport mathematisch zu modellieren und vor dem Hintergrund des globalen CO2-Ausstoßes kritisch zu reflektieren. Die Lernumgebung wurde im Sachunterricht einer 4. Klasse erprobt und stellt ein Beispiel für den Einsatz mathematischer Kompetenzen bei der Auseinandersetzung mit lebensweltlichen Sachsituationen dar.
https://doi.org/10.37626/GA9783959872386.0.04
==============================================================
Friederike Heinz & Katja Lengnink: Gut geschätzt ist halb gewonnen – Schätzen und Zählen beim Spielen mit dem „Mondsteinspender“
Erste Seite: 59
Letzte Seite: 69
Abstract
Das Schätzen als ungefähres Ermitteln einer Größe oder Anzahl spielt bei vielen Anwendungen von Mathematik eine wichtige Rolle, es sollte daher auch verstärkt im Unterricht eingeübt werden. Für ein fundiertes Schätzen müssen Kinder Stützpunktvorstellungen aufbauen, die beim Schätzen neuer Größen oder Anzahlen für einen Vergleich herangezogen werden können. Im Beitrag wird am Spielen mit dem „Mondsteinspender“ im Rahmen des von Friederike Heinz (2018) entwickelten Spiels „Galaktische Zahlen“ gezeigt, wie Schätzprozesse spielend in den Unterricht der Primarstufe integriert werden können und wie diese zum Zahlverständnis beitragen. Dafür werden die Schätzergebnisse und Zählprozesse von Kindern der Jahrgangsstufe 3 beim Spielen des Spiels „Galaktische Zahlen“ verglichen und in Bezug auf die dort sichtbaren Kompetenzen analysiert. Überraschend gibt es Kinder, die gut Schätzen aber nicht gut zählen können, und auch andersherum.
https://doi.org/10.37626/GA9783959872386.0.05
==============================================================
Jessica Hoth & Aiso Heinze: Welche Strategien verwenden Grundschulkinder beim Schätzen von Längen? Eine Machbarkeitsstudie auf Basis von Eyetracking-Analysen
Erste Seite: 71
Letzte Seite: 81
Abstract
Beim Schätzen von Längen kann die Wahl einer geeigneten Schätzstrategie einen wichtigen Beitrag zum erfolgreichen Schätzprozess ebenso wie -ergebnis leisten. Vor diesem Hintergrund ist die Förderung ebenso wie Erfassung der Schätzstrategien von Lernenden (auch in der Grundschule) ein wichtiger Bestandteil mathematikdidaktischer Arbeit und Forschung. Um die Strategien der Kinder möglichst genau zu erfassen, wird im vorliegenden Beitrag das Eyetracking als mögliche Erhebungsmethode evaluiert, indem die Blickbewegungsdaten in Kombination mit dem nachträglichen lauten Denken der Kinder analysiert werden. Zehn Kinder aus der dritten und vierten Klasse haben hierfür zunächst die Länge von 16 Objekten geschätzt, wobei ihre Blickbewegungen bei der Schätzung erfasst wurden. Anschließend wurden die Kinder gebeten, ihr Vorgehen zu verbalisieren. Die Kombination der beiden Datenarten zeigt, dass das Eyetracking nützliche Informationen für die Strategiewahl der Kinder liefern kann.
https://doi.org/10.37626/GA9783959872386.0.06
==============================================================
Marianne Nolte & Benjamin Rott: Ist Begabtenförderung noch zeitgemäß? Eine Diskussion häufig genannter Argumente
Erste Seite: 83
Letzte Seite: 93
Abstract
Zum Thema besondere Begabung bzw. besondere mathematische Begabung sind nach wie vor verschiedene Mythen und unterschiedliche Positionen im Umlauf. Im Artikel diskutieren wir einige Fragen, die mit einer Förderung von Begabungen verbunden sind. Wir zeigen auf, dass eine Förderung sowohl im schulischen als auch im außerschulischen Umfeld sinnvoll ist und argumentieren gegen eine einseitige Sichtweise bezüglich der psychischen Verfassung von besonders begabten Kindern und Jugendlichen.
https://doi.org/10.37626/GA9783959872386.0.07
==============================================================
Roland Rink & Daniel Walter: Das Verstehen und Bearbeiten problemhaltiger Sachaufgaben digital unterstützen
Erste Seite: 95
Letzte Seite: 105
Abstract
Das Verstehen sowie die Bearbeitung problemhaltiger Sachaufgaben sind oftmals durch vielfältige beobachtbare Schwierigkeiten bei Lernenden begleitet. Digitale Medien bieten bislang nur wenige Möglichkeiten, um Lernende zu unterstützen, was vorrangig durch eine starke Kalkülorientierung statt einem passgenauen Fokus auf Verständnis begründet werden kann. Im Beitrag wird daher ein digital gestütztes Konzept vorgestellt, das Lernende durch den Einsatz hybrider Arbeitsblätter, das bewährte analoge und neue digitale Unterstützungsmaßnahmen verwebt, unterstützen kann. Auf die Darlegung des Konzepts folgt die Vorstellung von Vorgehensweisen während der Bearbeitung der hybriden Arbeitsblätter sowie daraus gezogener Konsequenzen zur Überarbeitung des Konzepts.
https://doi.org/10.37626/GA9783959872386.0.08
==============================================================
Elisabeth Rathgeb-Schnierer & Charlotte Rechtsteiner: Ein Sachkontext zur Förderung vielfältiger Teilkompetenzen
Erste Seite: 107
Letzte Seite: 116
Abstract
Sachrechnen erfordert die fortwährende Verbindung der Sachbeschreibung und der mathematischen Beschreibung. Beim Lösen von Sachaufgaben müssen Kinder nicht nur Übersetzungs- und Strukturierungsprozesse zwischen diesen beiden Erfahrungswelten beherrschen, sondern auch innerhalb der Beschreibungsebenen vollziehen. Im Beitrag werden aus diesen vielschichtigen Anforderungen vier grundlegende Teilkompetenzen abgeleitet, über die Kinder beim Bearbeiten einer Sachaufgabe verfügen müssen. Wesentliches Ziel des Unterrichts ist es, diese Teilkompetenzen auf verschiedenen Anforderungsniveaus systematisch zu fördern. Anhand des Beispiels „Zucker in Lebensmitteln“ wird dargelegt, wie ein Sachkontext durch unterschiedliche Schwerpunktsetzungen verschiedene Übersetzungsprozesse adressiert und die damit verbundenen Teilkompetenzen fördert. Die vorgestellten Ideen zu zentralen Teilkompetenzen des Sachrechnens wie auch die individuellen Schüler:innenlösungen des Beispiels laden zur Diskussion ein.
https://doi.org/10.37626/GA9783959872386.0.09
==============================================================
Sabrina Roos & Marcus Nührenbörger: Mathematische Gespräche und kooperatives Arbeiten im inklusiven Mathematikunterricht
Erste Seite: 117
Letzte Seite: 132
Abstract
Der Beitrag befasst sich mit den Chancen, die kooperative Arbeitsformen für das Gemeinsame Lernen in inklusiven Lerngruppen bieten. Es wird gezeigt, wie Kinder unterschiedlichster Begabungsprofile an einer für alle gleichen Kernaufgabe differenziert arbeiten, in mathematische Gespräche eintauchen und gemeinsam zu einem Ergebnis kommen. Dass dabei der Anspruch an die gestellten Aufgaben nicht verloren geht, wird ebenso deutlich, wie die individuellen Leistungen, die jedes Kind in den dargestellten Lernsettings zu zeigen vermag. Dabei stehen einerseits die kooperativen Methoden des Table Sets und des Mindmaps mit Kugellager und die damit verbundenen Differenzierungsmöglichkeiten im Fokus, andererseits wird auch ein Blick auf einen veränderten Umgang mit Fehlern geworfen. Auch die Rolle der Lehrkraft wird hier thematisiert und aufgezeigt, wie diese sowohl die entstehenden Kinderprodukte als auch ihre Beobachtungen für die Leistungsbewertung und -rückmeldung nutzen kann.
https://doi.org/10.37626/GA9783959872386.0.10
==============================================================
Hans-Georg Weigand: Symmetrie – Zur Entwicklung eines fundamentalen Begriffs am Übergang von der Grundschule zur Sekundarstufe I
Erste Seite: 133
Letzte Seite: 143
Die Entwicklung des Symmetriebegriffs zieht sich über den gesamten Geometrielehrgang hin, erfolgt also langfristig. Für die Grundschule haben Schmid u. Rwisch (2016) ein gestuftes Entwicklungsmodell entwickelt, das im Rahmen dieses Artikels für die Sekundarstufe I fortgesetzt wird. Viele der in der Grundschule behandelten Methoden zum Arbeiten mit Symmetrien, wie etwa Falten und Schneiden können in der Sekundarstufe I fortgeführt werden. Darüber hinaus lassen auch digitale Medien sinnvoll einsetzen. Dynamische Darstellungen können zum Aufbau von flexiblen Vorstellungen über Achsenspiegelung, Drehung und Verschiebung beitragen. Digitale Darstellung liefern dann die Möglichkeit der Variabilität der Objekte und das Darstellen der engen Beziehung zwischen Achsenspiegelung und Achsensymmetrie. Schließlich lassen sich Erfahrungen mit einem Spiegel sowie mit der Achsensymmetrie auf die Ebenensymmetrie übertragen und deren Eigenschaften mit Hilfe eines 3D-Programms experimentell erkunden.
https://doi.org/10.37626/GA9783959872386.0.11
==============================================================
Farina Weiher & Cathleen Heil: Authentisch und vielfältig – Zum Schätzen von Längen in verschieden „großen“ Schätzsituationen
Erste Seite: 145
Letzte Seite: 156
Abstract
Obgleich das Schätzen von Längen von hoher lebenspraktischer Bedeutung ist, wird der Förderung der entsprechenden kognitiven Fähigkeiten im Schulalltag noch zu wenig Bedeutung zugemessen und eher kleindimensionale Settings adressiert. Im Alltag müssen Kinder jedoch auch die Höhe viel größerer Objekte und Distanzen im sie umgebenden Realraum sicher schätzen. Um theoretisch fundiert darzulegen, wie eine solche Vielfalt verschieden „großer“ Schatzsituationen konzeptioniert werden könnte, wird in diesem Beitrag Schätzen durch die „Raumvorstellungsbrille“ betrachtet. Ausgehend von einer kognitionspsychologischen Klassifizierung, die räumliches Denken in verschieden großen Aufgabenräumen differenziert, liefert der Beitrag einen darauf aufbauenden Vorschlag für verschieden große Schätzsituationen. Die jeweiligen Beispiele, die eine Fülle anregender Unterrichtsbeispiele zeigen sowie eine Betrachtung konzeptioneller Grenzfälle und besonderer Schätzsituationen laden zur Diskussion ein.
https://doi.org/10.37626/GA9783959872386.0.12
==============================================================
Swantje Weinhold: Was ist der Unterschied zwischen Mathe und Deutsch? – Vorstellungen und Vorlieben von Grundschulkindern
Erste Seite: 157
Letzte Seite: 172
Abstract
In den beiden zentralen Fächern der Grundschule, Deutsch und Mathematik könnten die Zugänge zur Beschreibung des Alltags, abstrakt-symbolisch vs. konkret-verbal, unterschiedlicher nicht sein – verbleibt man lediglich auf der inhaltlichen Sicht auf das jeweilige Fach. Wie aber sehen Lerner:innen die beiden Fächer? Was formulieren sie über die vermeintlich offensichtlichen Unterschiede? Hier, am Beginn der schulischen Lernprozesse, ist die Frage besonders spannend und die Antworten lassen sich keineswegs einfach oder eindeutig antizipieren. Das zeigt sich im Rahmen einer Interviewstudie mit 48 Kindern aus Klasse 1 bis 4, die im Beitrag dargestellt wird. Die Befunde der inhaltsanalytischen Untersuchung zeigen, wie sehr das Lerner:innenselbstkonzept die Antworten bestimmt. Deutlich werden Ansatzpunkte, um als Lehrkraft den eigenen Blick auf die beiden Fächer zu reflektieren und, um mit den Lerner:innen im Unterricht gemeinsam an ihre Perspektiven anschließen zu können.