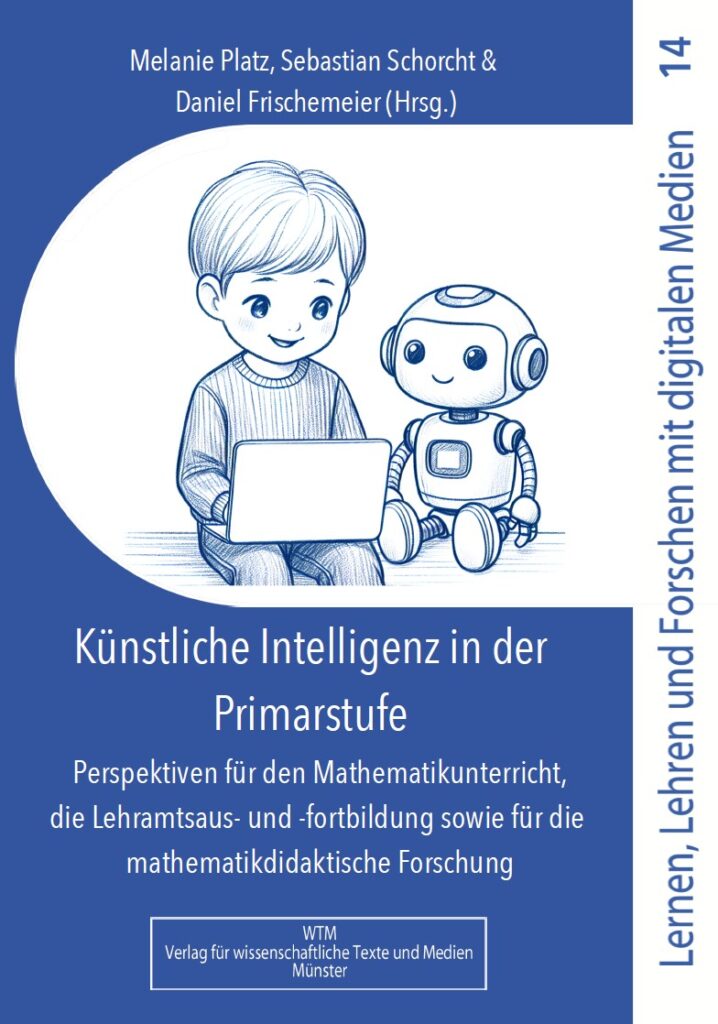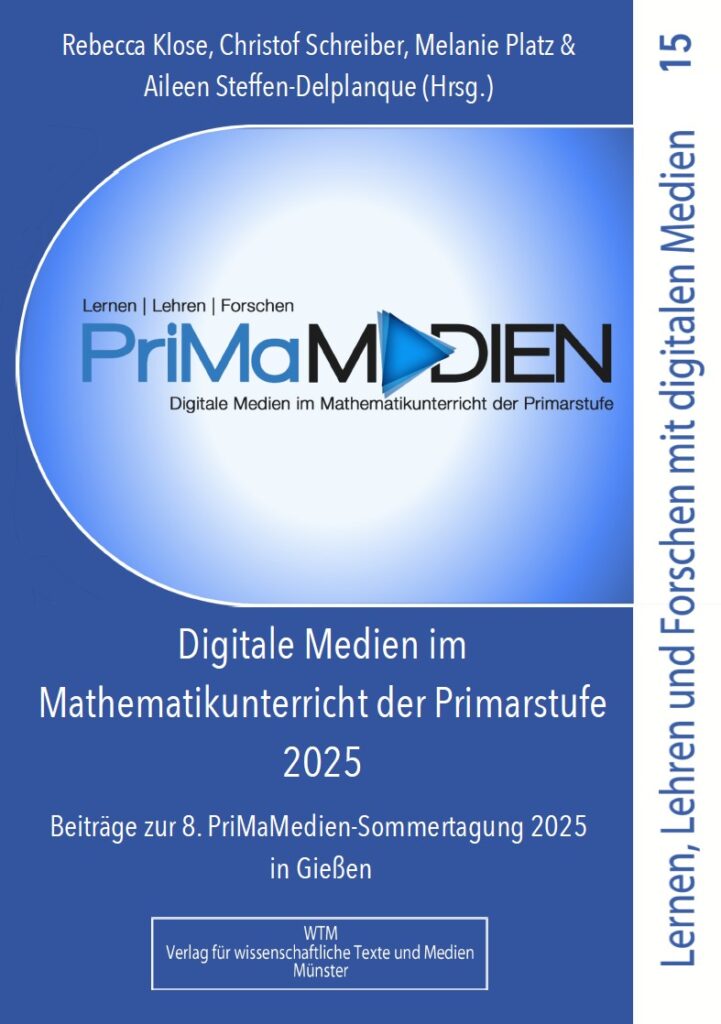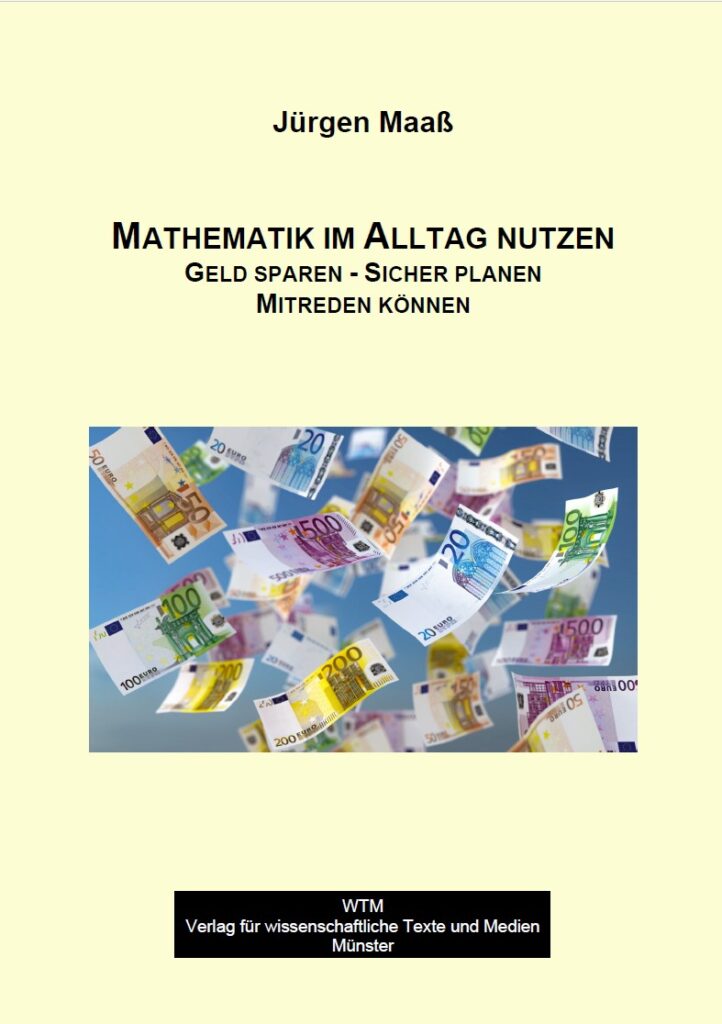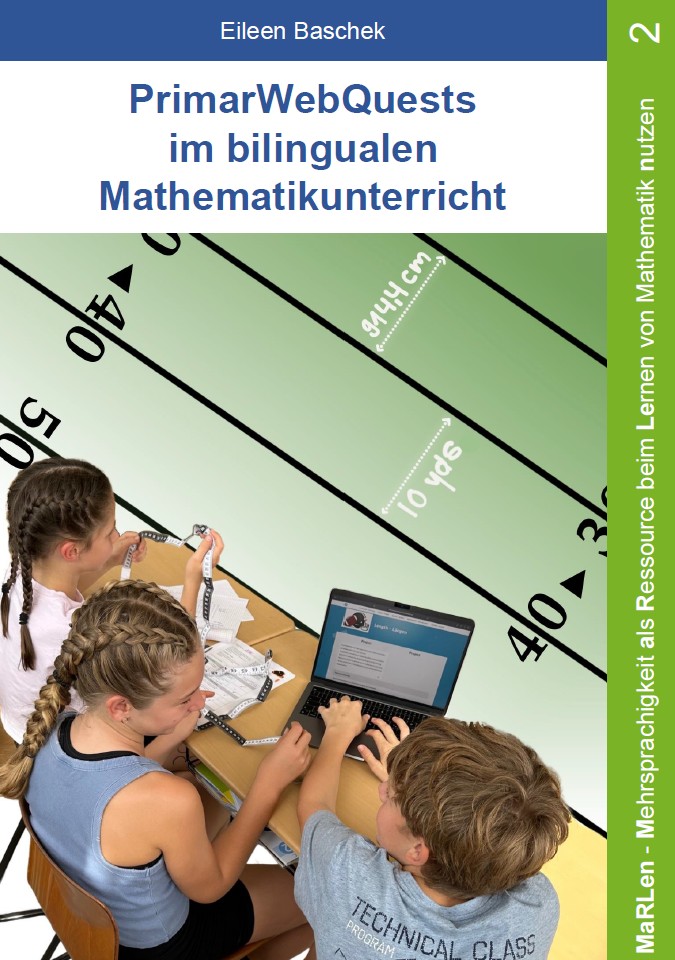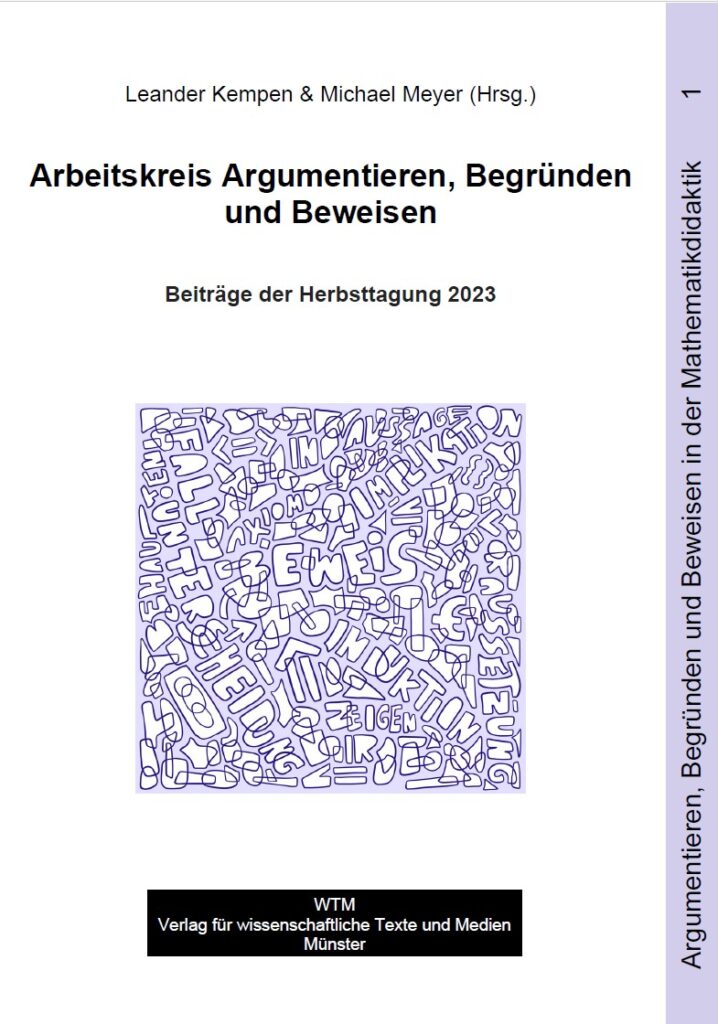Eine mathematisch-didaktische Festschrift zur Verabschiedung von Prof. Dr. Frank Heinrich in den Ruhestand
Eine mathematisch-didaktische Festschrift zur Verabschiedung von Prof. Dr. Frank Heinrich in den Ruhestand
Band 8 der Reihe Festschriften der Mathematikdidaktik
Münster 2023, ca. 350 S., davon viele farbig
978-3-95987-181-5 Print 46,20 €
978-3-95987-182-2 E-Book 42,90 €
https://doi.org/10.37626/GA9783959871822.0
Für Bestellungen bei edition-buchshop hier klicken
Im Sommer 2021 ging Prof. Dr. habil. Frank Heinrich nach seiner wissenschaftlichen Tätigkeit an den Universitäten in Jena, Bamberg und Braunschweig in den wohlverdienten Ruhestand. Seit der Promotion 1992 gehören das mathematische Problemlösen auch unter Berücksichtigung psychologischer Aspekte, die Weiterentwicklung des Geometrieunterrichts in allen Schulstufen sowie die Förderung interessierter und leistungsstarker Schülerinnen und Schüler zu seinen besonderen Arbeitsschwerpunkten. Dies spiegelt sich auch in den Beiträgen dieser Festschrift wider, mit denen sich die Autorinnen und Autoren für die langjährige fruchtbare Zusammenarbeit bedanken
BEITRÄGE
András Ambrus: Einige Grundfragen des Unterrichts mit Fokus auf mathematischem Problemlösenlernen
Erste Seite: 15
Letzte Seite: 25
Abstract
In diesem Artikel werde ich über einige methodische Schwerpunkte des Unterrichts mit Fokus auf mathematischem Problemlösen schreiben, basierend auf meiner 55-jährigen Erfahrungen im Mathematikunterricht und in der Mathematik-Lehrerausbildung. Vier Themen werde ich diskutieren: (I) den Prozess des Problemlösenlernens im allgemeinen Unterricht, (II) schemabasierten Mathematikunterricht, (III) kognitive Belastung, (IV). Lehrervorstellungen.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871822.0.01
====================================================
Daniela Aßmus, Frank Förster: „Die Hälfte vom Rest und noch eine“ – Aufgabenvariationen zum Rückwärtsarbeiten
Erste Seite: 27
Letzte Seite: 39
Abstract
In diesem Beitrag werden problemhaltige Textaufgaben zum „Rückwärtsrechnen“ betrachtet und sprachlich hinsichtlich verschiedener Aspekte variiert. Beim Einsatz im Rahmen von Auswahlverfahren für Begabtenförderungsgruppen der Klassenstufen 3 und 4 zeigten sich zwischen den verschiedenen Versionen
große Unterschiede in den Lösungsraten, sodass ein Einfluss der (sprachlichen) Aufgabengestaltung auf erfolgreiches Rückwärtsrechnen im Grundschulalter angenommen werden kann.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871822.0.02
====================================================
Besim Enes Bicak, Mathias Hattermann, Clara Hübner: Einsatz digitaler Medien im Unterricht vor und während der Coronapandemie
Erste Seite: 41
Letzte Seite: 58
Abstract
Das Thema Digitalisierung und die Verwendung digitaler Medien in Schule und Unterricht erfährt innerhalb der letzten Jahre ein stetig steigendes Interesse in Forschung und Politik. Im Zuge der Coronapandemie haben diese Themenfelder auch in der allgemeinen öffentlichen Wahrnehmung nochmals an Bedeutung gewonnen. Dieser Beitrag präsentiert eine Fragebogenstudie, in der Lehrkräfte (n = 151) aus der Region Braunschweig über ihr Nutzungsverhalten digitaler Medien befragt wurden. So kann ein Überblick über die Nutzung bestimmter Hard- und Software, die Einstellung der Lehrkräfte zur Verwendung digitaler Medien und das digitale Selbstkonzept der befragten Lehrkräfte gegeben werden. Es ist zu konstatieren, dass die befragten Lehrkräfte eine sehr positive Einstellung zu digitalen Medien besitzen und sich ihr Hard- und Softwarerepertoire durch die Coronapandemie erweiterte. Für die jüngeren Lehrkräfte zeigt sich darüber hinaus, dass die Thematisierung der Nutzung von digitalen Medien in Studium und Referendariat erfolgt, aber weiter ausgebaut werden sollte.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871822.0.03
====================================================
Dirk Brockmann-Behnsen: Titel des Beitrags: Large N and large T – Vergleich zweier Heurismentrainings
Erste Seite: 59
Letzte Seite: 69
Abstract
In diesem Beitrag werden verschiedene Langzeit-Trainings zum Erlernen von Heurismen und deren zentrale Ergebnisse insbesondere in Hinblick auf
Wirksamkeit miteinander verglichen. Im Fokus stehen dabei die Studie von Heinrich aus den Jahren 1989/1990, die sich durch eine vergleichsweise große Zahl an Teilnehmenden (N = 323) auszeichnet sowie jene von Gawlick und Brockmann-Behnsen aus den Jahren 2011 bis 2013 mit einer vergleichsweise langen kontinuierlichen Interventionsdauer (T = 18 Monate).
https://doi.org/10.37626/GA9783959871822.0.04
====================================================
Stefan Deschauer: Die Aufgaben zur Regula Inventionis im Rechenbuch des Johannes Widmann von Eger
Erste Seite: 71
Letzte Seite: 78
Abstract
Die Regula Inventionis („Regel des Findens“) hat bei den Autoren des 16. und 17. Jahrhunderts durchweg eine spezielle Bedeutung: Es geht um die Umkehrung von „Standardaufgaben“, die mit dem Dreisatz gelöst werden können, und zwar unter Austausch von gegebener und gesuchter Größe. Dabei wird häufig nach einer metrologischen Beziehung gesucht. Solche Aufgaben werden anspruchsvoller, wenn sie auf ein unterbestimmtes lineares Problem führen und weitere (zahlentheoretische) Überlegungen eine Rolle spielen, wie hier bei Widmann.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871822.0.05
====================================================
Dietrich Dörner: Problemlösen und Künstliche Intelligenz
Erste Seite: 79
Letzte Seite: 97
Abstract
In diesem Aufsatz will ich untersuchen, welche Hilfe die künstliche Intelligenz beim Problemlösen leisten kann oder leisten könnte. Oder auch nicht leisten kann, soweit ich die künstliche Intelligenz überschaue.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871822.0.06
====================================================
Michael Fothe: Beweisen anhand von Bildern – Zum 125. Geburtstag von Jean Piaget
Erste Seite: 99
Letzte Seite: 106
Abstract
Zwei Erkenntnisse von Jean Piaget eignen sich als Ausgangspunkt für Überlegungen zum mathematischen Argumentieren, bei dem Bilder eine zentrale Rolle spielen. Das Potenzial von Bildern ist außergewöhnlich, wofür sich überzeugende Beispiele angeben lassen.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871822.0.07
====================================================
Torsten Fritzlar, Nadja Karpinski-Siebold: Titel des Beitrags: Sechsmal so viele Hühner wie Gänse – Erkundungen zum Umkehrfehler
Erste Seite: 107
Letzte Seite: 119
Abstract
Das frühe algebraische Denken ist ein sich dynamisch entwickelndes und auch im Hinblick auf die Weiterentwicklung des Mathematikunterrichts vielversprechendes Forschungsgebiet. In diesen Kontext ist eine Interviewstudie mit Viert-, Fünft- und Sechstklässler*innen zum Umkehrfehler einzuordnen, die interessante Einblicke in Vorgehensweisen der Schüler*innen ermöglicht. Ergebnisse deuten trotz hoher Ansprüchlichkeit auf ein relativ seltenes Auftreten dieses Fehlertyps hin, was auch mit der Nutzung von Beispiellösungen in Zusammenhang stehen könnte.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871822.0.08
====================================================
Thomas Gawlick: Titel des Beitrags: Historisches und Empirisches zu einer Aufgabe bei Heinrich
Erste Seite: 121
Letzte Seite: 139
Abstract
Heinrich untersuchte in seiner Habilitationsschrift den Wechsel von Lösungsanläufen beim Problemlösen. Die zugrunde gelegte Aufgabe der indischen Mathematik-Olympiade birgt einen heuristisch reichen historischen Kontext, der zunächst ausgeleuchtet wird. Dann wird Heinrichs Fragestellung weitergedacht bezüglich der Erfolgsträchtigkeit des Wechsels der Arbeitsrichtung.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871822.0.09
====================================================
Klaus Hasemann: Titel des Beitrags: Denkaufgaben in der Grundschule
Erste Seite: 141
Letzte Seite: 149
Abstract
Wie können Grundschulkinder an mathematisches Denken herangeführt werden, und wie lässt sich dieses Denken fördern? Vorgestellt und interpretiert wird das Verhalten von Kindern, denen im Rahmen einer Förderung mathematisch besonders interessierter Grundschulkinder Sequenzen herausfordernder Aufgaben vorgelegt wurden. Anhand der Beispiele wird die These diskutiert, dass das Denken dieser Kinder vor allem durch Formen der Darstellung gefördert wird, die als „Diagramme“ bezeichnet werden können, und dass es sich weniger auf mathematische Begriffe und Symbole, also Teile der „konventionalisierten Mathematik“ stützt. Zudem wird erläutert, wie Sequenzen herausfordernder Aufgaben aufgebaut sein sollten, um sie für alle Kinder – und nicht nur die besonders interessierten – anregend zu gestalten.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871822.0.10
====================================================
Ana Kuzle: Eine Explorationsstudie im Rahmen eines expliziten Problemlösetrainings: Der Fall der heuristischen Strategie des Rückwärtsarbeitens
Erste Seite: 151
Letzte Seite: 165
Abstract
In einem Design-Forschungsprojekt zum Problemlösen wurden theoriegeleitete und praxisorientierte Materialien entwickelt mit dem Ziel, die systematische Entwicklung der Problemlösungskompetenz von Schüler:innen durch das Erlernen von Heurismen gezielt zu fördern. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf die heuristische Strategie des Rückwärtsarbeitens gelegt, die sich für Schüler:innen als schwer erlern- und anwendbar erwiesen hat. In der Studie nahmen 14 motivierte Schüler:innen der Klasse 5 an einem expliziten Heuristik-Training teil. Die Ergebnisse zeigten, dass die Schüler:innen, obwohl sie vor dem expliziten Training intuitiv ihre Denkprozesse umkehrten, Schwierigkeiten beim Lösen komplexer Umkehraufgaben hatten, was sich nach dem expliziten Heuristik-Training deutlich verbesserte. Somit zeigten die Studienergebnisse, dass die entwickelten Materialien mit dem design-basierten Forschungsansatz die Entwicklung der geistigen Beweglichkeit der Schüler:innen beim Problemlösen durch Rückwärtsarbeiten förderten. Am Ende der Arbeit werden die Ergebnisse im Hinblick auf ihre theoretischen und praktischen Implikationen diskutiert.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871822.0.11
====================================================
Denise Lenz: Einblicke in Fallanalysen zum relationalen Denken bei Kindergarten- und Grundschulkindern
Erste Seite: 167
Letzte Seite: 176
Abstract
Die frühe Algebra nimmt einen immer größeren Stellenwert in der mathematikdidaktischen Forschung ein. Als wesentliche Teilbereiche algebraischen Denkens sind das relationale Denken sowie der Umgang mit Variablen herauszustellen. Der Beitrag gibt einen Einblick in die Fähigkeiten zum Herstellen von Beziehungen zwischen bekannten sowie unbekannten Mengen bei Kindergarten und Grundschulkindern. Drei Fallanalysen werden unter algebraischen Gesichtspunkten im Umgang mit materialbasierten Aufgaben vergleichend gegenübergestellt.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871822.0.12
====================================================
Matthias Müller: Visualisierung der Pentagrammafigur auf der Kugeloberfläche mittels GeoGebra 3D
Erste Seite: 177
Letzte Seite: 185
Abstract
Geometrische Problemstellungen eignen sich in besonderer Weise für ein Problemlösen im Unterricht. Ein Beispiel ist die Konstruktion der Pentagrammafigur auf der Kugeloberfläche. Diese Konstruktion ist in 2D-Abbildungen nur schwer nachzuvollziehen. Zur Visualisierung der Konstruktion bietet sich das digitale Mathematikwerkzeug GeoGebra 3D an. Ebenso unterstützt es die Untersuchung der Eigenschaften der Pentagrammafigur, denn es bietet einen intuitiven und niederschwelligen Zugang zur Problemstellung. Speziell die Konstruktion eines einfach rechtwinkligen Dreiecks auf der Kugeloberfläche ist unkompliziert und anwenderorientiert möglich. Um die vollständige Konstruktion der Pentagrammafigur nachzuvollziehen, sind allerdings im Sinne der instrumentalen Genese bestimmte Bedien-, Verwendungs- und Lösungsschemata notwendig. Im vorliegenden Artikel soll daher sowohl auf die Konstruktion der Pentagrammafigur mittels GeoGebra 3D als auch auf die Verortung der Problemstellung in einem Stadienmodell der instrumentalen Genese eingegangen werden. In einer anschließenden Diskussion wird die Problemstellung als Beispiel für das Problemlösen erörtert.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871822.0.13
====================================================
Hartmut Rehlich: Kurse bei Strömung – Skizze einer geometrischen und einer analytischen Modellierung
Erste Seite: 187
Letzte Seite: 196
Abstract
Ein Schiff halte bei konstanter Meeresströmung stets genau auf das Ziel zu. Das heißt, dass so gesteuert wird, dass der Bug des Schiffes mit Hilfe eines sichtbaren Ziels (z. B. eines Leuchtturms) oder mit Hilfe eines Peilstrahls, stets auf das Ziel ausgerichtet ist. Das Schiff fährt dann eine sogenannte Radiodrome, was Leitstrahlkurve heißt. Es geht um die Frage, welche Kurven im idealisierten Fall entstehen. Die Darstellung ist elementar und soll mathematisch unterhaltsam sein und enthält auch Hinweise darauf, wie man das Material im Schulunterricht einsetzen kann.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871822.0.14
====================================================
Stephan Rosebrock: Gerade Anzahl
Erste Seite: 197
Letzte Seite: 209
Abstract
Hier geht es um eine mathematische Fragestellung, die sich elementar formulieren lässt, aber nur schwer, oder gar nicht, vollständig zu beantworten ist. n Steine sollen so auf die Kacheln einer Zerlegung der Ebene in Quadrate gelegt werden, dass in jeder Reihe und jeder Zeile gerade viele Steine liegen. Es ist ganz erstaunlich, welche Reichhaltigkeit an mathematischen Themen sich ergeben, wenn man dieses Problem untersucht.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871822.0.15
====================================================
Benjamin Rott: Heurismen: deskriptiv, aber nicht präskriptiv – oder warum Heurismentrainings oft wenig effektiv sind
Erste Seite: 211
Letzte Seite: 218
Abstract
Am Beispiel dreier Probleme und eines Heurismus wird stoffdidaktisch aufgezeigt, warum Heurismentrainings oft keine großen Effekte in Bezug auf die Problemlösekompetenz der trainierten Lernenden aufweisen. Ein möglicher Grund dafür ist die Tatsache, dass sich Heurismen – so wie sie in der Literatur in der Regel vorkommen – gut zur Beschreibung von Tätigkeiten eignen, aber leider weniger gut als Hilfestellung für Problemlösende, die nach Lösungsideen suchen.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871822.0.16
====================================================
Silke Ruwisch, Cathleen Heil: Viel mehr als nur „Ansichten zuordnen“ – Aufgaben zur Perspektivübernahme im Realraum als Ansatz für bewusste Erfahrung mit konfligierenden Bezugssystemen
Erste Seite: 219
Letzte Seite: 230
Abstract
Perspektivübernahme ist eine lebenspraktische Facette räumlicher Fähigkeiten, bei der es gilt, wechselseitige Relationen von Bezugssystemen zu verstehen. In Aufgaben, die lediglich erfordern, Ansichten zuzuordnen, wird ein Bewusstmachen dieser den Raum konstituierenden, zeitlich variablen Konstrukte kaum gefördert; wohl aber bei der Arbeit mit Karten im Realraum. Durch deren Raum-in-Raum-Eigenschaft können vielfältigere Aufgaben zur Perspektivübernahme konzipiert werden. Diese verbinden sensuell-handelnde Erfahrungen mit dem Potential, von ihnen zu abstrahieren und bewusst die verschiedenen Relationen zu fokussieren. Erste Beispiele zeigen dies auf und ein Überblick über mögliche Implikationen deutet an, dass dieses perspektivenreiche Thema noch länger Teil der aktuellen Diskurse in Praxis und Forschung sein sollte.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871822.0.17
====================================================
Harald Schaub: Der gute Wille allein reicht nicht aus: Denk- und Entscheidungsfehler in kritischen Situationen
Erste Seite: 231
Letzte Seite: 242
Abstract
Die meisten komplexen Lagen sind nicht vollständig durchschaubar. Immer gültige Regeln für Entscheider gibt es nicht. Die Kompetenz zum Umgang mit Unbestimmtheit und Komplexität, zum problemlösenden Denken und Entscheiden erwächst aus der Kenntnis menschlicher Stärken und Schwächen und aus der Reflexion eigener Fähigkeiten und Unzulänglichkeiten.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871822.0.18
====================================================
Michael Schmitz: Titel des Beitrags: Kegelschnitte falten
Erste Seite: 243
Letzte Seite: 260
Abstract
Schneidet man einen (Doppel-)Kegel mit einer Ebene, so entstehen Schnittkurven, die man als Kegelschnitte bezeichnet. Über Betrachtungen zu Funktionen finden Parabeln und Hyperbeln noch Eingang in den Mathematikunterricht. Geometrische Eigenschaften oder analytische Untersuchungen der Kegelschnitte spielen hingegen kaum eine Rolle. Wir befassen uns hier auch nur mit den ebenen Kurven, die wir als Hüllkurven ihrer Tangenten erzeugen. Dabei entstehen die Tangenten durch Falten. Auch eine geometrische Beschreibung dieser Kurven werden wir dabei entdecken.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871822.0.19
====================================================
Heinz Schumann: Schnittkörper des Würfels in der Elementarbildung
Erste Seite: 261
Letzte Seite: 266
Abstract
Friedrich Fröbel (1782-1852), bekannt vor allem durch sein Konzept des Kindergartens und die erste Gründung desselben, hat wohl als erster Pädagoge Schnittkörper des Würfels für pädagogische Zwecke genutzt. Seine metaphysisch begründete und in der Gedankenwelt der Romantik und des Idealismus wurzelnde elementare Erziehungslehre und Didaktik ist in der deutschen Pädagogik des 20. Jahrhunderts gewürdigt worden. Um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen, müssen wir auf die genannte Literatur und auch auf Friedrich Fröbels gesammelte pädagogische Schriften verweisen aus denen auch im Folgenden zitiert wird. Wir beschränken uns hier auf eine kommentierende Wiedergabe wesentlicher Stellen in Fröbels Lernspielprogramm für die ‚Vorschule‘, die sich auf Körperschnitte beziehen.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871822.0.20
====================================================
Martin Stein: Titel des Beitrags: 15 Jahre Mathe-Meister. Vom Testen mathematischen Basiswissens zur Kompetenzorientierung
Erste Seite: 267
Letzte Seite: 277
Abstract
Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung in den Jahren 2007 bis 2011 geförderte Projekt Mathe-Meister wurde nach seinem Abschluss im Jahr 2011 vom Verfasser weiter betreut. Dabei hat es zwei wesentliche Entwicklungsschritte gemacht: Seit ca. 2013 wurden Tests auch für die Lehrberufe entwickelt, so dass die Zahl der Tests mittlerweile auf über 60 gestiegen ist. Des Weiteren wurden Tests entwickelt, die in Berufskollegs zu Beginn eines neuen Ausbildungsjahrgangs eingesetzt werden. Hierfür wurde die Methode der Zusammenstellung eines Tests neu entwickelt, die Funktionalitäten der Software wurden für schulische Bedarfe erheblich erweitert (Mathe-Meister 2.0). In Kooperation mit der Firma Bettermarks wird seit Ende 2020 ein Test- und Übungsumgebung für die online-Übungsplattform Bettermarks entwickelt. Im Rahmen dieses Projekts (Mathe-Meister 3.0) erfolgten eine vollständige Neu-Organisation und Systematisierung der Tests und die Entwicklung neuer berufsspezifischer Aufgabenformate für kompetenzorientierte Aufgaben auf dem Niveau der Abschlussprüfungen für die verschiedenen Berufe. Es wurden für 50 Berufe jeweils genau auf diesen Beruf zugeschnittene Aufgaben entwickelt. Der Beitrag skizziert die Entwicklung des Projektes und analysiert exemplarisch die von den Auszubildenden geforderten Kompetenzen am Beispiel zweier Aufgaben.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871822.0.21
====================================================
Nina Sturm: Der Einsatz von Heurismen beim Problemlösen in der Grundschule – womit fängt man an?
Erste Seite: 279
Letzte Seite: 295
Abstract
Das Problemlösen als allgemein mathematische Kompetenz ist ein zentraler Bestandteil des Mathematikunterrichts der Grundschule. Es gilt, sowohl inner- als auch außermathematische Probleme zu integrieren, für die Grundschulkinder noch kein bekanntes Lösungsschema anwenden können. Aus fachdidaktischer und psychologischer Sicht weiß man, dass Heurismen Problemlöseprozesse unterstützen können, wenngleich sie das Finden der Lösung nicht garantieren. Es werden dabei heuristische Strategien, heuristische Hilfsmittel und heuristische Prinzipien unterschieden. Welche dieser Heurismen sind für Grundschulkinder eine Stütze? Gibt es Heurismen, die zuerst gefördert werden sollten, um darauf aufbauend weitere zu forcieren? Im Beitrag wird eine erste Antwort auf diese Fragen abgeleitet und eine Empfehlung für den Grundschulunterricht ausgesprochen.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871822.0.22
====================================================
Hans Walser: Rhombenfiguren
Erste Seite: 297
Letzte Seite: 309
Abstract
Wir verwenden Rhomben als Bauteile für zusammengesetzte Figuren in der Ebene und im Raum. Zunächst arbeiten wir mit Rhomben, die alle die gleichen Winkel haben, die also zueinander ähnlich sind. Dies ermöglicht Verallgemeinerungen von Sätzen der Elementargeometrie. Wir finden eine struktursymmetrische Schließungsfigur und erhalten eine neue Sicht auf den Satz des Pythagoras. Anschließend verwenden wir Rhomben, die alle die gleiche Seitenlänge haben. Damit schaffen wir den Übergang von der Ebene in den Raum. Wir konstruieren einen Rhombenkörper, der die Kosinusspindel approximiert.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871822.0.23
====================================================
Hans-Georg Weigand: Rettet die Kegelschnitte – Argumente für eine (digitale) Wiederbelebung eines vergessenen Themas der Geometrie
Erste Seite: 311
Letzte Seite: 320
Abstract
Kegelschnitte waren in der gesamten Entwicklungsgeschichte der Mathematik zentrale und wichtige Objekte der Elementargeometrie, Darstellenden Geometrie, Differentialgeometrie, Analysis, Analytischen und Projektive Geometrie. Vom Ende des 18. bis zum Ende des 20. Jahrhunderts waren sie auch obligatorische Inhalte des Mathematikunterrichts. Heute sind Kegelschnitte nicht mehr als eigenständige Inhalte im Mathematikunterricht zu finden. Im Folgenden werden Argumente dafür angegeben und an einigen – historischen – Beispielen erläutert, wie digitale Technologien dazu beitragen können, zumindest einen Einblick in die faszinierende Welt der Kegelschnitte im heutigen Mathematikunterricht zu geben.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871822.0.24
====================================================
Christian Werge: Rechtwinklige Dreiecke aus ihrer Hypotenuse und … konstruieren: Ein „weites Feld“, Probleme zu finden und zu lösen
Erste Seite: 321
Letzte Seite: 336
Abstract
An einem Dutzend Konstruktionsaufgaben zu rechtwinkligen Dreiecken mit gegebener Hypotenuse, die sich lediglich in einer einzigen gegebenen Größe unterscheiden, werden unterschiedliche Lösungswege und heuristische Ansätze dargestellt, teils auf Schulbüchern aus dem 19. Jahrhundert basierend. Im Fokus stehen Ortslinien, die durch eine gewisse Variation gegebener Größen mit Hilfe eines DGS (GeoGebra) entstehen sowie algebraische Berechnungen, die den Zirkel-und-Lineal-Konstruktionen zugrunde liegen. Wenn möglich, werden auch schulübliche (traditionelle) Lösungswege beschritten.
https://doi.org/10.37626/GA9783959871822.0.25