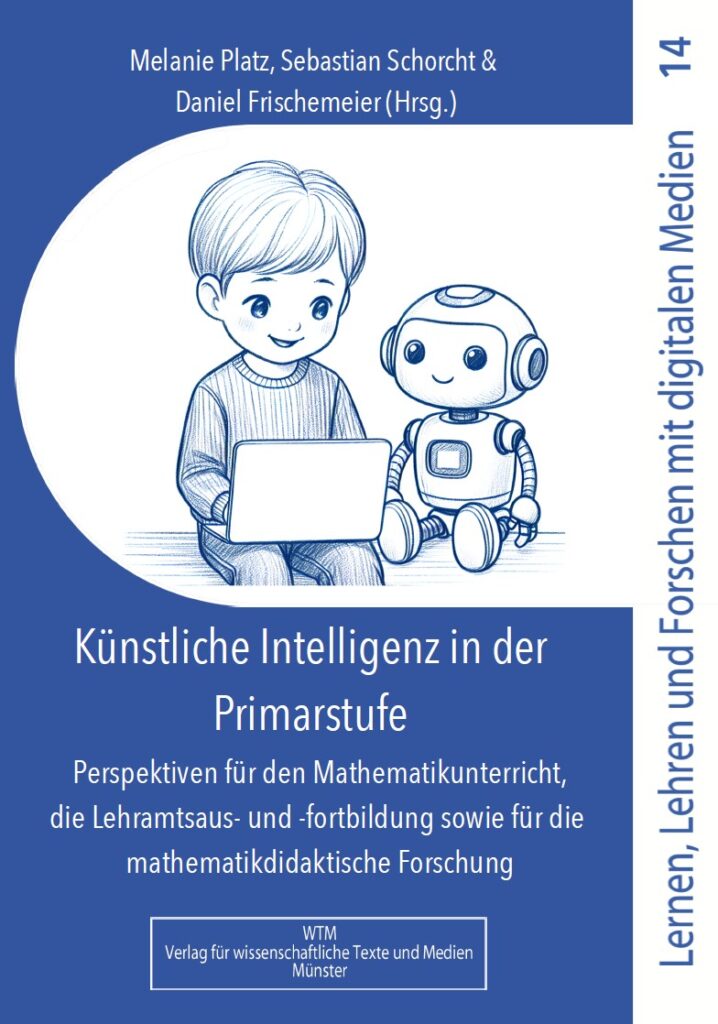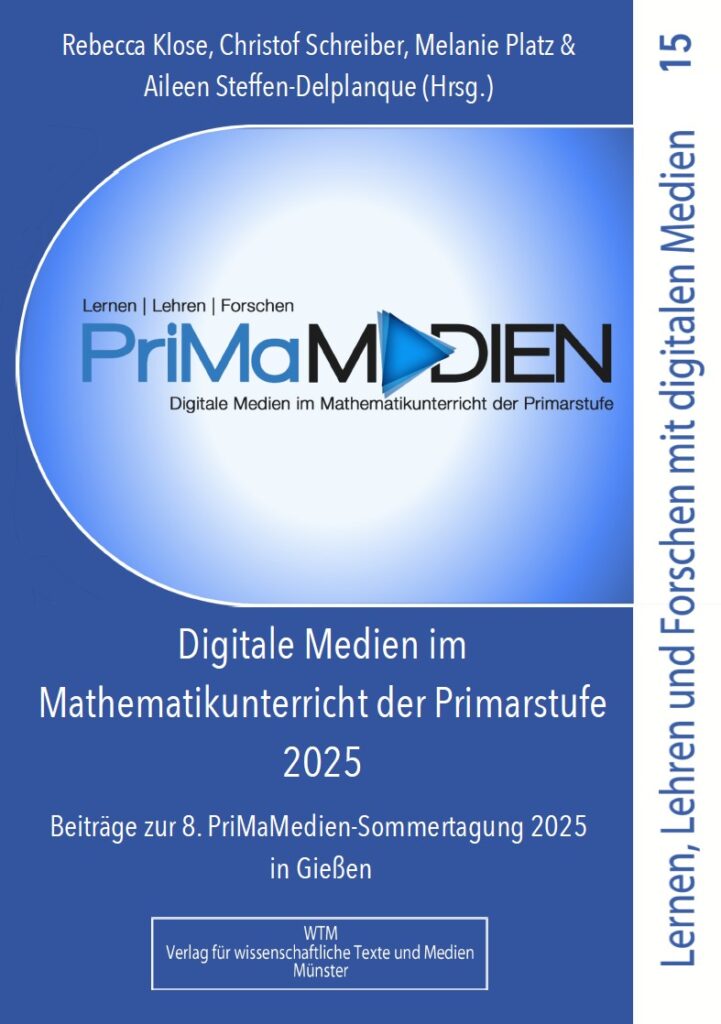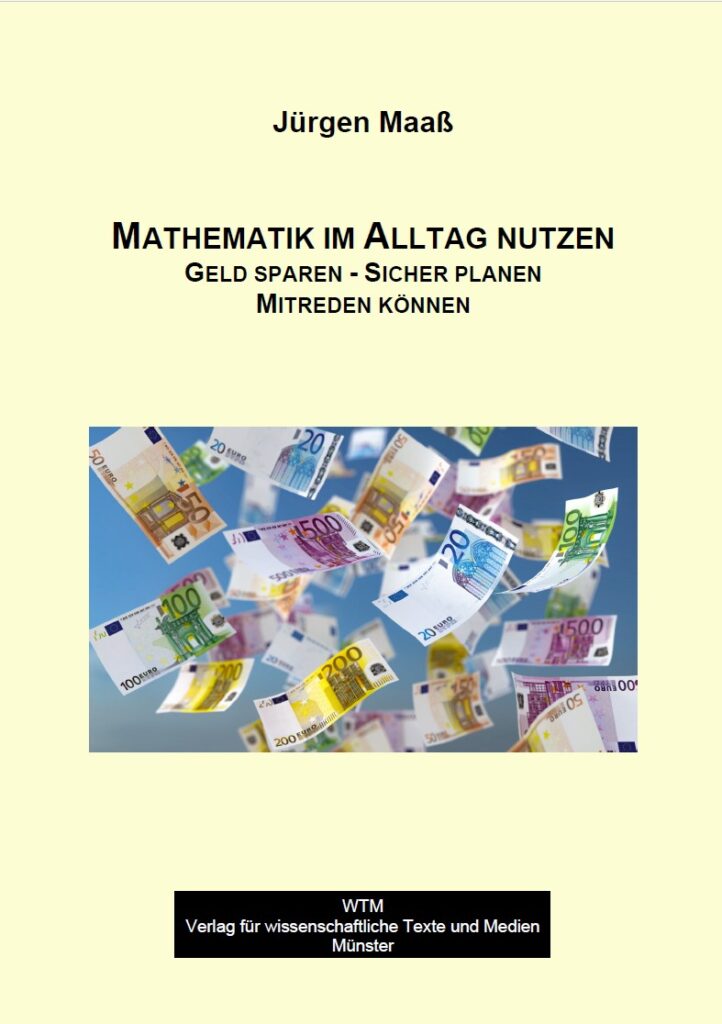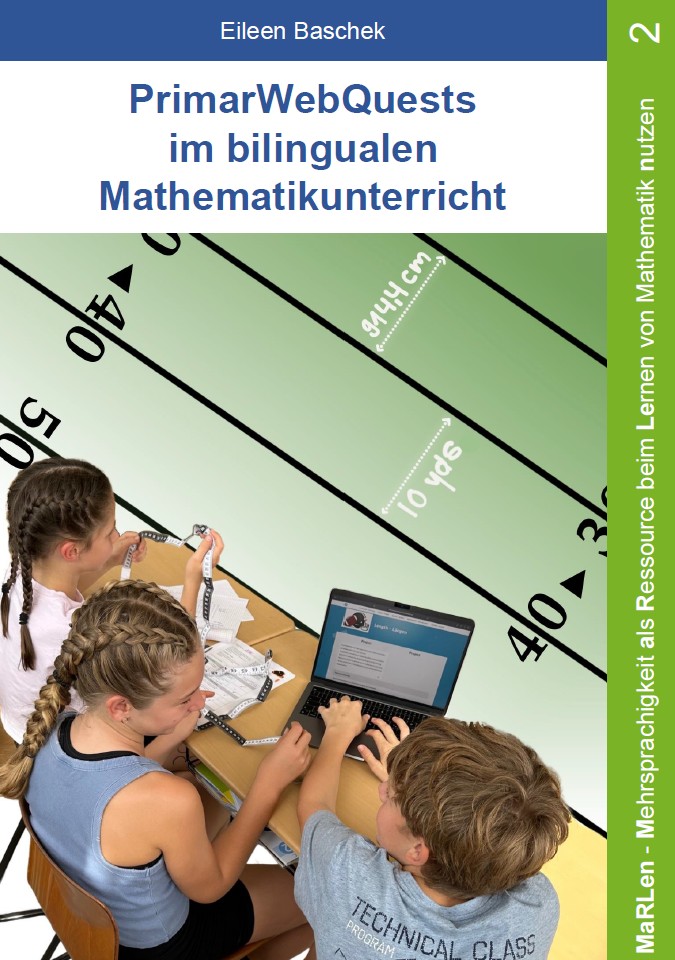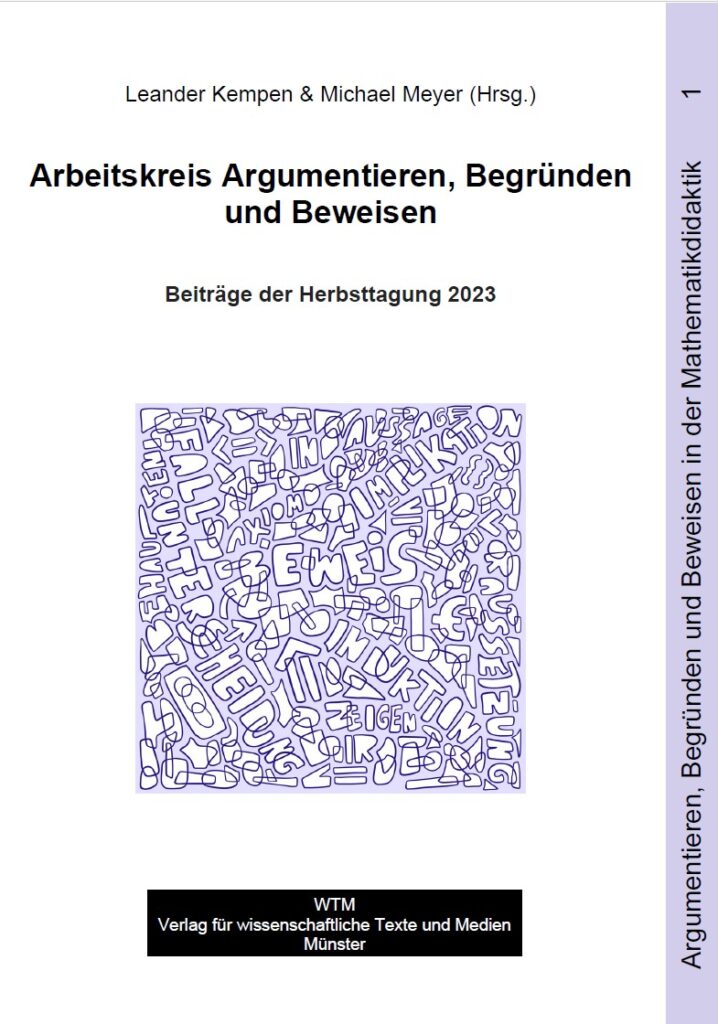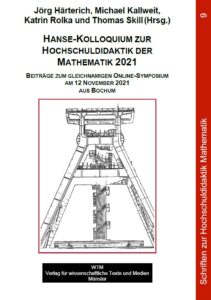 Beiträge zum gleichnamigen Online-Symposium am 12 November 2021 aus Bochum
Beiträge zum gleichnamigen Online-Symposium am 12 November 2021 aus Bochum
Band 9 der Reihe Schriften zur Hochschuldidaktik Mathematik
Münster 2023, ca. 300 S., DIN A5
978-3-95987-263-8 Print 39,90 €
978-3-95987-264-5 E-Book 36,90 €
https://doi.org/10.37626/GA9783959872645.0
Für Bestellungen bei edition-buchshop hier klicken
Für eine Vorschau klicken Sie bitte auf das Cover-Bild
Für das Hansekolloquium zur Hochschuldidaktik der Mathematik gab es 2021 in Bochum gleich zwei Schwerpunkte, die aber durchaus miteinander verbunden sind: „Kompetenzorientiertes digitales Prüfen“ sowie „Herausforderungen und Unterstützung von Studienanfängerinnen vor und nach Corona“. Auch wenn in der Formulierung „während Corona“ nicht vorkommt, gab es einige Beiträge, die sich explizit dieser Zeit gewidmet haben, insbesondere hat die Durchführung digitaler Prüfungen während der Corona-Pandemie viele Hochschulen vor große Herausforderungen gestellt. Mit dem Blick nach vorn sind gerade die bewährten Konzepte, die auch die Kompetenzorientierung mitberücksichtigen, von besonderem Interesse.
Insgesamt wurden mit den beiden Schwerpunkten vielfältige aktuelle Fragen aus den vergangenen, besonders herausfordernden Semestern aufgegriffen. Der vorliegende Band umfasst 21 Beiträge, darunter einen Hauptbeitrag von Stefanie Rach, Stefan Ufer und Daniel Sommerhoff. Die adressierten Themen zeigen eine große Vielfalt, beispielsweise:
- Mathematisches Argumentieren, Begründen und Beweisen von Studierenden sowie damit verbundene Schwierigkeiten und Lösungsansätze
- Anregungen für Sprechanlässe und Berücksichtigung des diskursiven Charakters im Mathematikstudium vor dem Hintergrund einer sprachsensiblen Hochschullehre
- Vor- und Brückenkurse als Vorbereitung auf ein mathematikhaltiges Studium, aber auch Unterstützungsangebote in der Studieneingangsphase, etwa in Form eines Orientierungsstudiums
- Möglichkeiten zur Gestaltung aktivierender Mathematikvideos sowie Potenziale von Mathematiklernvideos aus der Sicht von Studierenden
- Digitale Lernangebote zur Förderung der geometrischen Begriffsbildung oder zum Einsatz in Stochastik-Lehrveranstaltungen
- Elektronische Prüfungen etwa mit Blick auf die Effizienz der Prüfungsdurchführung, den didaktischen Mehrwert sowie die Individualisierung des Prüfungsprozesses
- Entwicklung affektiver Merkmale, wie Interesse, Selbstwirksamkeitserwartung oder Motivation
Abstracts
Rach, Stefanie; Ufer, Stefan; Sommerhoff, Daniel: Mathematics Online Assessment: Do future mathematics students find assessment-based feedback useful?
Supportive feedback is an important driver of successful learning processes. Systematic provision of information on different levels can provide learners with starting points on where and how to improve their learning process. The Mathematics Online Assessment System (MOAS) offers criterion-oriented and social-comparative feedback to future mathematics students, based on their performance concerning five different types of knowledge, which are assumed to be predictive for successfully studying mathematics. With a sample of 188 future students enrolled in mathematics or mathematics teacher education programs, we examined the perceived usefulness of both types of feedback. Data indicate that criterion-oriented feedback is perceived as more useful than social-comparative feedback and that the used subscales of feedback perception, which for example focus on information on potential actions and consequences in the feedback, can explain why students perceive feedback as useful.
Erste Seite: 3
Letzte Seite: 14
————————————————————————————————————-
de Wiljes, Jan-Hendrik; Kristoffersen, Mira; Scharlach, Christine: Das Mathe-matische Propädeutikum – Eine studiumsbegleitende Brücke zwischen Schule und Hochschule
Mangelndes mathematisches Vorwissen bei einem erheblichen Teil von Studien-anfänger:innen ist ein mittlerweile bekanntes und problematisches Phänomen. Stark betroffen sind Studierende des Grundschullehramts, insbesondere wenn Mathematik Pflichtfach ist. Diese Zielgruppe ist besonders wichtig, da die angehenden Lehrkräfte als Multiplikatoren einen wesentlichen Einfluss auf die mathematischen Fertigkeiten zukünftiger Generationen haben. Um der Problematik mangelnden Vorwissens zu begegnen und den Übergang in die Hochschulmathematik zu erleichtern, wurde im Jahr 2019 an der Freien Universität Berlin das im ersten Studiensemester stattfindende Mathematische Propädeutikum entwickelt, das aktuell primär von Studierenden des Grundschullehramts besucht wird. In diesem Artikel werden sowohl das Konzept des Kurses vorgestellt als auch die verwendeten Methoden in den wissenschaftlichen Kontext eingebettet. Abschließend werden sowohl potenzielle Zusammenhänge zwischen dem Besuch des Kurses und Leistungen in anschließenden fachmathematischen Modulen als auch Möglichkeiten zur Veränderung/Verbesserung der Veranstaltung diskutiert.
Erste Seite: 15
Letzte Seite: 30
————————————————————————————————————-
Gallaun, Dennis; Kruse, Karsten; Seifert, Christian: Elektronische Prüfungen in Mathematik – Ein Beispiel
Lehrveranstaltungen mit sehr großen Teilnehmerzahlen erzeugen ein entsprechend hohes Prüfungsaufkommen. Die elektronische Durchführung solcher Prüfungen inklusive einer automatisierten Korrektur und Bewertung kann zum einen den Arbeitsaufwand erheblich reduzieren und liefert zum anderen eine neue Dimension möglicher Prüfungsfragen. Außerdem lässt sich damit der Prüfungsprozess für die einzelnen Prüflinge flexibilisieren. In diesem Beitrag gehen wir auf diese drei Zielstellungen „Effizienz der Prüfungsdurchführung“, „didaktischer Mehrwert“ und „Individualisierung des Prüfungs-prozesses“ von elektronischen Prüfungen am Beispiel einer Lehrveranstaltung „Lineare Algebra für Ingenieurstudierende“ ein.
Erste Seite: 31
Letzte Seite: 42
————————————————————————————————————-
Geisler, Sebastian; Rolka, Katrin: „Simpel, kompakt und einfach zu verstehen“
– Potenziale von Mathematik-Lernvideos aus Studierendensicht
Frei verfügbare Mathematik-Lernvideos auf YouTube erfreuen sich unter Studierenden großer Beliebtheit. Aus theoretischer Sicht können Lernvideos erhebliche Potenziale für den Lernprozess aufweisen. Im vorliegenden Beitrag wird untersucht, welche Vorzüge Studienanfänger:innen in Ingenieurstudiengängen in Mathematik-Lernvideos auf YouTube sehen, und inwiefern sich die studentischen Sichtweisen mit den theoretischen Potenzialen von Lernvideos decken. Praktische Implikationen der Ergebnisse für das Lernen mit Videos werden diskutiert und Forschungsdesiderate zur Nutzung von Lernvideos in der Studieneingangsphase aufgezeigt.
Erste Seite: 43
Letzte Seite: 54
————————————————————————————————————-
Giebermann, Klaus: Digitale Paper & Pencil-Aufgaben
In der vorliegenden Arbeit wird das digitale Paper & Pencil-System vorgestellt, das die Vorteile digitaler und handschriftlicher Aufgaben miteinander verbinden soll. Einerseits werden Aufgaben parametrisiert und automatisch korrigiert, andererseits haben Studierende die Möglichkeit, den vollständigen Lösungsweg anzugeben, der anschließend schrittweise überprüft wird. Mit dem System können Aufgaben zu Termumformungen, Grenzwerten, Bestimmung der Lösungsmenge von Gleichungen und Ungleichungen inklusive Fallunterscheidungen und Proben gestellt und überprüft werden. Für die Eingabe kompletter Lösungswege wird eine zweidimensionale Eingabeoberfläche vorgestellt. Zum Schluss wird der Einsatz des Systems an der Hochschule Ruhr West beschrieben.
Erste Seite: 55
Letzte Seite: 65
————————————————————————————————————-
Göller, Robin; Gildehaus, Lara; Liebendörfer, Michael; Besser, Michael: Erfassung und Vergleich mathematischer Eingangsvoraussetzungen angehender Studierender verschiedener mathematikhaltiger Studiengänge
Vor dem Hintergrund der Diskussion über notwendige mathematische Eingangsvoraussetzungen für mathematikhaltige Studiengänge analysieren wir auf Basis der Item-Response-Theorie (IRT) Daten von 310 angehenden Studierenden zu einem Mathematiktest zu Beginn von Mathematikvorkursen. Die Ergebnisse zeigen, dass Wissen über begriffliche und rechnerische Modellierungs- oder problemorientierte Aufgaben sowie technische Aufgaben empirisch reliabel erfasst werden kann und dass sich angehende Studierende verschiedener mathematikhaltiger Studiengänge in diesen mathematischen Voraussetzungen sowie ihrer Abitur- und letzten Mathematiknote signifikant voneinander unterscheiden. Die Unterschiede sind bei begrifflichen und rechnerischen Modellierungs- oder problemorientierten Aufgaben größer als bei technischen Aufgaben. Diese Ergebnisse legen unter anderem nahe, dass Vor- und Brücken-kurse, wenn sie eine Harmonisierung des Leistungsniveaus zum Ziel haben, eher auf den Aufbau von Wissen über begriffliche und rechnerische Modellierungs- oder problemorientierte Aufgaben fokussieren sollten als auf Wissen zu technischen Aufgaben.
Erste Seite: 66
Letzte Seite: 80
————————————————————————————————————-
Kaiser, Julia T.: Anregen von Sprechanlässen im Mathematikstudium mit Fokus auf die Studieneingangsphase
Sprache und Verstehen sind grundsätzlich eng miteinander verbunden und dies gilt insbesondere für das Verstehen von Mathematik. In der schulbezogenen Mathematikdidaktik ist diese Verbindung bereits gut untersucht und wird mit verschiedenen Ansätzen im sprachsensiblen Mathematikunterricht berücksichtigt. Ausgehend von der „Sprache des Verstehens“ können schließlich neue Sachzusammenhänge in der „Sprache des Verstandenen“ (Wagenschein, 1980) formuliert werden. Diese Grundidee lässt sich auch auf die Studieneingangsphase übertragen. Ziel dieses Beitrags ist es, Ideen für eine sprachsensible Hochschullehre zu sammeln. Denn auch im Mathematiklehren an der Hochschule kann es von Vorteil sein, vielfältige Sprechanlässe für Studierende zu schaffen, die in ihrem diskursiven Charakter zum Reflektieren über gelernte Konzepte anregen und das Aufbauen tragfähiger Vorstellungen begünstigen.
Erste Seite: 81
Letzte Seite: 90
————————————————————————————————————-
Kempen, Leander; Liebendörfer, Michael: Zu digital – zu viel – zu schwer?
Qualitative Einsichten in das Erleben und Handeln von
Erstsemester-Studierenden der Mathematik während der Corona-Pandemie
Während der Corona-Pandemie haben wir von sechs Erstsemester-Studierenden der Mathematik zweimal wöchentlich Selbstberichte zu ihrem Studium in einer vollständig online durchgeführten Lehrveranstaltung zur „Linearen Algebra 1“ erhoben. Gegenstand der Selbstberichte waren unter anderem das Vorgehen beim Lernen, die Nutzung von Materialien und Ressourcen und Fragen zum Erleben von Kompetenz, sozialer Eingebundenheit und Autonomie, um den Motivationsverlauf der Studierenden nachverfolgen zu können. In diesem Beitrag fokussieren wir den ersten Abschnitt des Semesters, bis die Frage der Klausurzulassung auf Basis der erworbenen Hausübungspunkte geklärt ist. Übergeordnet können verschiedene Phasen im Studienverlauf konzeptualisiert werden („Einfinden in das Studium und Arbeitsmodus finden“, „Versuchen, dran zu bleiben“ und „Druck aushalten und durchhalten“), die mit charakteristischen Ausprägungen bezüglich der Selbstregulation des Lernens und der Facetten Autonomie, Kompetenzerleben und sozialer Eingebundenheit einhergehen. Durch das Erfassen des Erlebens und Handelns können differenzierte Maßnahmen entwickelt werden, um die Motivationsentwicklung im Studium zu fördern.
Erste Seite: 91
Letzte Seite: 106
————————————————————————————————————-
Kirsten, Katharina; Greefrath, Gilbert: Vorkurs in Zeiten von Corona:
Zur Entwicklung affektiver Merkmale in Präsenz und Distanz
Der Übergang von der Schule zur Hochschule wird von vielfältigen Schwierigkeiten begleitet, denen an vielen Standorten durch Vorkurse begegnet wird. Neben der Aufarbeitung mathematischer Inhalte zielen Vorkurse dabei auch auf die Stärkung affektiver Merkmale ab. Inwiefern solche Ziele auch in pandemiebedingten Distanzformaten erreicht werden können, wird aktuell kritisch diskutiert. In der hier dargestellten Studie wird daher untersucht, in welchem Maße sich Studierende einer Distanz- und einer Präsenzübung in Bezug auf die Entwicklung affektiver Merkmale unterscheiden. Hierzu wurden im Mathematikvorkurs 2021 das Interesse, die Selbstwirksamkeitserwartung und die soziale Eingebundenheit der 159 Studierenden in einem Prä-Post-Design erhoben. Der Vorkurs richtet sich an Lehramtsstudierende der Primar- und Sekundarstufe I und basiert auf einer digitalen, asynchronen Vorlesung. Im Beitrag werden die Ergebnisse präsentiert und Implikationen für die digitale Lehre diskutiert.
Erste Seite: 107
Letzte Seite: 122
————————————————————————————————————-
Krapf, Regula: Wie können Mathematikvideos aktivierend gestaltet werden?
Im Zuge der Corona-Pandemie haben Lernvideos in der Hochschulmathematik eine stärkere Verbreitung gefunden. Videos werden jedoch oft mit einer passiven Rezeptionshaltung und damit überwiegend mit oberflächlichem Lernen assoziiert, wobei auf konstruktive und interaktive Lernaktivitäten weitestgehend verzichtet wird. In diesem Beitrag werden zwei Möglichkeiten vorgestellt, wie Studierende beim Videoschauen aktiviert werden können; einerseits durch die Einbindung von Fragen in Videos und andererseits durch die Verwendung eines Lückenskripts, welches parallel zum Videoschauen vervollständigt wird. Dabei sollen auch erste Evaluationsergebnisse der Umsetzung an der Universität Koblenz-Landau präsentiert werden.
Erste Seite: 123
Letzte Seite: 137
————————————————————————————————————-
Lache, Jonas: Digitale Lehr- und Lernmaterialien für Stochastik-Veranstaltungen an Hochschulen
Im Rahmen des Projekts OER.Stochastik.nrw werden digitale Lehr- und Lernmaterialien für die Hochschullehre aus dem inhaltlichen Bereich der Stochastik entwickelt. Diese interaktiven Anwendungen, Erklärvideos und digitalen Aufgaben sollen so gestaltet sein, dass Lehrende sie in ihre Lehrveranstaltungen integrieren können. Zudem sollen sie Studierende beim Lernen unterstützen, zum Beispiel im Selbststudium. Mit den interaktiven Anwendungen wird versucht, Objekte und Strukturen der Stochastik konkret erfahrbar zu machen und sie Studierenden zu veranschaulichen. Die Erklärvideos sind so gestaltet, dass sie einen kurzen und anschaulichen Überblick über ein klar abgestecktes Thema liefern. Bei den digitalen Aufgaben liegt der Fokus vor allem auf der Ausgestaltung des automatischen adaptiven Feedbacks, wobei ein Ansatz intensiver verfolgt wird, bei dem Studierende Hilfestellungen in Form von Teilaufgaben erhalten. In diesem Beitrag werden ausgewählte Materialien aus dem Projekt vorgestellt. Zudem gibt es einen Überblick über die Erprobung und Evaluation der Materialien im Rahmen von Lehrveranstaltungen sowie einer qualitativen Interviewstudie.
Erste Seite: 138
Letzte Seite: 151
————————————————————————————————————-
Lorenzen, Hinrich; Schmitz, Michael: Das Frame-Konzept – ein neuer Ansatz zur Problematik des Beweisverstehens
In diesem Beitrag führen wir das aus der KI-Forschung, Linguistik und „Cognitive Science“ stammende Frame-Konzept aus zeitgemäßer Perspektive ein und zeigen einen möglichen Wert für Anwendungen in der Mathematikdidaktik auf. Insbesondere im Hinblick auf kommunikative Aspekte des Mathematiklernens im Allgemeinen und auf das Beweisverstehen im Speziellen plädieren wir für eine Wiederbelebung dieses weitgehend in Vergessenheit geratenen Ansatzes. Der Artikel gibt darüber hinaus einen Überblick über in der Vergangenheit geleistete mathematikdidaktische Forschung zum Thema Frames und soll eine Basis für zukünftige Arbeit in diesem Bereich schaffen.
Erste Seite: 152
Letzte Seite: 167
————————————————————————————————————-
Lutz, Tim: becover – „Begriffe im Context vernetzt“. Eine Plattform zur Recherche mathematikdidaktischer Begriffe in Skripten
Artikel stellt die neu entwickelte Plattform becover vor, entwickelt für die Stichwortsuche in Lehr-Skripten jeweils mit beigefügter Kurzerklärung der Begriffe. Inhaltlich nahestehende Begriffe werden visuell vernetzt interaktiv angezeigt. Die Plattform becover macht Studierenden ein Angebot für eine nicht-lineare Vorlesungsnachbereitung. becover ist anwendbar auf beliebige pdf-basierte Lehr-Skripte.
Im Rahmen einer Befragung von Studierenden und Lehrenden wird die Nützlichkeit und präferierte Verwendung beim Lernen untersucht. Dabei werden Potenziale zur Weiterentwicklung der Plattform becover identifiziert.
becover (https://tim-lutz.de/becover) steht frei zur Verfügung für die Bereiche Geometriedidaktik und Algebradidaktik, angewendet auf Skripte von Jürgen Roth. In Entwicklung befinden sich: Didaktik der Zahlbereichserweiterungen, Bereiche der Grundschuldidaktik und die Veranstaltung „Fachdidaktische Grundlagen“.
Erste Seite: 168
Letzte Seite: 175
————————————————————————————————————-
Otten, Sonja; Derboven, Wibke; Kruse, Karsten: Mathematik im Orientierungsstudium
Mathematik ist ein wichtiges Fundament aller ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge, zugleich stellt sie die Studierenden vor große Herausforderungen. Umso wichtiger ist es, sich um die Gestaltung der Mathematik in der Studieneingangsphase Gedanken zu machen. In diesem Artikel stellen wir die verschiedenen Unterstützungsangebote in Mathematik im Orientierungsstudium der Technischen Universität Hamburg dar, die auf der Basis von belastenden und bindenden Studiensituationen ingenieurwissenschaftlicher Studiengänge entwickelt wurden.
Erste Seite: 176
Letzte Seite: 188
————————————————————————————————————-
Pulham, Susan; Frei, Sebastian; Kneip, Frank; Amico, Gianluca: Virtuelles Lernteamcoaching – Förderung von Future Skills und sozialer Eingebundenheit im Rahmen eines mathematischen Moduls
Das Konzept des Lernteamcoachings besteht aus drei wiederkehrenden konsekutiv zu durchlaufenden Lernphasen und gilt als Methode zur Förderung des eigenverantwortlichen und kooperativen Lernens. Der Beitrag gibt zunächst eine Einführung in die Thematik und erläutert anschließend die konkrete Umsetzung des Konzeptes an der htw saar. In diesem Kontext werden die möglichen und entstandenen Konsequenzen für den pandemiebedingten Wechsel der Durchführung 2020 in eine virtuelle Lehrveranstaltung betrachtet. Das Lernteamcoaching wird in Bezug auf die Möglichkeit der Kompensation zu erwartender negativer Effekte auf sozialer Ebene und den Einfluss auf eine Kompetenzförderung im Rahmen der sogenannten „Future Skills“ untersucht. Ergebnisse zeigen, dass sowohl eine (über-)fachliche Kompetenzförderung als auch eine Abmilderung der Auswirkungen reduzierter sozialer Kontakte erreicht werden können. Die Einschätzungen werden anhand quantitativer und qualitativer Daten bekräftigt.
Erste Seite: 189
Letzte Seite: 202
————————————————————————————————————-
Scharlach, Christine; Bücking, Ulrike: MatheProfIL – ein Integriertes Lernkonzept für eine Mathematikvorlesung im Grundschullehramt
Die erste fachwissenschaftliche Mathematik-Veranstaltung für die Studierenden der Grundschulpädagogik (und erste Begegnung mit der Fachkultur) der FU Berlin ist für viele sehr herausfordernd. Die ca. 400 Studierenden pro Jahrgang sind sehr heterogen in ihren mathematischen Vorerfahrungen und die Informationsdichte einer 90-minütigen Vorlesung überfordert viele. Um den Stoff besser auf die Woche zu verteilen und eine Differenzierung im Lerntempo zu ermöglichen, erproben wir ein integriertes Lernkonzept (Blended Learning): 30 Minuten als Online-Lernmodul, zu bearbeiten im Zeitraum zwischen den dann nur noch 60-minütigen Vorlesungen. Das Online-Modul wird in Anlehnung an das Just-in-Time-Teaching (JiTT)-Konzept gestaltet: Ein Lernvideo sowie ein Selbsttest mit Fragen zum Inhalt sowie zur Vertiefung des Verständnisses, welcher nicht nur den Lernenden Orientierung gibt bei der Aneignung der Inhalte der Lernvideos, sondern auch eine Rückmeldung an die Dozierenden zu noch in der Vorlesung zu klärenden Fragen. Erprobt wurde dies seit dem Sommersemester 2019 für zwei von 14 Vorlesungen.
Erste Seite: 203
Letzte Seite: 214
————————————————————————————————————-
Schilson, Benedikt; Giebermann, Klaus: Autorentool für digitale Aufgaben
Wir stellen das Autorentool MathWeb Studio vor, das die Erstellung von digitalen Aufgaben auf den wesentlichen Kern reduziert. Die digitale Aufgabe kann mit MathWeb Studio per Drag-and-Drop aus konfigurierbaren Komponenten zusammengesetzt werden. Im Hintergrund laufende Tests erkennen häufig auftretende Fehler bei der Aufgabenerstellung frühzeitig und machen sie sichtbar. Anwendungsfelder sind Mathematik-Grundlagenmodule und -Vorkurse, aber auch andere Fachrichtungen wie Mechanik, Elektrotechnik oder Wirtschaftswissenschaften.
Erste Seite: 215
Letzte Seite: 222
————————————————————————————————————-
Scholl, Theresa: Geometrische Begriffsbildung philosophierend fördern: Ein digitales Lernangebot
Im Text wird vorgestellt, wie geometrische Begriffsbildungsprozesse mit Philosophieren bei Lehramtsstudierenden gefördert werden können. Dafür wird zunächst der Auftrag Quizshow im Haus der Vierecke zum Philosophieren präsentiert, der in das digitale Lernmodul Basiswissen Geometrie digital eingebunden ist. Es wird auf Basis der Theorie zum Philosophieren und zu den Denkniveaus von geometrischen Lernprozessen herausgearbeitet, welchen Beitrag dieser Auftrag zur Begriffsbildung leisten kann. Dabei wird insbesondere die hierarchische und partitionale Klassifikation von Vierecken diskutiert. Erste Einblicke in die Bearbeitungsprozesse von Studierenden werden an Transkripten aus dem Forschungsprojekt illustriert.
Erste Seite: 223
Letzte Seite: 239
————————————————————————————————————-
Specht, Birte Julia; Danzer, Carolin Lena; Roskam, Marieke: Studierende argumentieren zu multiplikativen Strukturen – Zerlegen, Konstruieren und Umsortieren
Der Beitrag gibt erste Einblicke in eine qualitative Studie zu Kompetenzen von Lehramtsstudierenden im Kontext elementarer zahlentheoretischer Begründungsaufgaben, die auf multiplikative Strukturen fokussieren. Es werden Vorgehensweisen und Fehlermuster herausgearbeitet und analysiert. Dabei steht zunächst die Analyse inhaltlicher Verstehensprozesse bei der Bearbeitung dieser Begründungsaufgaben im Fokus. Es wird anhand von Fallbeispielen aufgezeigt, inwiefern die gewählten Aufgaben das Potenzial bieten, grundlegende Herangehensweisen und Sichtweisen von Studierenden zu erfassen. Des Weiteren werden Zusammenhänge zwischen erfolgreichen Begründungen und von Studierenden genutzten inhaltlichen Sichtweisen dargestellt.
Erste Seite: 240
Letzte Seite: 255
————————————————————————————————————-
Spratte, Verena: (Warum) lesen Studierende Beweise?
Unter Forschenden der Hochschuldidaktik besteht breiter Konsens, dass das Lesen ausformulierter Beweise vom ersten Semester an einen zentralen Bestandteil des Mathematikstudiums bilden sollte und bildet. Wie Studierende mit jenen Beweisen umgehen, i. e. mit welchen Beweisen sie sich in welchen Situationen aktiv aus-einandersetzen, und welche Intentionen sie dabei verfolgen, ist bisher nicht systematisch erforscht. In einer Befragung von 133 Mathematikstudent:innen des zweiten Fachsemesters zeigt sich großer Dissens bezüglich der Relevanz des Beweislesens für das eigene Mathematikstudium. Mit einer theorie- und empiriegeleiteten, qualitativen Inhaltsanalyse wurden aus den Antworten studentische Intentionen für das Lesen von Beweisen erarbeitet. Diese sind breit gestreut und decken weite Teile der bekannten Lehrziele von Dozent:innen beim Präsentieren von Beweisen ab.
Erste Seite: 256
Letzte Seite: 273
————————————————————————————————————-
Utsch, Nina: Vorstellungen von Lehramtsstudierenden zur Konvergenz von Folgen und Teilfolgen
Studierende der Analysis I und Schüler:innen der Sekundarstufe II zeigen oft vergleichbare Schwierigkeiten in den Vorstellungen zu Folgen und Grenzwerten. In einer Studie an der JLU Gießen haben Lehramtsstudierende mit lautem Denken Übungsaufgaben zur Folgenkonvergenz bearbeitet. Neben den Grundvorstellungen zum Grenzwertbegriff zeigen die Studierenden während der Aufgabenbearbeitung weitere mathematisch (nicht-)tragfähige Vorstellungen zur Folgenkonvergenz und Grenzwerten, die im Beitrag vorgestellt werden. In den Bearbeitungen mehrerer Studierender zeigen sich zudem fachliche Auffälligkeiten im Verständnis des Teilfolgenbegriffs. Anhand von Transkriptausschnitten werden vertiefte Einblicke in die Vorstellungen und fachlichen Konzepte von Studierenden in der Analysis I gegeben. Aus den Ergebnissen der Studie werden Anhaltspunkte für die Unterstützung von Studierenden formuliert, die zur Förderung von Vorstellungen und fachbezogenen Konzepten in der Analysis sowohl in analogen als auch in digitalen Settings hilfreich sein können.
Erste Seite: 274
Letzte Seite: 288
————————————————————————————————————-