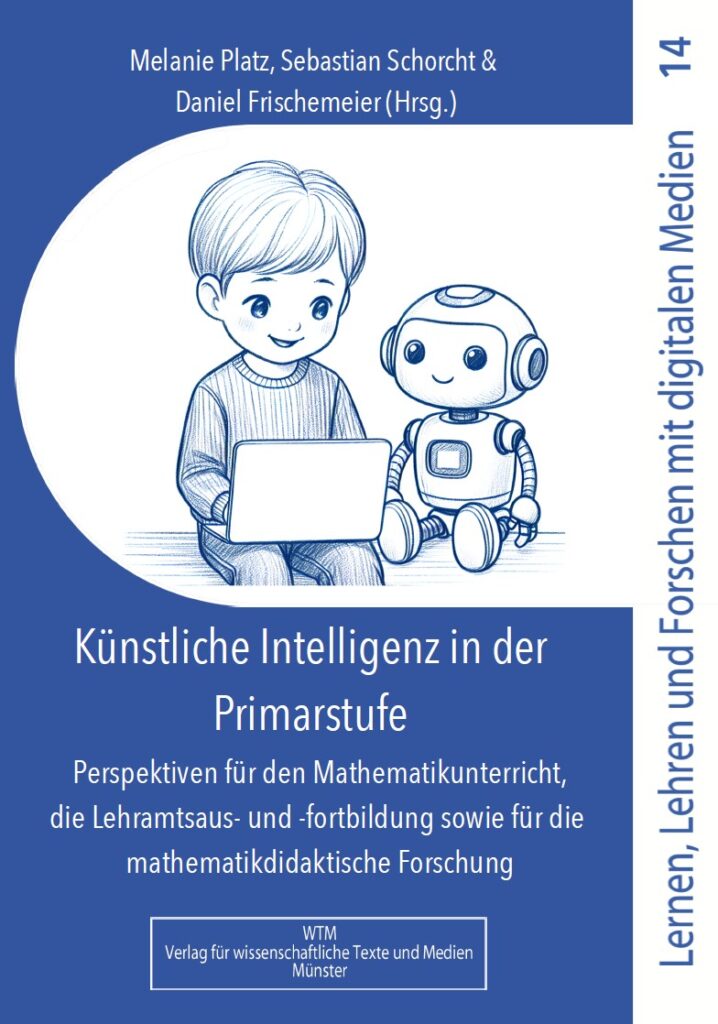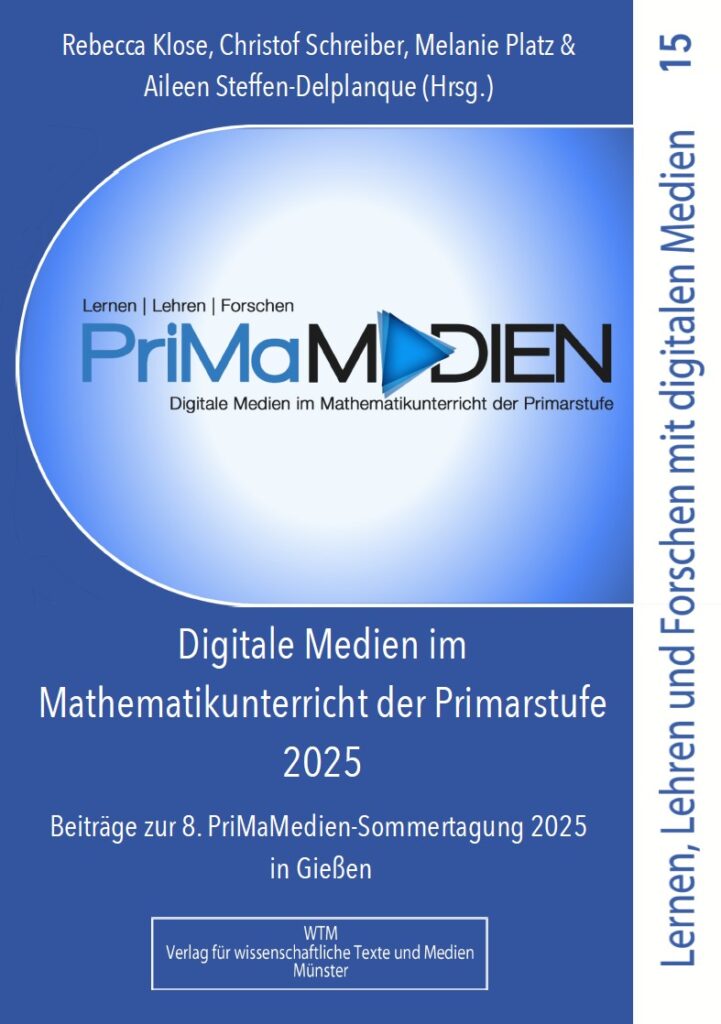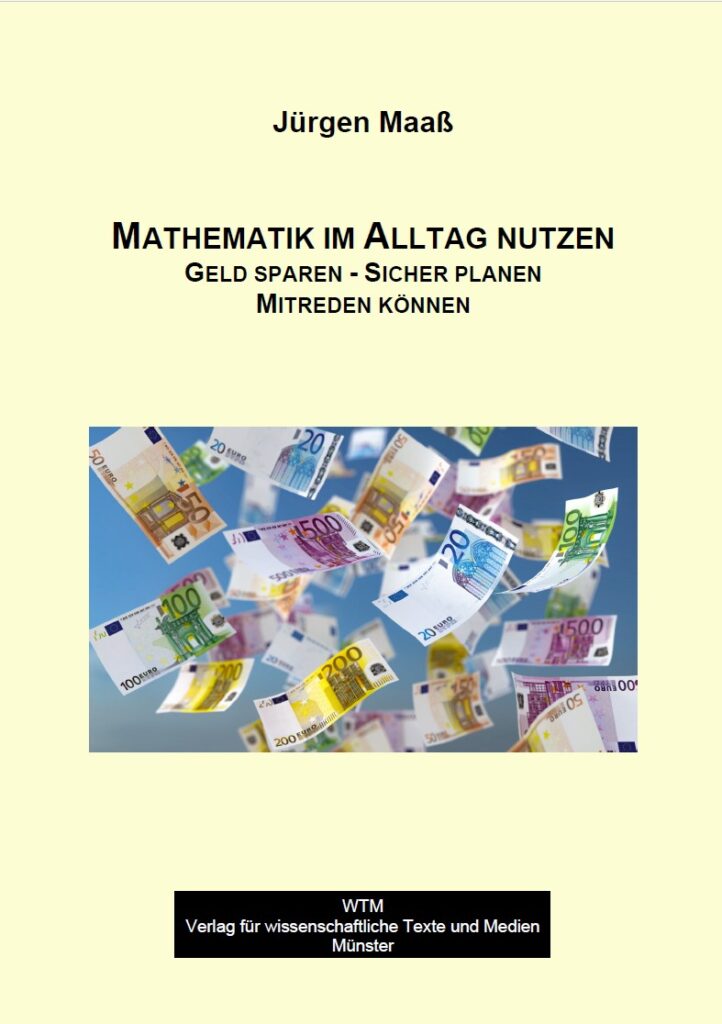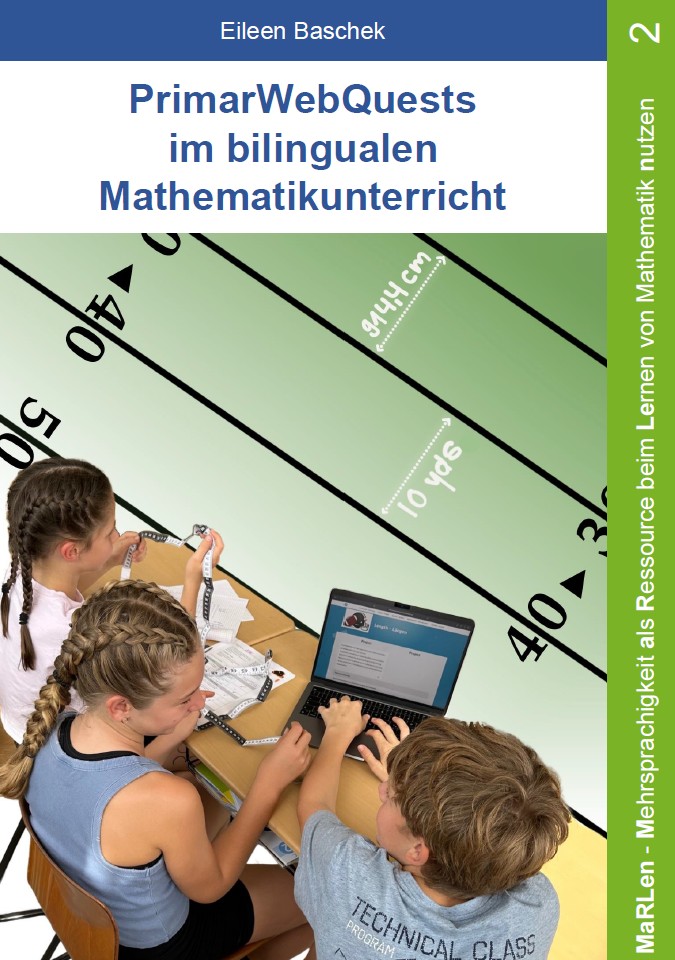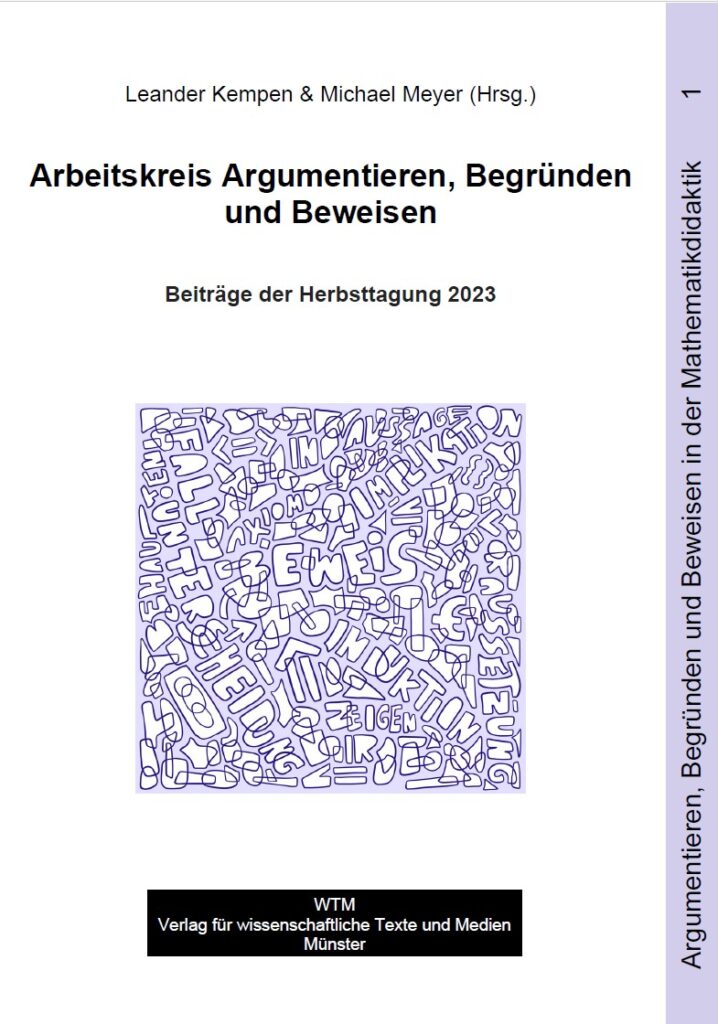Beiträge zum gleichnamigen Symposium am 9. & 10. November 2018 an der Universität Duisburg-Essen
Beiträge zum gleichnamigen Symposium am 9. & 10. November 2018 an der Universität Duisburg-Essen
Band 6 der Reihe Schriften zur Hochschuldidaktik Mathematik
Münster 2019, ca. 200 S., DIN A5
Print: ISBN 978-3-95987-097-9, 27,90 €
Ebook: ISBN 978-3-95987-098-6, 25,90 €
https://doi.org/10.37626/GA9783959870986.0
Für Bestellungen bei edition-buchshop hier klicken
„Vielfalt, die verbindet“ ist ein Leitmotiv, welches das Hanse-Kolloquium zur Hochschuldidaktik der Mathematik 2018 in Essen gut beschreibt. Zu diesem kamen Akteure von Fachhochschulen und Universitäten mit fachmathematischer wie fachdidaktischer Perspektive vom 9. bis 10. November zusammen, um die Problematik des Übergangs von Schule zu Hochschule im Kontext mathematischer Studiengänge zu diskutieren.
Der vorliegende Band bündelt die vielfältigen Projekte und Forschungsaktivitäten rund um den Übergang Schule–Hochschule und zeigt Innovationen innerhalb der mathematischen Hochschullehre gleichermaßen praxisorientiert wie theoretisch fundiert auf.
Neben drei Hauptbeiträgen von Bärbel Barzel, Frode Rønning sowie Nimet Sarikaya und Peter Furlan umfasst der Band weitere 13 Sektionsbeiträge, welche u. a. die nebenstehenden Schwerpunkte fokussieren.
• Heranführen von Studierenden an hochschulmathematische Denk- und Arbeitsweisen
• Anpassung von Strukturen und Aufgaben für einen konstruktiven Übergang von Schule zu Hochschule
• Bewährte Unterstützungsmaßnahmen für ein erfolgreiches Selbstlernen, z. B. in Form von Peer Instruction.
• Etablierte Flipped-Classroom- und Blended-Learning-Formate
• Messung vielfältiger Fähigkeitsprofile von Studierenden beim Eintritt in die Hochschule
• Chancen der Digitalisierung nutzen: Lehren und Lernen mit digitalen Medien, z. B. mithilfe von Lernvideo oder durch dynamische Visualisierungen
• Umgang mit zunehmender Heterogenität und unterschiedlichem Vorwissen auf Seite der Studierenden
• Konzepte problembasierten Lernens in die Hochschullehre integrieren
• Steigerung der Motivation von Studierenden
• Umgang mit der doppelten Diskontinuität mathematischer Lehramtsstudiengänge
Klinger, Marcel; Schüler-Meyer, Alexander; Wessel, Lena: Vielfalt die verbindet: Der Übergang Schule-Hochschule im Rahmen des Hanse-Kolloquiums zur Hochschuldidaktik der Mathematik 2018 in Essen. pp 3 – 8
https://doi.org/10.37626/GA9783959870986.0.01
Barzel, Bärbel: Von der Herausforderung, die Hochschuleingangsphase in Mathematik konstruktiv zu gestalten – Strukturen und Aufgaben. pp 9 – 18
Mathematik stellt für viele Studierende beim Übergang von der Schule zur Hochschule noch immer eine große Herausforderung dar. Die Übergangskommission Schule-Hochschule hat einen Maßnahmenkatalog vorgelegt, um dieser Herausforderung zu begegnen. Dabei ist es Ziel, Studierende auf die neue Lernkultur an der Universität so vorzubereiten, dass Motivation und Offenheit nicht verloren gehen. Vielmehr sollen sie individuell beim fachlichen Lernen und in ihrer Eigenverantwortung unterstützt und gestärkt werden, um die Anforderungen in Mathematik mit Klarheit, Stringenz und Erfolg zu meistern. Im Beitrag wird der Maßnahmenkatalog kurz vorgestellt und exemplarisch mit Blick auf die strukturelle Gestaltung der Lernprozesse sowie der Aufgabenformate erörtert.
https://doi.org/10.37626/GA9783959870986.0.02
Rønning, Frode: Interaktion, Aktivität und Sprachförderung beim Lernen von Hochschulmathematik – Beispiele aus einem Norwegischen Entwicklungsprojekt. pp 19 – 28
Bis vor kurzem wurden an der NTNU die Mathematikveranstaltungen als klassische Vorlesungen in großen Hörsälen durchgeführt. Zusätzlich gab es schriftliche Einreichungen von Übungsblättern, die in kleineren Gruppen betreut wurden. In den letzten Jahren hat man verschiedene Maßnahmen durchgeführt, die vor allem eine höhere Aktivität in den Lernprozessen fördern sollten. Diese Maßnahmen bestehen aus mehreren Komponenten. Wichtig ist die Aufteilung der Vorlesungen in zwei Kategorien, sogenannte Übersichtsvorlesungen und Interaktive Vorlesungen. In den interaktiven Vorlesungen wird Interaktion unter den Lernenden und zwischen den Lernenden und den Dozenten gefördert. Eine weitere Maßnahme ist die teilweise Ersetzung schriftlicher Einreichungen mit computerbewerteten Einreichungen. In diesem Beitrag will ich die Rolle der Vorlesungen diskutieren und wie die Studierenden diese Rolle bewerten. Ferner will ich von Erfahrungen mit den computerbewerteten Aufgaben berichten, mit besonderem Blick auf eine Charakterisierung von Aufgaben, die für Computerbewertung geeignet sind.
https://doi.org/10.37626/GA9783959870986.0.03
Sarikaya, Nimet; Furlan, Peter: Ein Vergleich von Unterstützungsmaßnahmen im ersten Studienjahr zwischen Fachhochschule und Universität. pp 29 – 38
2015 wurde das Dortmunder Zentrum Studienstart (DZS) als gemeinsame Maßnahme der Fachhochschule Dortmund und der Technischen Universität Dortmund im Rahmen der Bildungsinitiative RuhrFutur gegründet. Ziel war die Unterstützung von Studienanfänger*innen für einen erfolgreichen Start ins Studium. Dabei wurden insgesamt elf Maßnahmen mit fachlichen Angeboten im Bereich der Mathematik sowie überfachlichen Beratungsangeboten und Veranstaltungen parallel an beiden Hochschulen konzipiert und durchgeführt. In diesem Beitrag stellen wir detailliert die fachlichen Elemente in den Fokus und vergleichen die Durchführung und Erfolge der folgenden Maßnahmen an beiden Hochschulen: Durchstarter-Kurse, Fit in die Mathe-Prüfung, Themenspecials und Mathe HelpDesk.
https://doi.org/10.37626/GA9783959870986.0.04
Altieri, Mike; Schellenbach, Michael; Schirmer, Evelyn; Opfermann, Christiane; Kunze, Jan Erik; Regnet, Julian; Paluch, Dirk: Unreal Engine 4 trifft H5P und PBL – Integration einer virtuellen Realität mit interaktiven Erklärvideos in ein digitales Fachkonzept zur Unterstützung problembasierten Lernens. pp 39 – 54
Problembasiertes Lernen zählt zu den Lernmethoden, die Studierende am besten auf die Anforderungen der Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts vorbereiten. Daher wurde problembasiertes Lernen an der Hochschule Ruhr West in zwei Grundvorlesungen zur Ingenieurmathematik eingebettet. Die Integration dieser zeitaufwändigen Lernmethode wird durch die Realisierung eines digital gestützten Fachkonzepts ermöglicht, bei dem moderne Technologien der Digitalisierung wesentlich zur Entlastung der Präsenzphasen beitragen, in denen jetzt problembasiertes Lernen stattfinden kann. In einem nächsten Schritt sollen die dort bearbeiteten Projekte in einer mit interaktiven Erklärvideos angereicherten virtuellen Realität nacherlebbar gemacht werden, wodurch Studierenden für die Nachbearbeitung der Projekte eine lernförderliche Alternative zur schriftlichen Musterlösung angeboten wird. Es werden das rahmengebende digitale Fachkonzept sowie die praxis- und theoriegeleitete Motivation zur Verschränkung von problembasierten Lernen und virtueller Realität beschrieben und die technische Umsetzung mit einem Ausblick auf geplante Entwicklungen dargestellt.
https://doi.org/10.37626/GA9783959870986.0.05
Bach, Volker; Barbas, Helena; Gasser, Ingenuin; Konieczny, Franz; Lohse, Alexander; Seiler, Ruedi: Formatives Assessment in Mathe-Kursen für Erstsemester: Digitalisierung eine Chance? pp 55 – 62
Das oHMint-Projekt entwickelt eine Online-Lernplattform zur Mathematikausbildung für MINT- und Wirtschaftsstudiengänge. Bausteine können in bestehende Kurse integriert oder eigenständig zusammengefügt werden. Sie ermöglichen einen variablen Einsatz hinsichtlich inhaltlicher Breite und Tiefe, der Bearbeitungsdauer und des didaktischen Konzepts. Die Hamburg Open Online University hat in einem Pilotprojekt 2017/18 die Erstellung des Kapitels Differenzialrechnung finanziert. Im Zentrum stehen innovative Konzepte wie z.B. formatives Assessment oder Audioaufgaben, die Hörverstehen in der Mathematikausbildung fördern. Das Gesamtprojekt wird von einem Konsortium getragen, dessen Mitglieder mehrheitlich bereits auch den Online Brückenkurs Mathematik OMB+ mit entwickelt haben. Dieser wird von über 50 Institutionen verwendet und spielt eine wichtige Rolle beim Übergang Schule/Hochschule. Das vorgelagerte oHMint-Pilotprojekt wird von der Uni Hamburg koordiniert und gemeinsam mit der HafenCity Universität und der Firma integral-learning GmbH umgesetzt.
https://doi.org/10.37626/GA9783959870986.0.06
Bauer, Thomas: Design von Aufgaben für Peer Instruction zum Einsatz in Übungsgruppen zur Analysis. pp 63 – 74
Die Methode der Peer Instruction bietet einen Ansatz, um Studierende in mathematischen Übungsgruppen fokussiert zu aktivieren. Hierdurch kann der Gefahr begegnet werden, dass das „Vorrechnen“ von Übungsaufgaben durch den Tutor der Hauptbestandteil der Übungen wird. Dreh- und Angelpunkt der Methode sind Aufgaben, die so beschaffen sind, dass sie die angestrebten fachbezogenen fokussierten Argumentationsprozesse bei den Studierenden anregen. Im Beitrag werden mehrere Iterationen von Design-Zyklen eines Projekts betrachtet, in dem solche Aufgaben konstruiert und eingesetzt wurden. Es wird gezeigt, dass das Projekt als Ergebnis einerseits Aufgaben für den wöchentlichen Einsatz in Übungsgruppen zur Analysis 1 und 2 (als praktischen Ertrag) erbrachte und es andererseits die Entwicklung von Design-Prinzipien für Peer-Instruction-Aufgaben als theoretischen Ertrag) ermöglichte.
https://doi.org/10.37626/GA9783959870986.0.07
Blum, Silvia: Diskontinuität in der Linearen Algebra: Was bedeutet der höhere Standpunkt? – Konkretisierung einer Denkfigur und qualitative Untersuchungen zu verschiedenen Zeitpunkten in der LehrerInnenbiografie. pp 75 – 88
Die Betrachtungen rund um die Begriffe Vektor und Skalarprodukt in Schule und Hochschule unterscheiden sich sichtbar und zeigen eine Diskontinuität im Bereich der Linearen Algebra auf. Der „Höhere Standpunkt“ ist in der Diskussion zum Fachwissen von Mathematiklehrkräften eine gängige Zielvorstellung. Unter der Leitfrage „Was bedeutet der ‚Höhere Standpunkt‘?“ werden zunächst verschiedene Konzeptionen des Höheren Standpunkts dargestellt. Anschließend wird der Fokus auf den Umgang angehender Lehrkräfte mit Diskontinuität im Bereich der Linearen Algebra gelegt. Für eine empirische Perspektive wurde eine Interview-Studie durchgeführt, deren Design ebenfalls im vorliegenden Beitrag dargestellt wird.
https://doi.org/10.37626/GA9783959870986.0.08
Feil, Lidia; Strauer, Dorothea; Zwingmann, Katharina: Entwurf und Einsatz von Lösungsbeispielen mit Lücken und Selbsterklärungsaufforderungen in Mathematikveranstaltungen für Studierende der Pharmazie und der Biologie. pp 89 – 100
Studierenden in den Lebenswissenschaften ist oft nicht bewusst, wie viel Mathematik, insbesondere Statistik, sie für ihren Studiengang benötigen. Auch wenn für den weiteren Studienverlauf die Anwendung auf verschiedene naturwissenschaftliche Probleme im Vordergrund steht, sollen die Studierenden in diesen Veranstaltungen auch ein Verständnis der mathematischen Methoden erlangen. Die Autorinnen erproben seit zwei Semestern in Mathematikveranstaltungen für Pharmazeuten und (Human-)Biologen die Verwendung von ausgearbeiteten Lösungsbeispielen (workedexamples). Die kleinschrittigen Lösungsbeispiele sind erstens mit Lücken versehen und
zweitens mit Selbsterklärungsaufforderungen. Dadurch soll eine aktive Auseinandersetzung der Studierenden mit dem Lösungsweg wie auch mit der zugrunde liegenden Mathematik gefördert werden.
https://doi.org/10.37626/GA9783959870986.0.09
Fleischmann, Yael; Kempen, Leander; Mai, Tobias; Biehler, Rolf: Die Online-Lernmaterialien von studuVEMINT: Einsatzszenarien im Blended Learning Format in mathematischen Vorkursen. pp 101 – 116
In diesem Beitrag berichten wir von der Integration der studiVEMINT-Online-Lernmaterialien in einen Präsenzmathematikvorkurs an der Universität Paderborn im Jahr 2017. Wir beschreiben insatzszenarien für die Einbindung ausgewählter E-Learning Elemente in traditionelle Präsenzlehre und stellen exemplarische Evaluationsergebnisse vor.
https://doi.org/10.37626/GA9783959870986.0.10
Lankeit, Elisa; Biehler, Rolf: Vorstellung einer Aufgabe zu den Zusammenhängen verschiedener Differenzierbarkeitsbegriffe im Mehrdimensionalen. pp 117 – 132
Im Mehrdimensionalen gibt es verschiedene Differenzierbarkeitsbegriffe, die miteinander in Verbindung stehen, wie zum Beispiel totale Differenzierbarkeit, partielle Differenzierbarkeit und Richtungsableitungen. Zur Verbindung dieser Begriffe untereinander und zur Verknupfung der neuen Begriffe mit dem bekannten Differenzierbarkeitsbegriff im Eindimensionalen wurde eine Aufgabe nach dem Prinzip des Didactic Engineering aus der Theory of Didactical Situations in Mathematics entwickelt und im Rahmen einer Prasenzubung in der Analysis II eingesetzt und die Bearbeitungen der Studierenden analysiert. Hierzu werden ersten Ergebnisse vorgestellt.
https://doi.org/10.37626/GA9783959870986.0.11
Moser-Fendel, Jeremias; Wessel, Lena; Klinger, Marcel: Was bringen StudienanfängerInnen mit? – Konzeptualisierung des Vorwissens zu Algebra und Funktionen von Erstsemesterstudierenden in INT-Studiengängen. pp 133 – 148
Zunehmende Heterogenität und hohe Abbruchquoten (z.B. Heublein & Schmelzer 2018) in MINT-Fächern sind äußere Rahmenbedingungen für Forschung am Übergang Schule-Hochschule in den vergangenen Jahren. Mathematisches Vorwissen von Studienanfängerinnen und -anfängern bewährt sich als guter Prädiktor für den Studienerfolg (z.B. Derr et al. 2018). An einer qualitativen Beschreibung des benötigten Vorwissens für ein MINT-Studium wird derzeit gearbeitet (z.B. Rach & Ufer 2018). Vielfach werden Studierenden unzureichende Fähigkeiten im Bereich der elementaren Algebra (z.B. Termumformungen) attestiert. Zur genaueren Analyse des auf Algebra und Funktionen bezogenen Vorwissens von Studienanfängerinnen und -anfängern in INT-Fächern wurde daher an der Universität Freiburg, ausgehend vom Testinstrument FALKE (Klinger 2018), ein Testinstrument entwickelt und erprobt. Die Ergebnisse einer Datenerhebung bei n=353 INT Studierenden (Umwelt- und Naturwissenschaften, Ingenieurswissenschaften und Informatik) werden dargestellt und diskutiert
https://doi.org/10.37626/GA9783959870986.0.12
Neuhaus, Silke; Rach, Stefanie: Situationales Interesse von Lehramtsstudierenden für hochschulmathematische Themen steigern. pp 149 – 156
Das situationale Interesse von Studierenden ist ein wichtiger Faktor, damit Studierende motiviert ihr Studium bewältigen. Inwiefern das situationale Interesse von individuellen Merkmalen der Lernenden abhängt und inwiefern es durch die Bearbeitung einer wertexplizierenden, mathematischen Aufgabe gesteigert werden kann, ist noch nicht geklärt. Anhand einer Studie mit 46 Lehramtsstudierenden im Fach Mathematik wird diesen Fragen nachgegangen.
https://doi.org/10.37626/GA9783959870986.0.13
Oldenburg, Reinhard: Genetische Ideen in der Analysis I. pp 157 – 166
Die seltene Gelegenheit, als Didaktiker eine Analysis-I-Vorlesung halten zu können, hat zu einer moderaten Neukonzeption dieser klassischen Vorlesung geführt, die evolutionär genetischen Ideen mehr Raum gibt, als das traditionell der Fall ist. In diesem Beitrag werden einige dieser Ideen erörtert.
https://doi.org/10.37626/GA9783959870986.0.14
Stuhlmann, Ann Sophie: Kooperative Beweisprozesse Mathematiklehramtsstudierender in der Studieneingangsphase. pp 167 – 174
Der folgende Beitrag beschäftigt sich mit kooperativen Beweisprozessen von Mathematiklehramtsstudierenden, die im Rahmen einer mathematischen Einführungsvorlesung Lineare Algebra und Analytische Geometrie stattfanden. Das Forschungsinteresse bezieht sich auf das Potenzial von Gruppenarbeit für das Erlernen des Beweisens. Dazu wird eine interaktionistische Perspektive auf kooperative Beweisprozesse von Mathematiklehramtsstudierenden eingenommen. Der Beitrag fokussiert auf Interaktionssituationen in Gruppenarbeit, die sich durch grundsätzlich unterschiedliche Situationsdeutungen in Bezug auf Beweiskonstruktionen auszeichnen. Solche Interaktionssituationen sind aus lerntheoretischer Perspektive von großem Interesse, da sie Möglichkeiten bieten, kognitive Konstruktionsprozesse der Beteiligten zu orientieren. Als erster Zugang zur Bearbeitung des Forschungsinteresses wird in diesem Beitrag eine Interaktionsanalyse aus einer Gruppenarbeit dargestellt, um das Lernpotenzial von Gruppenarbeit bezogen auf Beweisen zu illustrieren und zu diskutieren, wie Gruppenarbeit sinnvoll seitens der Universitäten unterstützt werden kann.
https://doi.org/10.37626/GA9783959870986.0.15
Weygandt, Benedikt; Skutella, Katharina: Blick nach vorne, Blick zurück: Ein Lehrkonzept für Bachelor- und Masterstudierende zur Überbrückung beider Diskontinuitäten. pp 175 – 184
Das in diesem Beitrag vorgestellte Lehrkonzept setzt bei beiden Diskontinuitäten des Lehramtsstudiums Mathematik an: Adressiert werden sowohl Studierende des Lehramts Mathematik, die sich am Ende ihres Studiums und damit kurz vor dem Übergang in den Lehrberuf befinden, als auch Studierende, die sich am Anfang ihres Studiums befinden und ihre erste Fachvorlesung Analysis I besuchen. Im Rahmen eines fachdidaktischen Seminars vertiefen Masterstudierende von einem höheren Standpunkt aus rückblickend die Inhalte der Analysis I, erkennen Schnittstellen zwischen Schul- und Hochschulmathematik und überwinden Diskontinuitäten in der eigenen Lernbiographie. In der Rolle als Lehrkraft entwerfen sie zu zentralen Themen der Analysis (u. a. Stetigkeit, Differenzierbarkeit) Workshops für Bachelorstudierende der Vorlesung Analysis I. Diese erhalten dort die Möglichkeit, wichtige Begriffe und Konzepte der Analysis anhand hochschuldidaktisch fundierter Schnittstellenaufgaben und entsprechender Methoden genauer unter die Lupe zu nehmen. Zwei Zielgruppen, die sich jeweils an einer der Schnittstellen befinden und mit ihrem spezifischen Blick auf die Inhalte der Analysis schauen, werden so in einen fachlichen Austausch miteinander gebracht. Dieser Beitrag berichtet von ersten Erfahrungen bei der Durchführung im Sommersemester 2018 und von der Entwicklung eines Tests zum Begriffsverständnis in der Analysis, welcher im Sommersemester 2019 sowohl mit Bachelor- als auch mit Masterstudierenden der Freien Universität durchgeführt wird und Rückschlüsse auf die Nachhaltigkeit der aktuellen Fachausbildung im Lehramtsstudium Mathematik ermöglichen soll.
https://doi.org/10.37626/GA9783959870986.0.16
Wilzek, Wieland: Interaktive dynamische Visualisierungen als Unterstützungsangebot im fachmathematischen Studium – Chancen und Gefahren der Anschauung. pp 185 – 195
Um Studierende des fachmathematischen Studiengangs bei Schwierigkeiten mit der formalen Axiomatik und abstrakten Begriffsbildung in der Studieneingangsphase zu unterstützen, können interaktive dynamische Visualisierungen vorlesungsergänzend eingesetzt werden. Um solche Veranschaulichungen theoretisch zu legitimieren, wird zunächst die Rolle von Anschauung in der Hochschullehre kritisch diskutiert. Anschließend wird ein Beispiel einer Visualisierung zum Mittelwertsatz der Differentialrechnung vorgestellt und die Rahmenbedingungen der Einbettung in den Lehrbetrieb sowie die zugrundeliegenden Gestaltungsprinzipien erläutert. Der Artikel endet mit einem Resümee, in dem die bisher gesammelten Erfahrungen zum Einsatz von interaktiven dynamischen Visualisierungen dargestellt werden.